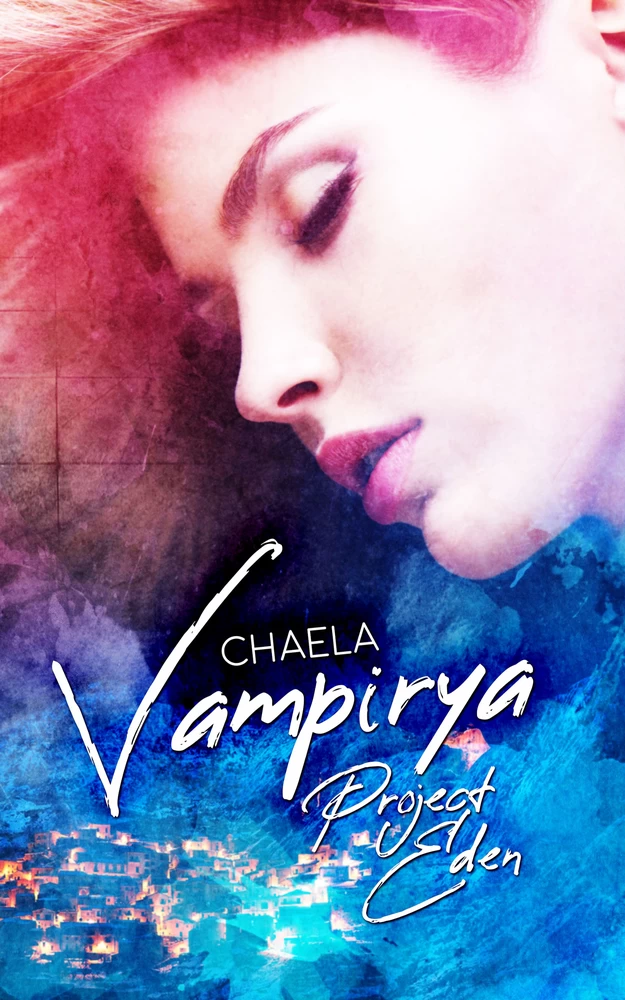Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
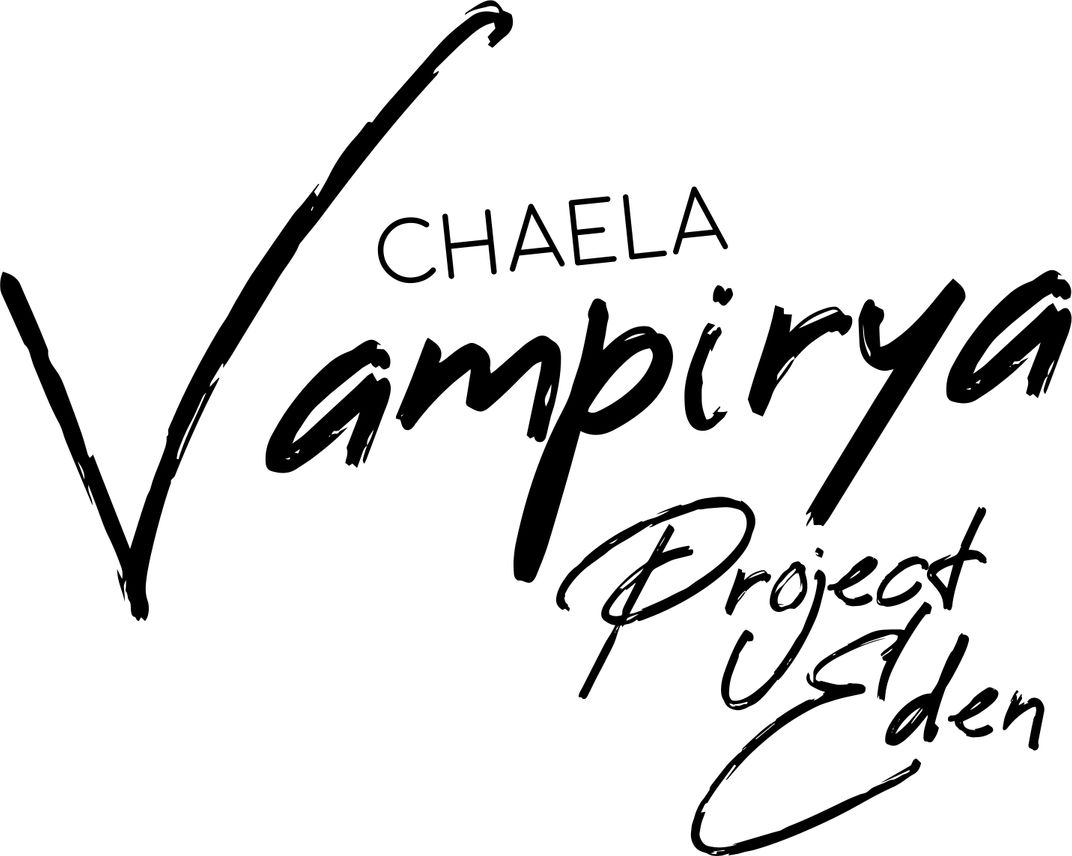

Die Spende
Es war seltsam, den Blutstropfen bei ihrer Wanderung durch den langen halbtransparenten Plastikschlauch zuzuschauen. Von jenem Moment an, als sie meinen Arm verließen, wirkte es so, als gehörten sie nicht mehr länger zu mir. Deswegen empfand ich auch nichts als Gleichgültigkeit beim Anblick des Blutbeutels am anderen Ende des Schlauches.
Als er fast voll war, kam eine junge, blonde Frau in einem weißen Kittel an meine Liege. Ihre bleichen Finger prüften sorgfältig den Beutel. »Sie haben es geschafft«, sagte sie, lächelte dabei sanft und nahm den Beutel ab.
»Ich möchte noch einen abgeben«, ließ ich sie ohne Zögern wissen.
Sie hielt kurz inne. »Gerne«, sagte sie und machte sich daran, einen leeren Beutel aufzuhängen.
Ich ließ es geduldig über mich ergehen und beobachtete die anderen Menschen im Raum. Es waren etwa zwanzig Liegen, die im Kreis aufgestellt waren. Auf den meisten von ihnen lagen Männer verschiedenen Alters. Ein Bursche fünf Liegen weiter sah kaum älter aus als fünfzehn. Er hatte die Augen fest zusammengekniffen und den Kopf weggedreht. Es machte mich traurig und wütend zugleich, ihn leiden zu sehen.
Ich wand mich ab und starrte auf meinen rechten Arm. Ich erinnerte mich noch sehr genau an jene Nacht vor neun Jahren, in der ich ihn verloren hatte, um meine Mutter und meine damals noch ungeborene Schwester zu beschützen. Mein siebzehnjähriges Ich hatte sich damals für eine Prothese aus Silber entschieden, die ich nun unter einem schwarzen Lederhandschuh verbarg.
Gelächter riss mich aus meinen Gedanken. Drei Liegen rechts von mir lag ein Mann umringt von drei Vampirdamen und scherzte mit ihnen. Er hatte sein feuerrotes Haar zusammengebunden und sich einen markanten grünen Schal um den Hals geschlungen. Die beiden Vampirinnen schienen sich in seiner Gegenwart prächtig zu amüsieren. Die anderen Menschen im Raum fanden es offensichtlich weniger toll. Mir entging nicht, wie sie ihn anstarrten.
»Fertig.«
Verwundert drehte ich meinen Kopf in die Richtung, aus der ich die Stimme der blonden Vampirin im weißen Kittel vernommen hatte. »Schon?« Wenn man sich nicht darauf konzentrierte, ging die Blutabnahme doch sehr schnell vonstatten.
»Ja, Sie können sich dann draußen Ihre Rationen abholen.«
»Ich möchte noch einen abgeben.«
Jetzt sah sie betroffen drein. »Es tut mir Leid, aber mehr als zwei pro Person und Sitzung können wir nicht abnehmen.«
»Bitte! Ich schaffe das.«
Sie schüttelte den Kopf und sah mich mitleidig an. »Tut mir leid«, wiederholte sie.
Ich wollte gerade aufstehen, als mir mit einem Mal ziemlich schwummrig wurde, so dass ich mich auf die Bettkante setzen musste.
»Warten Sie«, sagte die Vampirin und lief einmal um die Liege herum, bis sie vor mir stand. Sie reichte mir ein Stück Zucker und ein Glas Wasser. »Hier.«
»Danke«, sagte ich müde und schob mir den Würfelzucker in den Mund, wo ich ihn langsam unter der Zunge zergehen ließ.
Mein Blick wanderte noch einmal durch den Raum. Sowohl der Junge als auch der Rothaarige waren bereits fort und ihre Liegen wurden für die Nächsten vorbereitet.
»Reinlassen!«, brüllte eine burschikose Frau am Eingang.
»Sie können sich ihre Ration draußen abholen«, wiederholte die Vampirin neben mir.
»Mädchen, das muss schneller gehen!« Plötzlich stand die Vampirin vom Eingang neben uns.
»Tut mir leid«, entschuldigte sich die Blonde kleinlaut.
Ich nickte ihr kurz zu und stand auf. Ich war mir sicher, dass sie wahrscheinlich schon bei meiner nächsten Blutabnahme in spätestens drei Monaten nicht mehr so freundlich sein würde. Nach einer Weile wurden alle Vampire, die in der Oberwelt arbeiteten, grob und unfreundlich im Umgang mit Menschen.
Draußen war es bitterkalt und der Schnee am Boden war durch die vielen Menschen, die sich heute zur Blutabgabe hierher begeben hatten, längst zu braunem Matsch getreten worden.
Ich begab mich zur Rationsvergabe. Dort war die Schlange der Wartenden bereits verschwunden. Einen Letzten sah ich noch mit seiner Ration Reis davon laufen.
Ich stellte mich vor den Tresen.
»Einscannen«, befahl der Vampir dahinter. Ein weiterer stellte sich neben mich und scannte den kleinen Chip in meinem Nacken.
»A320. Zwei Portionen«, sagte er gelangweilt.
A320. So hieß ich für die Vampire. Meinen richtigen Namen, Aidan, verwendeten sie niemals.
Ein dritter Vampir hinter ihm hob zwei Säcke aus einer Kiste und drückte sie mir in die Hand.
»Der Nächste!«, hörte ich den hinterm Tresen dann brüllen. Hinter mir verließ bereits der nächste Blutspender den Liegeraum.
Ich zog es vor, selbst zu gehen, statt weggeschoben zu werden, und schlurfte einen Sack in jeder Hand davon.
Doch weit kam ich nicht.
»Ganz schön gierig«, sagte jemand hinter mir.
Als ich mich umdrehte, stand der rothaarige Kerl vor mir und grinste mich an.
»Nun, wir haben Winter«, sagte ich.
»Schon klar«, antwortete er und warf mir seinen Sack zu. »Bitteschön.«
Reflexartig ließ ich die beiden anderen fallen und fing ihn auf. Dann sah ich ihn verwundert an. »Brauchst du ihn nicht?«
»Um ehrlich zu sein, nein. Ich mag keinen Reis.« Er lächelte noch immer.
»Ganz schön waghalsig«, sagte ich.
»Keinen Reis zu mögen?«
»Inmitten eines Raumes voller verzweifelter, ihres Blutes beraubter Menschen mit Vampiren zu scherzen.«
»Ach, das«, sagte er gelassen. »Trübsal blasen hat noch niemanden weiter gebracht.« Dann reichte er mir die Hand. »Mein Name ist Noah.«
Ich tat es ihm gleich. »Aidan«.
Noahs Lippen kräuselten sich kurz. »Kräftiger Händedruck.«
»Prothese.«
»Das erklärt Einiges«, gab er zurück. Ohne meine Prothese loszulassen, drehte er sie so, dass meine Handinnenfläche nach oben zeigte, dann löste er seine Finger und schloss dabei meine Finger zu einer Faust. Zwar spürte ich nichts, doch ich sah kurz etwas Weißes auf meiner Handfläche aufblitzen.
Noah wandte sich zum Gehen. »Ich wünsche dir eine angenehme Heimreise.«
»Ebenso.«
Ich ließ den Gegenstand in meiner Hand in meiner Hosentasche verschwinden, nahm meine drei Säcke Reis und verließ das Blutspendezentrum, das sich in der Mitte der verfallenen Hauptstadt befand. Sie war der nächstgrößere Ort im Umkreis der Farm, auf der ich mit meiner Mutter und meinen Geschwistern lebte.
Während ich an zerstörten Gebäuden vorbei ging, deren Wände mit unzähligen hasserfüllten Parolen beschmiert waren, sah ich hin und wieder eine arme Menschenseele. Den kleinen Sack Reis an die Brust gedrückt, flüchteten sie so schnell wie möglich aus der Stadt.
Ich hätte es ihnen gern gleichgetan, doch zwei Blutabgaben in so kurzer Zeit zollten bereits jetzt ihren Tribut. So ausgelaugt, wie ich im wahrsten Sinne des Wortes war, fühlten sich die drei Säcke an wie Beton.
Ich war ein ganzes Stück gelaufen, die Stadt in der Ferne geschrumpft und der Reis dreißig Kilo schwerer geworden, als ich mich schließlich traute, das Stück Papier aus der Hose zu kramen.
Es war ein zusammengeknüllter, zerrissener Fetzen, den ich sorgsam auseinanderfaltete. Im Licht der Wintersonne erkannte ich darauf eine Bleistiftzeichnung, die so auch ein Kind gemalt haben konnte: Ein Windrad, an dessen Rotor ein Blatt fehlte. Daneben war eine kleine, halbe Sonne am Horizont, über der ein Pfeil nach oben zeigte.
Die Botschaft war offensichtlich so gestaltet, dass ein Unbeteiligter sie für Kinderunfug halten würde. Der für den sie bestimmt war, würde jedoch wissen, was darauf zu sehen war.
Und das tat ich. Ich kannte den Ort, der hier auf diesem kleinen Stückchen Papier skizziert war. Natürlich konnte es mehr als eine Windkraftanlage geben, an der ein Rotorblatt fehlte, aber ich war mir recht sicher, dass er jene Anlage meinte, die nur wenige Stunden von unserer Farm entfernt stand. Dort wollte er sich also mit mir treffen.
Ich knüllte das Papier wieder zu einer kleinen Kugel zusammen und schob es zurück in meine Hosentasche. Dann setzte ich meinen Weg fort.
Die Sonne war bereits in Begriff unterzugehen, als ich erschöpft dort halt machte, wo ich immer innehielt, wenn ich zwischen der Stadt und unserer Farm unterwegs war. Für jeden anderen war es eine gewöhnliche Wiese. Für mich war es eine wundervolle Erinnerung. Die Erinnerung an eine junge Frau, die im Regen tanzt. Wäre sie um diese Jahreszeit hier gewesen, hätte sie ihren geliebten Regen nie kennengelernt. Stattdessen wäre er als Schnee heruntergefallen. Aber wahrscheinlich hätte sie sich auch darüber gefreut. Ich betrachtete die leere Wiese, bedeckt von vierzig Zentimetern unberührtem weißem Schnee, und stellte mir vor, wie sie darin einen Schneeengel malte. Dann ging ich weiter.
Im Dunkeln stieg ich den Hügel vor unserer Farm hinauf. Im Licht, das aus den Fenstern schien, sah ich wie meine kleine Schwester Cally mit ihrem Hund, meinem Bruder Ben und dessen Freundin Ilona einen Schneemann baute. Ich war mir sicher, dass Ben mitbekam, dass ich mich ihnen näherte, dass ich auf der Ladefläche unseres kleinen Transporters Platz nahm und die drei Säcke müde hinter mir abstellte. Doch er unterbrach Callys Spiel nicht. Er ließ sie unbeirrt einen Mund und Augen aus kleinen Steinen formen. Statt einer Karottennase reichte Ilona ihr einen kleinen Stock.
»Ihm fehlt noch ein Hut!«, sagte Cally.
»Ich hole ihm schnell einen«, antwortete Ilona.
Doch bevor sie aufstehen konnte, hatte Ben sich bereits erhoben. »Ich mach das schon.«
Er ging zum Haus, nahm einen leeren Eimer neben der Hauswand und gab ihn Cally. Während diese den Eimerhut auf dem Kopf des Schneemanns platzierte, setzte Ben sich wieder neben Ilona und legte seine Hand kurz auf ihren Bauch. Durch den dicken Wintermantel war die kleine Kugel nicht zu sehen.
»Aidan!«, hörte ich da Cally rufen. Aufgeregt kam sie auf mich zu gerannt, umarmte mich und setzte sich zu mir auf die Ladefläche. »Da bist du ja wieder. Hast du den Reis mitgebracht?«
»Ja«, antwortete ich.
Cally warf einen Blick hinter mich. »Gleich drei?«
»Ja.«
»Ben und Ilona haben einen Schneemann mit mir gebaut!«
Ihr kleines Gesicht strahlte und ihre roten Bäckchen bildeten einen Kontrast zu ihrer weißen Wollmütze.
»Er sieht toll aus, Sonnenschein.«
»Cally, es wird Zeit reinzugehen«, rief Ilona in unsere Richtung.
Meine kleine Schwester sah mich fragend an.
»Geh ruhig schon rein. Ich komme gleich nach.«
»Okay.« Sie gab mir einen kleinen Kuss auf die Wange. »Komm, Hugo!«, hörte ich sie noch rufen, bevor sie mit dem Terrier und Bens Freundin im Haus verschwand.
Ben kam auf mich zu. »Drei Säcke?«, fragte auch er.
Ich nickte.
»Du bist verrückt.«
Ich antwortete nicht, stattdessen stand ich auf. Wie gerne hätte ich mir doch selbstbewusst die drei Säcke geschnappt und wäre an ihm vorbei ins Haus gegangen. Doch mein Kreislauf machte mir noch immer einen Strich durch die Rechnung. Mit einem flauen Gefühl im Magen setzte ich mich wieder hin.
»Warte, ich mach das schon«, sagte Ben und nahm sie mir ab.
»Danke«, sagte ich leise.
»Kein Ding.«
Im Haus saßen Ilona und Cally bereits am Esstisch. Mutter stellte einen großen Topf vor ihnen ab, sah mich und strahlte wie immer.
»Da bist du ja«, sagte sie und umarmte mich, dann legte sie eine Hand an mein Gesicht. »Du bist ganz blass. Du solltest nicht soviel abgeben.«
»Schon in Ordnung, Mutter.«
Sie sah mich traurig an, entgegnete jedoch nichts.
Kaum das wir alle saßen, füllte sie jedem von uns eine Schüssel mit Eintopf.
»Schon wieder nur Gemüse«, sagte Cally leicht angewidert.
»Ab morgen gibt es dank deinem Bruder Reis mit Gemüse«, entgegnete Mutter.
Meine kleine Schwester verdrehte kurz die Augen.
»Wie konntest du bitte drei Beutel abgeben und dann noch hierherlaufen?«, fragte Ben, nachdem wir zu essen begonnen hatten.
»Es waren keine drei, es waren zwei.«
»Sie haben dir drei Säcke Reis für zwei Beutel Blut gegeben?«, fragte Ilona.
Ich schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht. Jemand anderes hat mir den Dritten geschenkt.«
Ben hielt inne. »Jemand anderes?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Ich hab ihn noch nie zuvor gesehen.«
»Nun, wer weiß wie mitleidig du nach zwei Beuteln Blut ausgehen hast.«
»Ben!«, mahnte Mutter.
»Schon in Ordnung, Mutter«, wiederholte ich meine eigenen Worte.
Lange nach dem Essen saß ich noch auf meiner Bettkante. An Schlaf war nicht zu denken. Stattdessen betrachtete ich die kleine Nachricht auf dem zerknüllten Papier. Mit der Sonne und dem Pfeil konnte nur der Sonnenaufgang gemeint sein. Wenn ich mich also dazu entschied, zum Treffpunkt zu gehen, musste ich jetzt aufbrechen.
Ich öffnete die Schublade meines Nachttisches und legte den Zettel hinein. Ich wollte sie wieder schließen, doch da fiel mein Blick auf Rains Umhang. Mit meiner linken Hand strich ich über den schwarzen Stoff, dann zog ich ihn heraus und roch daran. Ich wollte ihren Duft inhalieren, wie ich es unzählige Male in den vergangenen Monaten getan hatte. Doch er roch schon seit einiger Zeit nicht mehr nach ihr.
Ich erinnerte mich daran, wie sie ihn mir gegeben hatte, als wäre es gestern gewesen. Kurz bevor sie zurück ins Humanodrom gegangen war. Es war das letzte Mal gewesen, dass wir einander hatten küssen können. Ich hatte mich nicht mal richtig von ihr verabschiedet. Zu groß war meine Angst gewesen, ihr zu schaden, wenn die anderen Vampire von unserer Liebe erfuhren. Und nun war ich hier und sie dort. Die Erinnerung an sie und ihren Umhang, mehr war mir nicht geblieben.
Ich legte den Umhang zurück in die Schublade und schob sie wieder zu. Mein Entschluss stand fest.
Keine Viertelstunde später schlich ich mich nach unten in die Küche, um mir ein Stück Brot einzupacken. Dann zog ich meine Jacke an, schlüpfte in meine dicken Stiefel und öffnete die Haustür.
»Du gehst schon wieder?« Cally stand plötzlich am Fußende der Treppe. Sie trug ihren lila-weiß gepunkteten Schlafanzug, ihr langes Haar war zu einem krausen Zopf gebunden. Hugo stand direkt hinter ihr, gab aber zu meinem Glück keinen Ton von sich.
»Cally«, flüsterte ich.
Sie kam langsam auf mich zu geschlurft. Ihre Unterlippe zitterte leicht.
»Ich muss etwas erledigen. Aber ich bin wieder da, noch bevor du wieder aufwachst, und dann können wir deinem Schneemann eine Freundin bauen, ja?«
»Okay«, sagte sie.
»Okay«, antwortete ich, drückte sie noch einmal an mich und gab ihr einen Kuss aufs Haar. »Ich hab dich lieb, Sonnenschein.«
»Ich hab dich auch lieb, Aidan.«
Ich öffnete abermals die Tür. »Und jetzt husch schnell wieder ins Bett, bevor Mutter und Ben wach werden.«
Sie nickte stumm.
Mit einem letzten Blick auf sie trat ich nach draußen und schloss langsam die Tür hinter mir.

Hoffnung
Ich wusste nicht, ob der Weg zum Windrad schon immer so lang gewesen war oder ob es mir nur so vorkam, weil der Blutverlust noch immer an mir zerrte. Auf jeden Fall war ich erleichtert, als ich das kaputte Windrad endlich erreichte. Auf dem Boden lag noch immer das abgefallene Rotorblatt. Statt von Moos und anderen Pflanzen war es nun mit Schnee bedeckt. Ich ging zur Tür auf der anderen Seite des Rades. Es war nicht das erste Mal, dass ich ein Windrad betrat. Für gewöhnlich besuchte ich eines in der Erntezeit, um Strom für das Ladegerät unserer Autobatterie abzuzapfen. Wahrscheinlich hatte sich Noah deshalb das kaputte Windrad ausgesucht. Kein Unbeteiligter würde hier versehentlich auf uns stoßen.
Umso verwunderter war ich, im Inneren neben Noah noch einen weiteren Menschen zu sehen. Einen, den ich kannte.
Ihr pechschwarzes Haar und ihr hübsches Gesicht mit den asiatischen Zügen waren unverkennbar. Im Licht der letzten Neonröhre, die hier drin noch leuchtete, sah ihre helle Haut noch etwas bleicher aus.
»Schön, dass du meinem Aufruf gefolgt bist«, begrüßte mich Noah.
Ich nickte ihm nur kurz zu, dann wandte ich mich an die junge Frau. »Evelyn?«
»Aidan.«
»Ihr kennt euch?«, fragte Noah.
»Ja«, antwortete ich schlicht.
»Könnte man so sagen«, sagte Evelyn verhalten. Auch sie schien kein Interesse daran zu haben, Noah zu erzählen, dass wir vor einigen Jahren etwas miteinander gehabt hatten.
Ich wandte mich wieder an Noah. »Warum sind wir hier?«
»Ihr seid hier, weil ihr mir aufgefallen seid.«
»Aufgefallen?« Ich machte einen Schritt zurück. »Bist du von der Regierung?«
»Gott bewahre, nein«, sagte er.
Evelyn legte eine Hand an meinen Oberarm. »Aidan, Noah will uns helfen.«
»Wie?«
»Ich war letzte Woche Blut spenden. Dabei wurde ich von der Lotterie gezogen«, sagte sie.
»Was?!«
»Sie ist der eine Glückspilz unter tausend Leidenden, der diese Woche eine kostenlose Umwandlung gewonnen hat«, kam es von Noah.
»Ich weiß, was die Lotterie ist«, sagte ich.
»Ich will das nicht, Aidan. Ich möchte nicht so sein wie sie. Wie diese Monster.« In Evelyns Augen sah ich Angst.
Ein Teil von mir wollte ihr sagen, dass nicht alle Vampire Monster waren. Der andere hielt ihn jedoch erfolgreich zurück. Stattdessen wandte ich mich wieder an Noah. »Und wie willst du verhindern, dass sie sie mitnehmen?«
Er begann mit vor der Brust verschränkten Armen durch den kleinen Steuerraum zu laufen. »Indem ich sie aus der Kartei tilge.«
»Wie das?«
»Das ist eine lange Geschichte.«
»Nur zu, ich habe Zeit.«
»Nicht so viel Zeit wie die, die uns jagen.«
Ich musterte ihn stumm.
»Ein Mensch, der bei der Blutspende mit den Vampiren scherzt, ist waghalsig, hast du gesagt«, erinnerte er mich.
»Ja.«
»Gleichzeitig warst du – unter all diesen Menschen – der, der mich am finstersten angefunkelt hat. Und sie war eine der wenigen, die bei der Verkündung ihres Preises nicht in Freudentränen ausgebrochen ist, sondern der Verzweiflung nahe war.« Er blieb stehen und sah uns beide an. »Ich habe euch kontaktiert, weil ihr diejenigen wart, die genug Hass auf die Vampire verspüren, um unsere Mission nicht zu verraten.«
»Mission?«, fragte ich.
Er trat näher.
»Wenn ich dir erzählte, dass es einen Ort gibt, an dem es medizinische Versorgung, Strom und fließendes Wasser gibt. An dem du Nahrung erhältst ohne Gegenleistung. An dem Kinder nicht bangen und Menschen nicht leiden müssen, was würdest du darauf antworten?«
»Ich würde antworten, dass du das Buch zuklappen solltest.«
»Traust du dich nicht, umzublättern, Aidan?«
Ich schüttelte langsam den Kopf.
Er trat noch näher. Ich konnte mein Spiegelbild im Blau seiner Augen sehen. »Was hast du denn zu verlieren?«
»Wann?«
»In einer Woche. Genau hier, selber Ort, selbe Zeit.«
»Nur ich allein?«
»Du kannst deine Familie mitbringen, wenn du es möchtest.«
»Kann ich zurückkehren?«
»Ja. Du wirst kein Gefangener sein, sondern ein Gast.«
Ich nickte. »Ich werde da sein.«
»Ich freue mich.«
Noch am Morgen kam ich wieder zur Farm zurück. Für gewöhnlich schliefen wir in den Wintermonaten länger. Je mehr Energie wir sparen konnten, desto weniger Nahrung verbrauchten wir. Ich rechnete daher nicht damit, jemanden anzutreffen und wollte mich einfach in mein Bett schleichen.
Doch ich hatte die Haustür noch nicht hinter mir geschlossen, da sah ich Mutter an ihrem Platz am Esstisch sitzen. Vor ihr stand eine Kerze, die bereits ein gutes Stück abgebrannt war. Ein Teil des Wachses war an der Seite heruntergelaufen und auf den Holztisch getropft. Es schien sie nicht zu kümmern.
Ich trat näher und sah Tränen in ihren Augen.
»Mutter?«
»Wo bist du gewesen?«, fragte sie mit zittriger Stimme.
»Beim Windrad«, antwortete ich.
»Um Strom für das Auto zu holen? Es ist Winter, Aidan. Der Wagen ist nicht auf Schnee ausgelegt und das weißt du auch.«
Ich hielt kurz inne, überlegte ob ich ihr sagen sollte, warum ich dort gewesen war. Letztlich entschied ich mich dagegen und ging stillschweigend an ihr vorbei in Richtung Treppe.
»Ist es noch immer ihretwegen?«
Ich blieb auf der ersten Treppenstufe stehen.
»Es ist inzwischen zwei Jahre her, Aidan. Der Zugang wurde verschlossen. Du hast es selbst gesehen. Es gibt keinen Weg für dich dorthin und für sie keinen zu dir. Du musst loslassen und weiterleben.«
Ich drehte mich noch einmal zu ihr um, sagte jedoch nichts. Dann ging ich einfach die Treppe hinauf in mein Zimmer und zog die Tür hinter mir zu. Jacke und Schuhe zog ich aus. Den Rest behielt ich an und legte mich ins Bett.
Die Müdigkeit überkam mich sofort. Ich war im Begriff, vollkommen darin zu versinken, da hörte ich, wie jemand meine Tür öffnete. Ich drehte mich rasch um und erwartete Mutter im Türrahmen. Zu meiner Verwunderung stand dort jedoch meine kleine Schwester.
»Cally«, sagte ich müde.
»Darf ich mich zu dir legen?«, fragte sie zuckersüß. Sie trug noch immer ihren Schlafanzug.
Zur Antwort rückte ich ein Stück nach hinten und hob meine Decke an.
Ohne Zögern schloss sie die Tür und schlüpfte zu mir ins Bett.
»Das mit Mama tut mir Leid. Sie hat mich erwischt, als ich in mein Zimmer gehen wollte, und mich gefragt, warum ich weine. Ich habs nicht geschafft, sie anzulügen.«
»Ist schon okay, Sonnenschein. Lügen sind sowieso nicht schön«, murmelte ich bereits etwas schlaftrunken und legte die Decke um uns.
Ich vernahm noch, wie sie sich enger an mich schmiegte, dann fiel ich in einen traumlosen Schlaf.
Es war das einfallende Sonnenlicht, das mich wieder weckte. Ich war allein, Cally lag nicht mehr bei mir.
Ich warf einen Blick aus dem Fenster. Der Stand der Sonne verriet mir, dass wir bereits späten Nachmittag hatten. Kein Wunder, dass Cally nicht mehr da war. Stattdessen entdeckte ich sie beim Blick aus dem Fenster mit Ilona und Ben auf der Wiese vor dem Haus.
Noch immer nicht gänzlich erholt, stand ich auf, zog mir etwas Warmes an und ging zu ihnen nach draußen. Meine kleine Schwester kam sofort auf mich zu und umarmte mich. Ben und Ilona nickten mir nur zu.
»Können wir reden?«, fragte ich an meinen kleinen Bruder gerichtet. »Unter vier Augen?«
»Klar«, sagte er, gab seiner Freundin einen flüchtigen Kuss und folgte mir.
Wir liefen in die verschneiten Äcker. Von einer dicken Schneeschicht begraben, ragten nur noch einige wenige, gefrorene Stummel empor.
»Also? Was gibt es?«, wollte er wissen, kaum das wir außer Hörweite der Mädchen waren.
»Ich hatte dir doch erzählt, dass mir jemand den dritten Sack Reis geschenkt hat.«
»Ja, hattest du.«
»Nun, ich habe mich letzte Nacht noch einmal mit ihm getroffen. Draußen am zweiblättrigen Windrad.«
»Und?« Mein Bruder schien unbeeindruckt von meinem nächtlichen Ausflug.
»Er hat mir von einem Ort erzählt, an dem die Menschen in Frieden leben können. Mit Strom und fließendem Wasser.«
Ben lachte bitter. »Und das glaubst du?«
»Hast du schon mal davon gehört?«
»Natürlich. Wer nicht? Wenn die Menschen die Hoffnung auf ein solches Leben verlieren, brauchen sie auch keinen Sack Reis mehr, der sie über den Winter rettet.«
»Du hältst es also für ein Gerücht?«
Ben lachte etwas lauter. »Ich bin vielleicht der Jüngere, aber du bist definitiv der Naivere.«
Ich blieb stehen. »Was, wenn es stimmt? Wenn es diesen Ort wirklich gibt?«
Ben tat es mir gleich. »Was, wenn es nicht stimmt? Wenn dieser Bastard für die Regierung arbeitet und dich in eine Falle locken will?«
»Diese Mühe würden sie sich nicht machen. Da gibt es leichtere Wege.«
»Die Ewigkeit kann verdammt langweilig sein. Wer weiß, was in den Köpfen der Blutsauger vorgeht.«
»Ich werde vorausgehen, um sicherzugehen, dass alles mit rechten Dingen zu geht.« Ich legte meine Hände auf seine Schultern und sah ihn eindringlich an. »Passt du solange auf unsere Familie auf, während ich weg bin?«
»Natürlich. Immer«, antwortete er.
»Letztes Mal nicht«, erinnerte ich ihn.
Er schob meine Hände weg. »Ich dachte, du bist nur einen halben Tag weg. Wie sollte ich ahnen, dass du in ein Loch fällst und über einen Monat mit dem Feind schläfst?«
»Sie ist nicht unser Feind«, knurrte ich.
Ben hob die Hände. »Schon gut, schon gut. Ich werde auf jeden Fall auf alle aufpassen, bis du zurückkommst. Falls du zurückkommst.«
»Danke, Kleiner.« Ich umarmte ihn. Er stand etwas steif und unbeholfen da, dann strich er mir verhalten über den Rücken.
Wenige Tage später packte ich im Halbdunkel meiner Mondlampe meinen Rucksack. Etwas zu essen und zu trinken, ein Messer und eine ältere Karte. Mehr brauchte ich nicht. Ich wollte gerade die Kerze löschen, da wanderte meine Hand fast von selbst zur Schublade meines Nachttisches und zog Rains Umhang heraus. Ohne genau zu wissen, warum, öffnete ich den Reißverschluss des Rucksacks und stopfte den Umhang in die Seitentasche.
Nachdem ich meine Zimmertür zugezogen hatte, schlich ich mich durch den Flur und in das Zimmer meiner kleinen Schwester. Sie lag in ihrem Bett und schlief tief und fest. Hugo, im Körbchen neben ihrem Bett, hob aufmerksam den Kopf und stellte die Ohren auf. Ich legte einen Finger auf die Lippen und streichelte ihn kurz.
»Braver Junge, schön leise sein«, flüsterte ich.
Dann kniete ich mich vor ihr Bett, strich ihr noch einmal übers Haar und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Wiedersehen, Sonnenschein. Wenn alles klappt, hast du vielleicht bald eine richtige Zukunft.
Das Windrad stand so einsam auf seiner Anhöhe wie eh und je. Ich sah die anderen, noch funktionierenden Windräder in der Ferne. Während sie sich unablässig drehten, um nicht festzufrieren, schritt ich an dem Berg aus Eis und Schnee vorbei, unter dem das dritte Rotorblatt begraben lag. Nur einige frische Spuren im Schnee verrieten mir, dass hier vor kurzem noch andere gewesen waren. Ich folgte den Spuren bis zur Tür. Drinnen vernahm ich leises Gemurmel. Einen Moment zögerte ich noch und dachte an das, was Ben gesagt hatte. Dass es möglicherweise eine Falle sein könnte und es besser wäre umzukehren. Die Entscheidung wurde mir schließlich abgenommen, als sich die Tür öffnete und eine Frau mit dicker Kapuze vor mir erschien. Sie sah besorgt zu mir auf.
Ich trat in den Raum und Noah kam auf mich zu. »Ah, ich dachte schon, du kommst nicht.«
»Warum sollte ich nicht?«, fragte ich.
»Nun, deine kleine Freundin hat sich wohl dagegen entschieden.«
»Eve? Sie ist nicht hier?«
Noah schüttelte den Kopf. »Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt los. Wir haben einen weiten Weg vor uns und das Wetter wird nicht besser.«
Von der Frau kam ein Wimmern. Erst jetzt fiel mir auf, dass sie einen Säugling unter dem Mantel trug. Nur das kleine Köpfchen guckte heraus.
Abgesehen von ihr waren noch zwei weitere Menschen mit uns im Raum. Beides junge Männer. Der eine war groß und dünn, der andere kleiner und etwas breiter.
»Folgt mir und versucht möglichst in meine Fußspuren zu treten. Wir wollen nicht das jemand erfährt, wie viele wir sind.« Mit diesen Worten öffnete Noah die Tür und trat hinaus ins Freie. Wir folgten ihm.
Wir waren etwa hundert Meter gelaufen, da hörten wir in der Ferne Rufe und blieben stehen.
»Halt! Halt, bitte! Bitte wartet!« Es war eine weibliche Stimme und sie kam näher.
»Na sieh mal einer an«, sagte Noah.
Aus dem Schneegestöber trat Evelyn. »Tut mir leid«, sagte sie etwas außer Atem. »Ich wurde aufgehalten.«
»Ist dir auch niemand gefolgt?«, fragte Noah.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Ganz sicher?«
Evelyn nickte eifrig.
»Gut, weiter gehts.«
Wir liefen den ganzen Tag und die halbe Nacht. Die meiste Zeit im Schutz der Bäume dichter Wälder. Es war bereits dunkel und die Temperaturen stark gefallen, als Noah uns schließlich zu einer Höhle führte.
»Hier werden wir rasten, bis die Sonne wieder hoch am Himmel steht. Ich werde uns etwas zum Essen machen. Versucht danach, etwas zu schlafen. Der Weg morgen wird weder leichter noch kürzer als der heutige.«
Er griff in seine Tasche, zog etwas kleines Schwarzes hervor und leuchtete damit in den hinteren Teil der Höhle. Ich wusste nicht, was mich mehr faszinierte: Die Tatsache, dass er hier Kisten mit Schlafsäcken, Geschirr und Nahrungsmitteln vorbereitet hatte, oder die, dass er Licht ohne Feuer machen konnte. Ja, sogar ohne Stromaggregat.
Er holte einen schwarzen Block aus einer Kiste am Rand der Höhle, stellte ihn auf den Boden und legte fünf Schlafsäcke um ihn herum.
Eve inspizierte neugierig den Block. »Was ist das?«
»Das ist ein Heizgerät mit Infrarotlicht. Es wärmt sehr gut und erregt in der Dunkelheit weniger Aufmerksamkeit als Feuer«, sagte Noah.
Wenig später gesellte ich mich zu ihm, während er uns auf einer wärmenden Glasplatte eine warme Suppe kochte. »Ihr habt also wirklich Strom.«
»Dachtest du, ich lüge?«, antwortete er gelassen, während er die Flüssigkeit mit einer Kelle in Schalen abfüllte. Eine davon reichte er mir.
»Ist das so abwegig?«
Er lachte. »Weniger abwegig als die Geschichte eines sagenumwobenen Ortes mit Wasser und Strom für jemanden, der nur Feuer und Bäche kennt, schätze ich.«
»Kann man so sagen. Ja.«
»Ich finde das sehr traurig.« Bitterkeit lag in seiner Stimme.
»Was?«
»Wir hatten alles. High Tech. Selbstfahrende Fahrzeuge. Kommunikation über Meere und Kontinente hinweg. Und jetzt haben wir gar nichts mehr. Innerhalb weniger Jahrzehnte zurückgeworfen ins Mittelalter. Und für was?«
»Für ewiges Leben?«, antwortete ich, während Noah die Schalen an die Anderen verteilte.
»Für einen Teil der Bevölkerung. Der andere Teil hat unter den Privilegierten zu leiden und das sollte nicht so sein.«
»Das stimmt«, erwiderte ich, doch er reagierte nicht.
»Nun«, sagte er schließlich. »Such dir einen Platz zum Schlafen.«
Ich ging hinüber zu einem der zwei freien Schlafplätze.
Links neben mir saß Eve und aß ihre Suppe derart schnell, dass man meinen konnte, sie habe seit Wochen nichts mehr gegessen.
»Das schmeckt gut«, sagte sie zufrieden, während ein kleines Rinnsal ihr Kinn herablief.
Ich deutete auf dieselbe Stelle an meinem Kinn. »Du hast da was.«
»Oh.« Sie wischte es hastig mit dem Ärmel ab.
Mit wenigen Schlucken leerte ich meine eigene Schale und leckte mir anschließend kurz mit der Zunge über die Lippen. Dann bemerkte ich, dass sie mich ansah.
»Damals hättest du sie mir mit dem Daumen vom Kinn gewischt und mich geküsst«, erinnerte sie mich.
Ich stellte die Schüssel weg und legte mich hin. »Damals.« Dann drehte ich ihr den Rücken zu.
Noah sollte Recht behalten. Unsere Wanderung am nächsten Tag war kein Stück einfacher als die am Vortag. Insbesondere da wir gegen Nachmittag den Weg in die Berge einschlugen. Immer häufiger erwischte ich mich dabei, wie ich mich nach der jungen Frau mit dem Baby umdrehte. Mir war klar, warum sie diese anstrengende Reise auf sich nahm: Sie wollte ihrem Kind mehr bieten als ein hartes Leben als wandelnde Blutbank.
Ich ließ mich etwas zurückfallen, bis ich neben ihr lief. »Wenn Sie möchten, kann ich Sie und das Baby ein Stück tragen.«
Ohne stehen zu bleiben, drehte sie ihren Kopf in meine Richtung, schüttelte ihn dann aber. »Danke, aber es geht schon.«
Ihre Stimme war sehr leise und zart. Man musste schon genau hinhören, um jedes ihrer Worte zu verstehen.
»Gut, aber … Falls doch, melden Sie sich einfach, ja?«
»Ja, danke«, sagte sie lächelnd. »Und du kannst mich Lucy nennen, wenn du möchtest.«
»Gerne. Und ... Wer ist das?« Ich deutete mit einem Kopfnicken auf das Bündel in ihren Armen.
»Jimmy.«
»Wie alt ist denn der kleine Mann?«
»Knapp drei Monate«, antwortete sie.
»Wow, das ist jung.«
»Ich weiß«, sagte sie. »Aber wenn sich eine solche Gelegenheit bietet, sollte man sie nicht verstreichen lassen.«
»Das stimmt. Wo ist denn sein Vater?«
»Nicht hier«, antwortete sie, dann senkte sie den Blick und ging zügig weiter.
Ich schluckte und sah ihr nach. Feinfühligkeit war nicht gerade eine meiner besten Eigenschaften, trotzdem oder gerade deswegen hatte ich nicht mit dieser Reaktion gerechnet. Ich zog noch in Erwägung ihr nachzulaufen und mich zu entschuldigen, als wir schlagartig allesamt stehen blieben.
»Da sind wir«, sagte Noah.
Wir standen am Waldrand. Weiter hinten sah ich Berge, vor uns lag eine große Wiese. Auf ihr standen mehr Menschen, als ich je gesehen hatte, abgesehen vielleicht von den Essensausgaben der Vampire oder den Zusammenkünften der ersten großen Rebellion in meiner Jugend. Über fünfzig Menschen hatten sich eingefunden und standen wie wir in kleinen Gruppen zusammen.
Bevor ich Noah fragen konnte, was das bedeutete, hörte ich plötzlich ein lautes Dröhnen.
Ich kannte das Geräusch nur zu gut und alle anderen Anwesenden taten das auch. Ein Helikopter bedeutete nichts Gutes, denn er war Technik, und Technik hatten nur die Blutsauger. Instinktiv versuchte ein Teil der Menschen, in den Wald hinein zu fliehen .
»Ganz ruhig!«, rief Noah und hob die Arme. »Keine Angst, es ist alles gut!«
Seine Stimme kam kaum gegen den lauten Motor an.
Neben mir hielt Lucy ihrem Säugling die Ohren zu. Ohne wirklich darüber nachzudenken, legte ich meine Hände auf ihre Ohren.
Der Helikopter flog über uns hinweg und landete nicht weit entfernt auf der Wiese. Als er leiser wurde, nahm ich meine Hände wieder von Lucys Ohren, und sie lächelte mir dankbar zu.
»Kommt!«, sagte Noah. »Kommt mit«, und befahl uns mit einer Geste, ihm zu folgen. Etwas zögerlich liefen wir ihm nach, bis wir nur noch ein paar Meter vorm Helikopter entfernt waren.
Ich sah mich um und bemerkte, dass auch die anderen Gruppen alle einen Anführer hatten, die nun mit ihren Leuten näher kamen.
Ich musterte die Maschine vor mir. Die Motoren wurden langsamer, das Dröhnen nahm ab. Die Frontscheiben waren verdunkelt und auch der Rest war pechschwarz, ohne Aufdrucke oder Ähnlichem, so dass der ganze Helikopter wie ein dunkler Fleck in der weißen Landschaft wirkte.
Die Tür des Helikopters öffnete sich wie von Geisterhand und eine Treppe schwebte herab. Noah setzte sich in Bewegung, stieg die wenigen Stufen hinauf und begann von dort oben zu sprechen.
»Ich weiß, dass euch das hier Angst macht und dass es befremdlich auf euch wirkt. Aber es ist leider notwendig. Schon bald werdet ihr alles verstehen.« Er machte eine kurze Pause, um seine Worte wirken zu lassen. »Ich möchte, dass ihr in den Helikopter steigt, wenn euer Gruppenleiter euch dazu auffordert. Wer nicht aufgerufen wurde, tritt bitte zurück, damit der Helikopter starten kann. Macht euch bitte keine Sorgen. Alle werden nach und nach mitgenommen.«
Er warf einen Blick zu einer jungen, brünetten Gruppenleiterin rechts neben uns. Sie nickte ihm zu, dann widmete sie ihre Aufmerksamkeit ihrer Gruppe: »Okay, ihr habt Noah gehört. Bitte folgt mir jetzt. Und zwar einer nach dem anderen. Nicht drängeln. Wir sind nicht an der Essensausgabe der Blutbank.«
Auf der anderen Seite gab ein Gruppenleiter seiner Gruppe die gleiche Anweisung. Noah kam währenddessen zu uns zurück. »Folgt mir bitte.«
Wir gingen einige Meter über die Wiese und setzten uns am Waldrand auf eine schneefreie Stelle. Die übrigen Gruppen zogen sich ebenfalls zurück. Dann beobachtete ich, wie sich die Tür des Helikopters schloss und seine Motoren langsam wieder anliefen.
»Wann sind wir dran?«, fragte Eve, kaum dass die Maschine am Horizont verschwunden war und wir unsere eigenen Stimmen wieder hören konnten.
»Als letzte«, antwortete Noah und lächelte dabei, offensichtlich in vollem Bewusstsein, dass diese Antwort ihr nicht gefiel.
»Als letzte?«, fragte sie mit einem Anflug von Empörung in der Stimme.
»Ich bin Hauptleiter. Ich kann nicht einfach einsteigen, solange hier noch Gruppen warten.«
»Wie lange dauert es, bis er zurückkommt? Was, wenn es dunkel wird und hier Blutsauger auftauchen?«
»Das wird nicht passieren«, antwortete er.
Eve sah ihn finster an. »Wie kannst du dir da so sicher sein?«
Noahs Antwort war ein Lächeln. Eves Blick verfinsterte sich noch ein wenig mehr.
Ich legte meine Hand auf ihre Schulter. »Wenn er das sagt, wird das schon stimmen. Ich denke, er macht das hier schon etwas länger.«
Sie drehte sich zu mir um. »Es gibt immer ein erstes Mal. Kein Wunder, dass sie dir den Arm abgerissen haben, so leichtsinnig wie du bist.«
Ich hob zur Antwort meine in Leder gepackte Rechte. »Wenn man es genau nimmt, war es nur die Hand und ein Stück meines Unterarms.«
»Wie auch immer.«
Etwa dreißig Minuten später hörten wir abermals den Helikopter näher kommen. Nachdem er gelandet war und sich die Tür geöffnet hatte, blieben wir an Ort und Stelle sitzen und sahen gemeinsam mit Noah zu, wie die nächsten zwei Gruppen einstiegen.
Das Ganze wiederholte sich anschließend noch zwei weitere Male. Als der Helikopter ein fünftes Mal auf der Wiese landete, war der Himmel bereits in das Orangerot der Abendsonne gehüllt und unter den Wartenden machte sich eine spürbare Unruhe breit.
Ein älterer Mann stieß schließlich einen Jüngeren weg, als dieser im Begriff war in den Helikopter zu steigen. Der Junge wusste gar nicht, wie er sich zu verhalten hatte und machte ein paar Schritte zurück.
Noah stand auf und ging dazwischen. »Was wird das, wenn’s fertig ist?«, fragte er an den Älteren gerichtet.
»Es wird dunkel, es ist kalt und ich warte hier schon viel zu lange! Die Älteren sollten Vortritt haben!«
»Da hinten sitzt eine junge Frau mit einem Säugling. Meinen Sie, sie hätte sich einmal darüber beschwert, dass sie hier warten muss?«
Der Mann erwiderte nichts.
»Nein«, beantwortete Noah seine eigene Frage. »Weil sie schon viel länger auf diese Chance gewartet hat als ein paar Stunden. Und weil sie weiß, dass wir sie keiner Gefahr aussetzen, wenn wir sie hier warten lassen. Und jetzt lassen Sie die Gruppe fertig einsteigen, sonst werden Sie noch viel länger warten müssen und die junge Frau und ihr Baby ebenso.«
Der Alte senkte betroffen den Blick und kehrte zu seiner Gruppe zurück. Der junge Mann mit seiner Gruppe konnte weiter einsteigen.
Noah gesellte sich wieder zu uns. »Siehst du jetzt, warum ich nicht einfach gehen kann?«, sagte er an Eve gewand.
Sie nickte. »Ja, schon gut.«
»Diese Menschen sind verzweifelt und ich kann verstehen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Aber ohne gute Führung verhalten sie sich manchmal nicht besser als das Vieh, das sie in den Augen der Vampire sind.«
Er strahlte Autorität und Weisheit aus, angesichts seines Alters recht bemerkenswert. Eve wirkte neben ihm wie ein trotziges Kind.
Schließlich, die Sonne war bereits untergegangen, waren wir an der Reihe. Noah stand am Fuß des Einstiegs und nickte jedem aufmunternd zu, ehe er oder sie im Inneren des Helikopters verschwanden. Ich war als letzter an der Reihe. Der Innenraum war dezent beleuchtet und erinnerte mich stark an die Hovercars in Vampirya. Nur, dass hier alles in Schwarz, statt in Weiß gehüllt war, und wir uns auf dunkelroten Sitzbänken gegenüber saßen. Hatten die schwebenden Fahrzeuge noch abgedunkelte Scheiben gehabt, konnte man hier gar nicht nach draußen sehen.
Ich setzte mich in Flugrichtung an den äußersten Platz. Der Helikopter hatte, im Gegensatz zu den Hovercars, eine Art Pilotenkabine. Noah setzte sich mir gegenüber auf den letzten Platz.
Niemand sagte etwas, als wir abhoben. Alle lauschten dem Dröhnen der Motoren, das hier drin deutlich leiser war als draußen auf der Wiese.
Das Baby in Lucys Armen schlief seelenruhig. Der Kleine erinnerte mich an meine Schwester. Als Cally geboren worden war, war ich siebzehn und der Verlust unseres Vaters noch sehr frisch gewesen. Unsere Mutter fiel in ein tiefes Loch, also half ich ihr, so gut ich konnte. Immer dann, wenn Cally einfach nicht aufhören wollte zu schreien, wenn weder Füttern, noch Wickeln, noch behutsames Auf- und Ablaufen und Wiegen Wirkung zeigten, legte ich sie in das Auto und fuhr mit ihr herum. Es war mir egal, dass ich die Benzinkanister verbrauchte, die unser Vater so mühsam gesammelt hatte. Ich war einfach froh, dass die Motorengeräusche und das Rütteln sie beruhigten. Ich ertrug es nicht, meine kleine Schwester weinen zu hören.
Bei der Erinnerung an das kleine Baby auf meinem Beifahrersitz stahl sich ein Lächeln auf mein bis dato angespanntes Gesicht. Dann wanderte mein Blick langsam hinüber zur Pilotenkabine. Sie war nicht beleuchtet, die beiden Piloten, ein Mann und eine Frau, lagen im Dunkeln und das Gitter erschwerte mir die Sicht. Doch etwas machte mich stutzig, nun da ich sie näher betrachtete. Ich musste gar nicht viel von ihnen sehen, um zu erkennen, was. Es waren ihre fließenden, unnatürlichen Bewegungen, die sie verrieten. Jene Art sich zu bewegen, die sie alle kennzeichnete. Sie, die uns jagten. Sie, die uns benutzten.
Die Piloten waren Vampire.
»Aidan?«
Noah hatte bemerkt, dass sich in meinen Augen etwas verändert hatte. Ich musterte ihn ungläubig. War alles nur gelogen? Arbeitete er wirklich für sie? Hatte er diesen ganzen Aufwand betrieben, um uns auszuliefern? Waren wir alle nur Opfer in einem neuen perversen Plan ihrer Regierung?
Mir kamen Bens Worte in den Sinn. Die Ewigkeit kann verdammt langweilig sein. Wer weiß, was in den Köpfen der Blutsauger vorgeht.
»Aidan?«, fragte Noah noch einmal.
Ruckartig stand ich auf, riss die Seitentür auf und zog ihn von seinem Sitz. Mit aller Kraft presste ich ihn auf den Boden, sein Kopf hing über der Schwelle, sein roter Zopf und sein grüner Schal wehten im Luftzug der dröhnenden Propeller. Unter ihm lagen mehrere hundert Meter Nichts.
Hinter mir hörte ich das aufgeregte Rufen der anderen Passagiere. Doch ich drehte mich nicht um. Als mein Griff an seinem Kragen fester wurde, umklammerte er mit beiden Händen meine Handgelenke.
»Aidan, hör auf!«, rief er verzweifelt.
»Denkst du ernsthaft, ich erkenne Vampire nicht, selbst wenn sie mir den Rücken zudrehen?!«, brüllte ich.
»Es ist nicht so, wie du denkst«, presste er hervor.
Mit zusammengebissenen Zähnen zischte ich: »Ich weiß, ich kann nicht verhindern, dass sie uns fortbringen, aber allein um des kleinen Jimmy willens hoffe ich, dass du möglichst hart unten aufschlägst und deine verlogene Visage in tausend Stücke zerschellt! Bastard!«
»Scott? Was ist hier los?«
Ich drehte meinen Kopf leicht zur Seite. Die Co-Pilotin stand hinter mir und starrte mich an. Sie war fast so groß wie ich, dunkelhäutig und, ihren nackten Armen nach zu urteilen, gut trainiert. Krause Locken standen wild von ihrem Kopf ab und ließen ihn doppelt so groß wirken. Ihrer Haltung nach war sie drauf und dran mich anzuspringen.
»Schon gut, Vi«, rief Noah.
Überrascht sah ich zwischen den beiden hin und her.
Sie schien ebenfalls ziemlich verwundert, ließ jedoch die Schultern etwas sinken. Offensichtlich vertraute sie ihm.
»Aidan!« Noch immer fest in meinem Griff, schrie Noah mir seine Worte entgegen, in dem Versuch gegen die Motoren anzukommen. »Das hier ist ein vampyrianischer Helikopter. Wir benutzen ihn, um unbemerkt Personentransporte durchzuführen. Sie kontrollieren ihre eigenen Maschinen in der Regel nicht. Aber wenn sie es tun, meinst du nicht zwei vampirische Piloten mit sechs Menschen im Frachtraum erwecken weniger Misstrauen, als es zwei menschliche täten?«
Mein Griff wurde etwas schwächer. Was er da sagte, ergab nur Sinn, wenn er mit den Vampiren zusammenarbeitete.
»Ich kann verstehen, dass du ihnen gegenüber feindlich gesinnt bist, nach allem was sie dir und deiner Familie angetan haben. Aber nicht alle von ihnen sind schlecht. Mein Vater ist selbst einer von ihnen. Und neben ihm, Vi und Maik sind da draußen noch viel mehr Vampire, die ein gutes Herz haben.«
Seine Worte hörten sich an, als kämen sie aus meinem Mund. Vor zwei Jahren hatte ich etwas ganz Ähnliches gesagt, kurz nachdem ich sie kennengelernt hatte. Sie, die ich eigentlich hätte hassen sollen. Sie, die ich letztlich zu lieben gelernt hatte.
Ich ließ Noah los und ließ mich mit gesenktem Kopf auf meinen Platz fallen. Er stand auf, rückte sein Shirt zurecht und schloss dann die Tür. Vi ging zurück in die Pilotenkabine.
»Und mal ehrlich, Aidan, würden Vampire, die euch verschleppen wollen, euch nicht ordentlich festketten?«, sagte Noah schließlich, während er sich seinen Schal wieder ordentlich um den Hals wickelte.
Meine Mundwinkel hoben sich leicht.
»Wir sind da«, kam es da von der Vampirin.

Eden
Wir landeten auf einer Anhöhe. Draußen begrüßte uns eine brünette junge Frau in schlichten Jeans und T-Shirt. Ihrer Augenfarbe und ihrem Hautton nach zu urteilen, war sie ein Mensch. »Herzlich willkommen, bitte folgt mir, ich bringe euch zu euren vorläufigen Schlafplätzen. Nach einem guten Frühstück und einer Routineuntersuchung werdet ihr morgen eure eigenen Wohnräume beziehen können.«
Ich verließ als Letzter den Helikopter. Lucy sah noch einmal zu mir zurück, ehe sie den anderen folgte. Der Pfad auf dem sie gingen, schien ins Tal zu führen. Links von ihnen war eine Felswand, rechts ein Geländer, hinter dem es mehrere dutzend Meter steil bergab ging.
Ich überlegte kurz, ihnen zu folgen, entschied mich dann aber doch dagegen. Stattdessen lief ich einfach geradeaus, quer über die Landeplattform. Am anderen Ende stellte ich mich an den Zaun, der mir bis knapp über den Bauchnabel reichte.
Von hier aus hatte ich den vermutlich atemberaubendsten Ausblick meines ganzen Lebens: Ein Tal, geschützt von riesigen Bergen und steilen Felsmassiven lag vor mir. Darin funkelte ein Lichtermeer, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Hunderte kleine Häuser mit beleuchteten Fenstern. Zwischen ihnen schlängelte sich ein kleiner Fluss, der auf der rechten Seite in einen See mündete. Dahinter machte das Tal eine Kurve, so dass ich den Rest davon nicht mehr sehen konnte.
»Willkommen in Eden«, hörte ich Noah hinter mir und drehte mich zu ihm um. Er kam auf mich zu, stellte sich neben mich und verschränkte die Arme über dem Geländer.
»Eden?«, fragte ich.
»Das ist der Name, den mein Vater diesem Ort gegeben hat, ja.«
»Scheint, als hätte er ein Faible für die Bibel.«
Noah lachte leicht. »Möglicherweise.«
»Das Paradies also, hm?«
»Ein Ort, an dem Menschen und Vampire friedlich koexistieren.«
»Hört sich gut an.«
»Ist es auch«, versicherte er mir.
Einen Moment lang sagte keiner von uns etwas. Wir standen einfach da und sahen auf das Lichtermeer.
Dann ergriff ich wieder das Wort. »Ähm ... Das, das mit dem«, ich gestikulierte mit den Händen und deutete auf meinen Hals, »tut mir leid.«
»Schon okay«, sagte er. »Wollen wir dann los?«
»Klar«, sagte ich.
Gemeinsam gingen wir den schmalen Weg, der von der Anhöhe hinab ins Tal führte. Noah schien zu merken, dass mir eine Frage auf der Zunge lag. »Was?«, fragte er nach einer Weile der Stille.
»Wenn dein Vater ein Vampir ist, macht dich das dann zu einem Halbvampir?«
Wieder ein leichtes Lachen, dann schüttelte er den Kopf. »Nein, ich bin zu hundert Prozent menschlich. Als ich gezeugt wurde, war mein Vater noch ein Mensch. Er und meine Schwester befanden sich bereits mitten im Verwandlunsprozess, da wurde bei der letzten Voruntersuchung meiner Mutter die Schwangerschaft festgestellt. Sie gaben ihr die Wahl: das Baby auszutragen und sich später verwandeln zu lassen oder es sofort zu tun und es verlieren. Sie entschied sich für mich. Doch als ich dann da war, wollte sie sich nicht mehr verwandeln lassen. Jetzt ist sie ein Mensch und der Rest meiner Familie nicht.«
»Verstehe«, sagte ich.
Erstaunt blieb ich ein paar Sekunden später stehen. Vor mir erhob sich ein leuchtender Baum. Der Stamm, die Äste, jedes einzelne Blatt leuchteten. Ich sah keine Lampe daran, er schien einfach von sich aus zu leuchten.
»Was ist das?«
»Das nennt sich Biolumineszenz. Wir nutzen die Pflanzen als natürliche Beleuchtung, um unsere Ressourcen zu schonen.«
»Und das macht der Pflanze nichts aus?«
»Ihnen geht es hervorragend. Es sind natürliche Stoffe, ähnlich denen, die Glühwürmchen produzieren.«
»Unglaublich.« Meine Worte waren kaum mehr als ein Hauch.
Nachdem sich meine erste Faszination gelegt hatte, gingen wir weiter. Nach und nach sah ich immer mehr leuchtende Bäume und mir wurde klar, dass ein Teil der Lichter, die ich von oben gesehen hatte, wahrscheinlich gar nicht von Häusern gekommen war.
Schließlich erreichten wir ein etwas größeres Gebäude.
»Das ist das Auffangzentrum. Hier verbringen alle Neuankömmlinge ihre erste Nacht. Ich hole dich morgen nach deinem Frühstück wieder ab. In Ordnung?«
»Alles klar«, antwortete ich.
Noah schenkte mir noch ein Lächeln und ging, die Hände in die Hosentaschen gesteckt, in die entgegengesetzte Richtung davon.
»Noah!«, rief ich ihm hinterher.
Er drehte sich noch einmal um.
»Ich würde gern mal mit deinem Vater sprechen.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783752104028
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (Juli)
- Schlagworte
- Lovestory Zukunft Twilight Liebe Vampire Liebesgeschichte Romance Fantasy Liebesroman