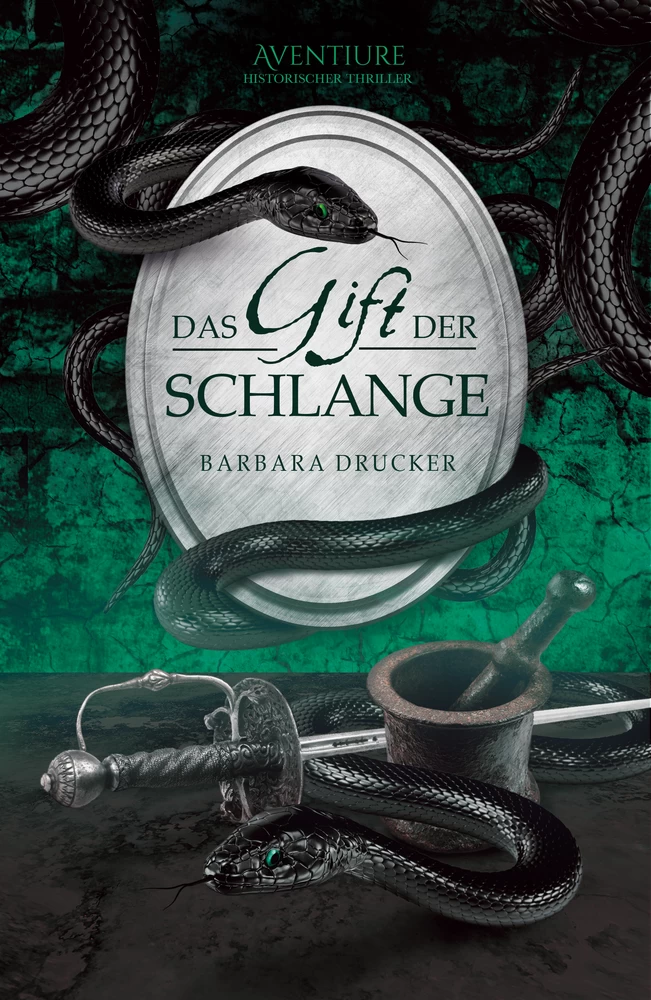Das Gift der Schlange
Historischer Thriller
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Bologna, 1770
»Fünf Männer, findest du das nicht übertrieben?« Stefano wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und kratzte sich unter der Perücke. Selbst noch drei Stunden nach Sonnenuntergang verkochte die Hitze den Unrat der Stadt zu einer stinkenden Suppe, die in jede Ritze und unter jeden Pflasterstein kroch und die Luft verpestete.
»Nicht, wenn er so gut ist, wie Lorenzo behauptet.«
»Lorenzo gerät leicht ins Schwärmen.«
»Und warum fürchten die anderen Studenten dann, die Klinge mit ihm zu kreuzen?«, verteidigte sich Lorenzo hitzig.
»Was heißt das schon, den Degen besser zu führen als diese Bücherwürmer!«
»Haltet den Mund, alle drei! Ich höre etwas.«
Angestrengt lauschten sie in die brütende Windstille.
»Du musst dich getäuscht haben.«
»Da! Schon wieder!«
»Jetzt höre ich es auch. Eindeutig Hufschläge.«
»Ziemlich schnell unterwegs im Dunkeln!«
»Und für diese verwinkelten Gassen!«
»Ich sagte doch, dass er ein Draufgänger ist!«
»Spannt das Seil fester!«
Das Stakkato auf dem Pflaster kam viel zu rasch näher. Stefano drückte sich tiefer in den Hauseingang und zog den Degen, eine Ratte quiekte unter seinem Schuh auf. »Mistvieh!«, verpasste er ihr einen Tritt und spuckte ihr nach. Die Kameraden machten Zeichen, und er fasste den Degen enger. Jetzt waren die Hufschläge unmittelbar hinter der Ecke, ein Huf rutschte in der Kurve leicht weg, und da tauchte ihr Opfer auf. Groß und schlank, Borten glitzerten im Mondlicht, der Federbesatz am Dreispitz wippte. Zehn Pferdelängen noch, acht, fünf …
Krachend schlug das Pferd auf dem Pflaster auf, Zaumzeug klirrte, und noch im Abrollen riss der Mann den Degen aus der Scheide. Schlug Stefanos Klinge zur Seite, aber Stefano parierte den Gegenstoß. Der Mann wich zurück und prallte gegen Luigi, rammte ihm den Ellbogen in den Bauch, und Stefano drang erneut auf ihn ein. »Merda!« Das Eisen durchbohrte seine Schulter, und schon zog der Kerl die Klinge heraus, bereit zum Todesstoß. Im letzten Moment hielt Stefano die Schale dagegen, der zweite Stoß glitt an ihr ab, und er sprang zurück, außer Reichweite. Da war zum Glück Manfredo, verpasste dem Kerl einen Schlag in den Rücken, und jetzt stürzten sie sich alle auf ihn. Umklammerten seinen Arm, entwanden ihm den Degen, er benützte die Fäuste. Riss sich los, doch sie packten ihn erneut, drehten ihm die Arme auf den Rücken und schlangen ihm die Riemen um die Handgelenke. Nun das Tuch zwischen seine Lippen, er versuchte, es mit der Zunge aus dem Mund zu stoßen, aber sie zogen es fest an. Banden ihm ein zweites Tuch über die Augen und verknoteten es hinter dem Kopf. Von beiden Seiten griffen sie sich ihn und zerrten ihn fort zum Wagen.
»Hinein da!«
Er sah nichts, aber er roch den Dunst von Pferden, hörte, wie ein Wagenschlag geöffnet wurde und stemmte sich dagegen. Rutschte mit den Schnallenschuhen auf dem glatten Pflaster weg, sie packten ihn am Kragen, von oben wurde er gezogen und von hinten geschoben, er fand kaum die Trittsprossen. Mit einem Ruck fuhr die Kutsche an, und er wurde in die gepolsterte Lehne gedrückt. Keuchte vor Anstrengung, bekam durch den Knebel nur schwer Luft, und nur allmählich beruhigte sich sein Atem.
Was wollten die Strolche von ihm? Lösegeld erpressen, was sonst! Ein betrogener Ehemann hätte sich nämlich nicht die Mühe gemacht, ihn mitzuschleppen, sondern ihm gleich vor Ort eine Abreibung verpassen lassen. Und wo zum Teufel brachten sie ihn hin? Durch die Fenster kam die Nachtluft herein, nicht mehr die dumpfe Brühe der Stadt, sondern der Geruch frisch gemähter Wiesen. Irgendwo aufs Land wahrscheinlich, in eine Scheune oder einen Heuschober. Oder in den Wald!
Sie fuhren schnell, bis man seine Entführung bemerkt hatte, waren sie längst über alle Berge! Und je länger die Fahrt dauerte, desto quälender wurden seine Gedanken. Sein Vater würde zahlen, aber ließen sie ihn dann auch laufen? Wenn er sich darauf verließ, konnte er gleich sein Testament machen! Hektisch nestelte er an den Riemen, aber die Knoten saßen fest.
Es klang und roch immer gleich, sie fuhren über eine holprige Straße zwischen Wiesen, weg von Bologna, weg von der Universität, weg von ... Auf einmal wurde der Klang zurückgeworfen, die Kutsche fuhr nicht mehr über die schlechte Straße, sondern schaukelte nur mehr leicht. Kies knirschte.
»Aussteigen!«
Das waren Fackeln, der Geruch von Pech war unverkennbar, und er spürte die Hitze, als man ihm das Licht vor das Gesicht hielt. Sie fassten ihn an den Armen und zerrten ihn mit, quer über einen Platz oder Hof, eine Tür quietschte in den Angeln, sie marschierten durch einen kühlen Gang, noch eine Tür, der Raum dahinter klang hoch und weit, ihre Schritte hallten. Sie ließen seine Arme los, gaben ihm einen Stoß zwischen die Schulterblätter, und er stolperte ein Stück vorwärts.
Sie waren da, er konnte sie spüren, auch wenn es jetzt vollkommen still war. Viele Menschen, nicht nur seine Entführer, er fühlte ihre Blicke. Angestarrt ohne sehen zu können! Er drückte den Rücken durch und setzte seine arroganteste Miene auf. Es wurde zur Nervenprobe. Er war blind, aber dafür arbeiteten seine anderen Sinne umso präziser, und so lautlos war es gar nicht. Er konnte das Atmen der Leute unterscheiden, das Rascheln von Stoff, wenn sie ihr Gewicht verlagerten. Und er konnte sie riechen. Nur Männer. Von vorne kam Wärme, Holz knisterte, wohl Feuerkörbe.
»Ihr habt tapfer gekämpft.«
Unwillkürlich zuckte er beim unvermittelten Klang der Stimme zusammen.
»Und Ihr dürft stolz sein. Noch keinem Novizen ist es gelungen, einen von uns zu verwunden.«
Novize?
Schritte kamen auf ihn zu, schwere, gemessene von vorne und kraftvolle von der Seite. Jemand nestelte am Knoten seiner Augenbinde, er blinzelte. Der Mann, der ihn vom Tuch befreite, blutete an der Schulter, aber hatte es wohl für unter seiner Würde gehalten, die Wunde zu verbinden. Jetzt zog er ein Messer, durchtrennte die Handfessel und löste ihm auch den Knebel, dann reihte er sich unter die anderen Männer ein. Alle hielten sie Fackeln in der Hand, alle waren sie identisch gekleidet mit schwarzen Kniehosen, schwarzen Röcken und schwarzen Strümpfen. Keine Schnallen an den Schuhen. Bürgerliche. Oder doch nicht, denn alle trugen sie Degen.
»Eure Verwirrung ist zu verstehen, und es spricht für Euch, dass Ihr keine Furcht zeigt. Es bestätigt, dass unsere Wahl richtig war.«
Was heißt, keine Furcht zeigen? Nur sein Stolz hielt ihn aufrecht! Er bemühte sich, dem Mann fest in die Augen zu sehen, aber das war ein Fehler, denn sofort bekam der Blick des Unbekannten etwas Zwingendes, krallte sich an ihm fest, versuchte, ihn zu beugen. Furcht hin oder her, brechen würde ihn niemand! Jetzt war es Ehrensache, diesen Blick auszuhalten! Nach einer Weile ließ ihn der Fremde vom Haken und nickte wohlwollend.
»Wir brauchen Männer mit Rückgrat.«
»Wer seid Ihr?«
»Ah, Geduld zählt wohl nicht zu Euren Stärken, das wurde mir bereits zugetragen.«
»Ihr könnt mir die Frage wohl nicht verdenken.«
»Ungeduldig, trotzig und stolz. Aber Ihr seid auch noch jung. Fünfundzwanzig?«
»Ihr seid mir gegenüber im Vorteil, denn Ihr scheint mich zu kennen, während ich keine Ahnung habe, wer oder was Ihr seid.«
»Wir sind die Chance Eures Lebens.«
»Aber gewiss doch!«
»Ihr könnt natürlich auch so weitermachen wie bisher«, spottete der Mann vor ihm. Er hatte Krähenfüße an den Augenwinkeln, eine wettergegerbte Haut und ein energisches Kinn. »Das Wild in Euren Wäldern jagen, und wenn Euch nach Nervenkitzel zumute ist, setzt Ihr hohe Summen am Spieltisch. Auch im Landadel finden sich recht passable Frauen, vielleicht sind sie sogar ein Duell wert, und Ihr könnt gelegentlich Eure Klinge mit einem Rivalen kreuzen. Zum Glück habt Ihr die Rechte studiert, denn einst werdet Ihr mit dem Titel auch die Verantwortung erben und über Eure Bauern Recht sprechen. Ihre kleinlichen Streitereien werden Euer gesamtes Geschick verlangen.«
»Was versteht Ihr schon vom Leben eines Landesherrn!«
»Ihr habt Recht, ich vergaß die Gespräche mit Eurem Verwalter. Rousseau und Montesquieu, Hume und Smith werden dabei bestimmt eine tragende Rolle spielen«, bohrte er in der Wunde. »Eure Beschäftigung mit Philosophie ist Euch dabei von unschätzbarem Wert. – Ihr wisst doch selbst, dass Euch ein beschauliches Leben fernab der gebildeten Zirkel und Städte nicht reicht, dass Ihr an die großen Höfe gehört! Verschwendet nicht Eure Talente!«
»Und was sollte ich Eurer Meinung nach an diesen Höfen tun?« Der Mann hatte gut reden! »Hofdamen verführen, jahrelang intrigieren, damit ich – vielleicht – einmal der Handlanger eines Ministers werde?«
»Warum so bescheiden? Ihr könntet Fürsten beeinflussen. Könige!«
»Ich schätze es nicht, wenn man sich über mich lustig macht.«
»Wer sagt Euch, dass ich das tue? Wir haben Euch beobachtet, Ihr habt die Gabe, Menschen zu verführen und zu lenken. Noch handelt Ihr nach Euren Launen, aber unter unserer Anleitung könnt Ihr zu einem Meister der Manipulation werden. Wir lehren Euch die Seelenkunde, die raffiniertesten Hofmänner werden wie Anfänger neben Euch stehen, während Ihr die Fäden zieht. Keiner kann sich Eurem Einfluss entziehen, Kardinäle, Minister, Herrscher hören auf Euch! Und Ihr werdet in Versailles ebenso willkommen sein wie in Wien oder Berlin!«
Er wusste, dass seine Augen leuchteten, dennoch blieb er auf der Hut. »Ihr spracht von Furchtlosigkeit und Kampf, Ihr erwartet mehr von mir als Intrige.«
Der Ältere nickte anerkennend. »Ich weiß, dass Euch diese Macht lockt, und doch verliert Ihr nicht sofort den Kopf, wenn ich sie Euch anbiete. Das gefällt mir, es ist wichtig, um Eure Aufgabe erfüllen zu können. Ihr sollt unserer Bruderschaft dienen, sie gegen Bedrohung von außen schützen und ihren Einfluss vermehren. Durch Intrige, Waffengewalt und Spionage.«
»Was bringt Euch auf den Gedanken, dass ausgerechnet ich mich dazu eigne?«
»Dass Ihr ein Draufgänger seid, aber Euren Verstand nicht ausschaltet. Dass Ihr als Aristokrat Zugang zu den höchsten Kreisen habt und keiner unter Eurer kultivierten Maske einen gefährlichen Kämpfer vermutet. Ihr fechtet schon jetzt hervorragend, wundert Ihr Euch nicht, dass unsere Männer Euch dennoch überwältigen konnten? Das muss nicht so bleiben. Ihr erhaltet die besten Lehrer, Fechtmeister, von denen Ihr nicht einmal zu träumen wagt, werdet in allen Waffen unterwiesen, lernt, mit der bloßen Hand zu töten. Die Kunst der Verkleidung und Täuschung, das Abfassen und Entschlüsseln geheimer Botschaften, das Lesen der winzigsten Spur, all das werdet Ihr beherrschen. Euer Verstand wird sich nicht in spitzfindigem Wortwitz erschöpfen, ihr werdet Pläne schmieden, taktieren. Wir bilden Euch zu einem perfekten Spion aus.«
»Und der Preis?«
»Verschwiegenheit, Treue gegenüber der Gemeinschaft und absoluter Gehorsam.«
»Vergesst es!«
»Ihr urteilt voreilig.«
»Ich lasse mich nicht zum Werkzeug degradieren.«
»Dann steht es Euch frei, zu gehen.«
Ja sicher, nachdem er die Gesichter der anderen gesehen hatte! Die würden ihn doch niemals am Leben lassen, auch ohne Seelenkunde verstand er den Blick des Alten zu deuten! »Was meint Ihr mit absolutem Gehorsam?«
»Ihr werdet Eure Aufträge nicht hinterfragen, sondern gewissenhaft ausführen.«
»Und wer bestimmt über diese Aufträge?«
»Die Hierarchie in unserem Bund richtet sich nach Fähigkeiten und Leistung. Heute seid Ihr Novize, doch Ihr könntet es bis zum Meister bringen.«
»Und wie lange wird das dauern?«
»Ewig, wenn Ihr Eure Ungeduld nicht zähmt!«, zürnte der Alte.
»Was ist das für ein Bund?«
»Das erfahrt Ihr zur gegebenen Zeit.«
»Wie kann ich eine Wahl treffen, wenn ich nicht einmal weiß, für wen ich spionieren soll!«
»Wir bieten Euch viel, und wir bieten es nicht jedem. Und vor allem bieten wir es Euch nur ein einziges Mal. Jeder von uns traf diese Entscheidung blind, Vertrauen ist die erste Prüfung. Entscheidet Euch, wollt Ihr einer von uns sein?«
Entscheiden? Da gab es nichts zu entscheiden! Entweder er spielte mit, oder man würde seine Leiche finden. Wenn überhaupt. Doch lange sollten sie nicht über ihn bestimmen, er würde Karriere in diesem seltsamen Klub machen, schneller, als die es sich träumen ließen! Meister? Großmeister würde er werden, es bis an die Spitze schaffen. Und dann diktierte er die Regeln!
»Ich verlasse mich darauf, dass Ihr Wort haltet!«
»Das dürft Ihr. Lasst uns mit dem Ritual beginnen!«
1
Ein deutsches Duodezfürstentum, 1785
Kerzen erleuchteten den Salon, und das Geschwätz der Gäste füllte bereits den Raum, als Sondheim ihn betrat. Schöngeistige Debatten, als ob die ihn interessierten! Zeitvertreib für Weiber und Schwächlinge. Er war nur aus einem einzigen Grund hier, und dieser Grund war Woche für Woche derselbe: Solange Rüdiger von Ressau Frau von Meyn seine Ehre erwies, war Sondheim gezwungen, das Gleiche zu tun. Schon deshalb, weil hier die Schranken zwischen Hof und gebildetem Bürgertum fielen, und der Salon der Meyn einer der wenigen Orte war, wo sich informelle Gespräche zwischen den Ständen führen ließen. Und auch, wenn er das Bürgertum hasste, hasste er es nicht tief genug, um Ressau das Feld kampflos zu überlassen.
»Herzog!« Schon hatte die Meyn ihn erspäht und rauschte auf ihn zu. Sie gefiel sich als Mäzenin, und beim Gedanken, welche ihrer Entdeckungen er nun wieder feiern sollte, hätte er ihr am liebsten den Hals umgedreht. Während er ihre Floskeln über sich ergehen ließ, musterte er ungeniert die Anwesenden. Als Erster stach ihm Ressau ins Auge, groß und hager wie er war, vor allem aber, weil man die rote Soutane unmöglich übersehen konnte. Kardinal und Machtmensch, sein Einfluss wuchs unaufhaltsam! Ressau lachte sein tiefes, gutturales Lachen und klopfte seinem Nachbarn überschwänglich auf die Schulter. Wie immer war er umgeben von seiner Clique, von reichen Bürgern, Ministern und natürlich von schönen Frauen. Und nichts, was der Kardinal tat, geschah aus Zufall, welche Intrige brütete er eben wieder aus?
Oberst von Meyn verstellte ihm den Blick auf den Kardinal, dämlich kichernd tänzelte er um die Staa herum, fächelte ihr Luft zu und ergoss sich in allerlei Albernheiten. Seine Frau schien es nicht zu bemerken, andererseits wusste jeder, dass der Oberst auch nicht nach ihren Künstlern fragte. Sollte er das Fräulein ruhig haben, nur schade, dass Sondheim sein Gesicht nicht sehen konnte, nach der Liebesnacht. Schon längst hatte er selber die Staa besessen, und sie lohnte die Mühe keineswegs, die Meyn in sie investierte. Apropos Liebesnacht, die junge Korff wurde allmählich fällig. Dort drüben, inmitten des hellen Gelächters, scherzte sie mit ihren Freundinnen, ebensolchen unbedarften Gänsen wie sie. Wie ihre Locken jedes Mal flogen, wenn sie beim Lachen den Kopf in den Nacken warf! Das würde er ihr noch austreiben, wenn er mit ihr fertig war, gab es keine unschuldigen Gesten mehr.
Probleme beim anderen Geschlecht kannte er nicht. Seine Züge waren zwar hart, und sein athletischer Körperbau unterstrich diese Härte noch, aber mit vollem blonden Haar und eisblauen Augen war er nicht unattraktiv. Er strahlte Tatkraft und Intelligenz aus, und um seinen Mund lag stets ein Ausdruck von Entschlossenheit. Es war seine Macht, die ihm Frauen verfügbar machte. Manche suchten die Gefahr, andere sehnten sich nach Stärke und Willenskraft, am liebsten waren ihm jedoch die, die einfach nur die Folgen ihrer Weigerung fürchteten.
»Wird der Tod des Prinzen Auswirkungen auf unsere Außenpolitik haben?«
Verdammt! Er hasste es, hinterrücks angesprochen zu werden! »Molden, müsst Ihr Euch immer so anschleichen?!«, funkelte er den Kaufmann an.
»Verzeiht, Herzog!«, entschuldigte das Fuchsgesicht sich der Form halber, aber der Tadel berührte es sichtlich nicht. Ganz im Gegenteil, der Kaufmann beharrte auf seiner Frage: »Prinz Leopold ist bereits seit zwei Wochen tot. Haben die Wittelsbacher schon etwas unternommen?«
Leopolds Tod. Nicht einmal Sondheim hätte gedacht, dass die Gesundheit des Prinzen ernsthaft bedroht war. Noch am Morgen war Leopold mit seiner Mätresse über die Fluren gesprengt, hatte die Mittagstafel ausgesprochen munter verlassen und nach dem Tee plötzlich über Fieber und Gliederschmerzen geklagt. Und dann war es sehr schnell gegangen, nicht einmal mit einem Priester hatte er mehr sprechen können, und bald munkelte man hinter vorgehaltener Hand von Gift. Das war wiederum ein gefundenes Fressen für die Dienerschaft, die gab die Sensation an die Hoflieferanten weiter, über die die Nachricht an die Marktplätze gelangte und von dort in die Küchen der Bürger. Auf diese Weise hatte natürlich auch Molden von dem Gerücht erfahren. Dem Kaufmann war der Prinz völlig gleichgültig, für ihn war nur erheblich, ob die Wittelsbacher militärische Maßnahmen ergriffen. Das Chaos, das der Siebenjährige Krieg ausgelöst hatte, war den meisten noch in guter Erinnerung. Ein Chaos, von dem ein gewiefter Händler durchaus profitieren konnte.
Moldens Geschäfte gingen Sondheim nichts an. Sein Interesse galt der Macht, und da die zu einem wesentlichen Teil auf Geheimpolitik beruhte, dachte er gar nicht daran, sein Wissen zu teilen. Leopolds Tod bedeutete keine Katastrophe, er war nur ärgerlich, denn Sondheims ausgeklügelt geknüpftes Netz hatte dadurch einen Riss bekommen. Der vergnügungssüchtige Prinz war nämlich leicht zufriedenzustellen gewesen, es war so einfach, seinen Wünschen nach Abwechslung dienlich zu sein, überhaupt seit Sondheim ihm seine schöne Mätresse zugeführt hatte. Die Wittelsbacher wussten selbstverständlich, wer ihren Spross bei Laune hielt, und der Lohn waren ausgezeichnete Beziehungen zu diesem wichtigen Geschlecht.
Das alles brauchte Molden jedoch nicht zu wissen. »Was interessieren mich die Wittelsbacher?«, brummte Sondheim.
Der Kaufmann gab nicht auf: »Und was gedenkt der Fürst jetzt zu tun?«
»Die Politik des Fürsten …«, setzte der Herzog gerade zu einer nichtssagenden Tirade an, als plötzlich die anderen Gespräche verstummten. Die Luft knisterte auf einmal, und eine eigentümliche Spannung lag im Raum, die Blicke wanderten allesamt zur Tür. Und Sondheim stand mit dem Rücken zum Eingang – ein Fauxpas, der ihm bisher noch nie passierte!
Über dem Kamin hing ein Spiegel, durch den warf er nun einen Blick, ohne sich zu rühren. Fehlte noch, dass er sich für irgendwen umdrehte! Als Erstes sah er die Augen. Dunkelblaue, unerträglich magnetische Augen, die ihn unmittelbar ansahen. Was zum Teufel …?! Jetzt wandte er sich doch um, bedächtig natürlich und so herablassend er konnte.
Aufgeregt tuschelten die Korff und ihre Freundinnen, und Oberst von Meyn war sofort bei der Staa abgeschrieben. Mit solch einem Gesicht, glänzendem, tiefschwarzem Haar und der schlanken, hochgewachsenen Statur konnte Meyn einfach nicht konkurrieren. Weder die Statur noch diese Augen wollten zur sichtlich südländischen Herkunft des Fremden passen, sehr wohl aber seine viel zu erlesene Kleidung. Der dunkelblaue Frack und die silberfarbene Brokatweste waren nicht nur von perfektem Schnitt, sondern auch aus einem Stoff, der das Jahresgehalt eines Sekretärs überstieg.
Unaufgefordert und mit einem Selbstbewusstsein, das an Frechheit grenzte, trat der Fremde in die Mitte des Raumes. Der feste, sichere Schritt, die aufrechte Haltung und der geschmeidige Gang waren ganz offensichtlich das Ergebnis höfischer Erziehung, ebenso wie die Arroganz, die der Schuft zur Schau stellte. Sondheim musste diesen unverschämten Kerl in seine Schranken weisen, sofort und auf der Stelle! Auch er setzte sich also in Bewegung, bis nur mehr Armeslänge ihn von dem Kerl trennte, und baute sich mit herrischer Miene vor ihm auf. Doch was war …? So ein Hundsfott! Der Fremde hatte seinen Blick keine Sekunde lang losgelassen und verzog die Mundwinkel jetzt zu einem ironischen Lächeln. Das war die Höhe, der hielt ihm nicht nur stand, der hatte doch tatsächlich die Stirn, ihn zu verspotten!
Lauernd beobachte sie der Kardinal, und vor dem durfte sich Sondheim erst recht keine Blöße geben! Er setzte zu einer scharfen Zurechtweisung an, doch da folgte der nächste Affront: Der Fremde ließ ihn einfach stehen! Wandte sich ab und mit einer galanten Verbeugung der Frau von Meyn zu: »Verzeiht mein plötzliches Eindringen, Madame. Doch ich bin erst heute in Eurer Stadt angekommen und hörte, dass dieser Abend bei Euch der Kunst und der Philosophie gewidmet ist. Zwei Gebiete, für die ich die größte Anteilnahme hege.«
Kunst und Philosophie! Schon schmolz die gezierte Gans dahin. Als ob auch nur eine Silbe davon der Wahrheit entsprach!
»Ein Verehrer der Kunst ist mir immer lieb«, reichte sie dem Hundesohn huldvoll die Hand zum Kuss. »Dann seid Ihr mir doppelt willkommen.«
»Riccardo Visconti Marchese della Motta.«
Visconti. Hm. Marchese della Motta. Den Namen musste man sich merken.
»Kennt Ihr den Mann?« Molden war wieder an die Seite des Herzogs getreten, kaum dass der Italiener sich Frau von Meyn angeschlossen hatte.
»Ihr habt doch seinen Namen gehört.«
»Ein Italiener, na schön. Und was macht er hier in Deutschland?«
»Ich habe ebenso wenig Ahnung wie Ihr«, knurrte Sondheim wütend.
»Wenn er aus Italien kommt, dürfte er weit herumgekommen sein.«
»Ich bezweifle, dass er Euch anderes als zuverlässige Auskünfte über den Zustand der Straßen und die Annehmlichkeit der Herbergen geben kann«, versuchte Sondheim die Bedeutung dieses Mistkerls herunterzuspielen. »Er scheint an der Philosophie und an Liebeshändeln weit eher interessiert zu sein als an politischen oder wirtschaftlichen Zusammenhängen.« Abfällig nickte er in Richtung des Sofas, auf dem Frau von Meyn mit zwei anderen Damen Platz genommen hatte. Einige Frauen hatten sich Stühle herbeibringen lassen, im Mittelpunkt der Gruppe stand der aktuelle Günstling der Gastgeberin, ein Maler, in eine Unterhaltung mit dem Marchese verwickelt, die der jedoch unter Einbeziehung der Zuhörerinnen zu führen verstand. Selbst etliche Herren schlossen sich der kunstsinnigen Runde an.
Allmählich glätteten sich die Wogen wieder, und gruppenweise wurden die unterschiedlichsten Gespräche fortgesetzt, als hätte es keine Störung gegeben. Sondheim aber verspürte keine Lust mehr, Moldens Fragen auszuweichen. Überhaupt lohnte es kaum, länger zu bleiben, an diesem Abend hatte er wohl die wichtigste Neuigkeit erfahren, und selbst der Kardinal rüstete bereits zum Aufbruch. Oder sollte Sondheim vielleicht doch ... Er warf einen Blick auf Fräulein von Korff. Nein, der Marchese hatte ihm gründlich die Laune verdorben. Auch das sollte er ihm noch büßen.
In seinem Palais angekommen, würdigte Sondheim niemanden eines Blickes und setzte sich unverzüglich an den Schreibtisch. Wo war dieser Marchese zuletzt gewesen? Sondheim hatte an allen großen Höfen ebenso wie an den kleinen Residenzen seine Spitzel, irgendeiner von ihnen würde ihm die nötigen Informationen über della Motta schon zu verschaffen wissen. Eine Stunde lang schrieb er ohne Unterbrechung, Brief um Brief, faltete, siegelte, bis ein ansehnlicher Stapel vor ihm lag. Nun erst rief er nach Klinger. Je eher die Kuriere sich auf den Weg machten, desto besser, wozu bis zum nächsten Morgen warten? Der Sekretär präsentierte ihm seinerseits ein Billett und zog sich mit der Post zurück.
Das Schreiben wies keinen Hinweis auf den Absender auf. Ein unbekanntes Siegel, das der Herzog eher automatisch als neugierig erbrach. Die Nachricht bestand nur aus zwei Zeilen: ›Hütet Euch vor dem Marchese! Ein Freund.‹
Zornig fuhr er in die Höhe. Trieb denn heute jeder seinen Spott mit ihm? Hielt man ihn für einen Stümper, der nicht in der Lage war, einen Gegner zu erkennen? Aufgebracht riss er die Tür auf und fuhr Klinger an: »Wer hat das abgegeben?«
»Ich weiß nicht, Durchlaucht. Es wurde wohl vom Bedienten am Tor entgegengenommen. Soll ich ihn kommen lassen?«
»Was denkt Ihr wohl? Natürlich sollt Ihr!« Er ging wütend auf und ab. Nahm nochmals die Nachricht zur Hand und prüfte nun das Siegel genauer. »Eine Schlange. Habt Ihr schon einmal dieses Petschaft gesehen?«
Der Sekretär besah es eingehend, reichte dem Herzog kopfschüttelnd das Billett wieder: »Nein, Durchlaucht, ich bedaure. Obwohl ...«
Sondheim half mit einer ungeduldigen Geste nach.
»... obwohl es mir nicht nach einem Adelswappen oder einem Kaufmannssiegel aussieht.«
»Das sehe ich selbst. Was noch, heraus mit der Sprache!«
»Es gibt Gerüchte. – Über die Schlange«, beeilte sich Klinger, dem Wutausbruch zuvorzukommen. »Man redet von einem Geheimbund, dessen Zeichen die Schlange ist.«
»Und was soll das für ein Bund sein? Welche Ziele verfolgt er?«
»Das kann ich Euch leider noch nicht sagen. – Ich habe selber erst heute von ihm gehört«, haspelte er schnell hervor, bevor Sondheim aufbrausen konnte. »Am Marktplatz wurde darüber gesprochen, irgendein Bauer hat ihn im Zusammenhang mit dem Tod des Prinzen erwähnt.«
Sofort läuteten bei Sondheim sämtliche Alarmglocken. »Hat er gesagt, dass dieser Bund hinter Leopolds Tod steckt?«
»Nein. Er sagte: ›Ihr werdet schon sehen, bald kümmern sich die Brüder der Schlange um die Angelegenheit.‹ Aber keiner schien ihn ernst zu nehmen.«
»Ich muss diesen Mann sprechen, schafft ihn mir morgen her! Wo bleibt denn nun wieder der Pförtner?«
Die Befragung des Torpostens brachte auch nicht mehr Licht in die Sache.
»Wer hat Ihm dieses Billett gegeben?«
»Ein Reiter. Ich hab’ ihn nicht gut seh’n können, weil er den Hut tief ins Gesicht gezogen hat.«
Sondheim schnaubte unwillig. »Wie war er gekleidet?«
»Wohlhabend. Hohe Stiefel, dunkle Hose, dunkler Frack und Dreispitz. Guter Stoff, aber das Pferd war schlecht. Ein Fuchs, hat eher nach einem Kutschpferd ausgesehen als nach Reittier.«
»Hat Er sonst noch etwas bemerkt? Die Haarfarbe vielleicht?«
»Ich glaub’, sie waren dunkel, sonst hätten sie sich ja vom Frack abgehoben, oder? Aber an die Statur erinner’ ich mich. Der Herr ist so groß wie ich gewesen, schlank, aber nicht dünn. Und er hat keinen Degen gehabt.«
»Also ein Bürgerlicher.«
»Mit Verlaub, Durchlaucht, vielleicht auch ein Adliger, der für einen Bürgerlichen gehalten werden will.«
»Sprach der Fremde mit Ihm?«
»Kein Wort.«
»Würde Er ihn wieder erkennen?«
»Ich glaub’ nicht, Durchlaucht.«
»Er kann wieder an seinen Posten gehen.«
Sondheim marschierte energisch im Zimmer auf und ab. Erst der Marchese und dann das! Es konnte nicht angehen, dass ein Geheimbund in der Residenz tätig wurde, und er keine Ahnung von dessen Treiben hatte! Dass das Billett mit »Ein Freund« gezeichnet war, mochte genauso gut eine Finte sein, andererseits konnte der Unbekannte nicht wissen, dass er an diesem Abend mit dem Italiener aneinander geraten war. Selbst wenn die Warnung nicht wohlgemeint war, sollte sie zumindest della Motta schaden. Und im Moment war ihm jeder recht, der gegen den Marchese war. Dass der Überbringer des Briefes aufzufinden wäre, bezweifelte er allerdings. »Ich will eine Liste von allen Personen, die in den letzten drei Tagen in der Residenz angekommen sind«, blaffte er trotzdem. Und dann fiel ihm noch etwas ein: Klinger hatte noch vor ihm von diesem Geheimbund gewusst. Möglicherweise ... Er riss das Billett vom Schreibtisch und hielt es dem Sekretär abermals unter die Nase, und diesmal ließ er ihn auch den Text lesen. »Was wisst Ihr über den Marchese?«
»Er gilt als Spion, als einer der besten. Obwohl das natürlich nicht bewiesen ist. Dass er Spion ist, meine ich. So um die Vierzig. Norditaliener angeblich. Aber er hält sich so gut wie nie auf seinen Gütern auf, sondern reist quer durch Europa, taucht an allen Zentren der Macht auf und verschwindet so plötzlich, wie er gekommen ist«, ratterte Klinger herunter. »Er ist äußerst gebildet, spricht mehrere Sprachen fließend, selbstverständlich Französisch, aber auch Englisch, Russisch und Deutsch. Auch alte Sprachen, Latein, Griechisch, und manche munkeln sogar Hebräisch. Meist sucht er gelehrte oder kunstsinnige Gespräche, aber man sagt, dass auch die Fürsten seinem Charme erliegen.«
»Für wen spioniert er?«
»Darüber gehen die Meinungen auseinander, die einen behaupten, dass er im Dienst des französischen Königs steht, die anderen denken an den österreichischen Hof, den Zaren oder die Preußen.«
»Hat er politische Ambitionen?«
»Keine offenkundigen. Es ist schwer zu sagen, mit wem er sympathisiert, er gibt sich weder konservativ, noch republikanisch. Ganz im Gegenteil, er soll den Eindruck erwecken, dass er der Politik gegenüber völlig gleichgültig ist, wenn, dann betrachtet er sie als philosophische Spielwiese.«
»Wie sieht es mit der Religion aus? Als Italiener ist er wohl Katholik?«
»Das muss man annehmen. Wahrscheinlich von Jesuiten erzogen.«
»Das wird den Kardinal freuen. Ist er fromm?«
»Davon weiß ich nichts. Allerdings soll er auch mit Freidenkern in Kontakt stehen, vielleicht ist er sogar Freimaurer.«
»Was haltet Ihr von seiner Anwesenheit hier?«
»Nun, unter normalen Umständen hätte sie wohl keine Bedeutung. Aber jetzt, wo der Prinz tot ist ... Es ist doch ein merkwürdiger Zufall, dass er gerade jetzt hier auftaucht. Und dass Durchlaucht vor ihm gewarnt werden.«
»Ihr sagt es. Lasst feststellen, seit wann er sich in der Residenz befindet. Und sorgt dafür, dass er beobachtet wird! Ich muss vor allem wissen, wie er mit dem Kardinal verkehrt. Ein katholischer Spion dürfte dem doch wie gerufen kommen.«
»Sehr wohl, ich werde das Nötige veranlassen.«
»Und, Klinger, ich will alles über ihn wissen. Mit wem er spricht, was er denkt, was er den ganzen Tag treibt. Fangt seine Korrespondenz ab, schleust einen Spion unter seine Bedienten ein. Ich muss in dem Mann lesen können, wie in einem offenen Buch. Und am allermeisten interessieren mich seine Schwächen.«
»Ich habe verstanden, wenn er Schwächen hat, werden wir sie entdecken.«
»Jeder Mensch hat Schwächen, und am gefährlichsten sind die, die man sich nicht eingesteht. Über diese spezielle Sorte muss ich Bescheid wissen. Ich will diesen Schurken da packen, wo er es am allerwenigsten vermutet.«
»Ich werde mir Mühe geben, aber es könnte eine Weile dauern. Für die Zwischenzeit empfehle ich Euer Gnaden, sich auf die Blöße zu konzentrieren, die der Marchese nicht einmal zu verbergen sucht. Frauen. Er ist galant, aber äußerst wählerisch.«
»Welche Eigenschaften müsste eine Frau haben, die ihn reizen kann?«
»Vor allem müsste sie kultiviert sein. Ich denke nicht, dass er sich mit Bürgermädchen einlässt, zumindest nicht auf Dauer. Schönheit allein interessiert ihn nicht, um ihn zu fesseln braucht es Raffinesse. Er will gleichzeitig gefallen und erobern, eine Frau, die ihn verführt, darf ihn das niemals merken lassen.«
Woher mochte Klinger nur all diese Informationen haben? Für den Moment hatte der Herzog genug erfahren und konnte den Sekretär entlassen.
Es würde etliche Tage dauern, bis die ersten Nachrichten über della Motta eintrafen, aber es widerstrebte Sondheim, dass er dem Gegner gegenüber zum Nichtstun verurteilt sein sollte. Er musste in die Offensive gehen, und dazu brauchte er Verbündete. Doch wer war dem Italiener gewachsen? Der Kardinal sicher, aber der kam nicht in Frage. War es nicht sogar denkbar, dass della Motta gar nicht im Auftrag eines Herrschers, sondern der Kirche hier war? Klinger vermutete eine jesuitische Erziehung, vielleicht war der Marchese ja ein Spion des Papstes. Dann steckte er mit dem Kardinal unter einer Decke, versorgte ihn mit Informationen von außen oder sollte ihm helfen, die Intrige innerhalb der Hofgemeinschaft voranzutreiben.
Der Überbringer der Warnung wäre kein schlechter Kandidat für ein Komplott gegen den Marchese. Er schien eine Rechnung mit ihm offen zu haben und hatte sichtlich selber Anlagen zum Spion. Wenn es dem Herzog doch gelänge, diesen geheimnisvollen Mann zu finden! Dann konnte er Feuer mit Feuer bekämpfen.
Aber Klinger hatte auch von einer offenkundigen Schwäche gesprochen. Sollte Sondheim vielleicht eine Frau auf den Feind ansetzen? Keine gewöhnliche Frau natürlich, sondern eine, die es verstand, die Gedanken eines Mannes ernsthaft zu beschäftigen. Im mindesten Fall wäre della Motta durch sein galantes Abenteuer so in Anspruch genommen, dass er seine Zeit mehr der Dame als der Intrige widmete. Und wenn sie es geschickt anstellte, würde sie ihn so fesseln, dass er sogar in Versuchung geriet, sie zu seiner Vertrauten zu machen. Die Mätresse des verstorbenen Prinzen wäre ein perfekter Köder gewesen, aber leider war nur zu bekannt, dass die Köchlin zu Sondheims Partei zählte.
Sondheim ging in Gedanken alle schönen Frauen durch, schied die einfältigen unter ihnen sofort aus, wog körperliche Attraktivität gegen Bildung und Kultiviertheit ab. Und natürlich musste er die betreffende Person in der Hand haben. Es würde nicht schwer fallen, eine Frau zu finden, die bereit war, mit dem schmucken Italiener anzubinden. Doch wie konnte er verhindern, dass sich sein Köder in den Feind verliebte und zu ihm überlief? Von wem kannte er Geheimnisse, die solch einen Verrat verhinderten, wer war erpressbar?
Bald stand ihm seine Favoritin klar vor Augen, nun, da die Entscheidung gefallen war, war er beinahe vergnügt. Della Motta würde seine Herausforderung noch bereuen, denn er, Albrecht Herzog von Sondheim, war ein Gegner, den niemand unterschätzen durfte. Und schon gar nicht ein dahergelaufener Bastard wie dieser Marchese!
2
Pompös setzte die Orgel ein und überflutete die Kathedrale mit feierlichen Akkorden. Della Motta ließ sich von den Tönen tragen, atmete sie ein, trank sie förmlich. Wie lange hatte er nicht mehr solch ein herrliches Spiel gehört! Für einen Moment überließ er sich der Gewalt der Musik und vergaß, warum er gekommen war. In einer langen Reihe zogen die Ministranten an ihm vorüber, dann die Priester in ihren langen Gewändern und schließlich der Kardinal. Sein Messgewand schleppte über den Boden, er trug die Mitra wie eine Krone, die breiten Bänder fielen auf seinen Rücken wie ein Hermelinmantel. Auch ohne den kirchlichen Pomp war er eine stattliche Erscheinung, aber mit ihm machte er einen überwältigenden Eindruck. Nur am anthrazitgrauen Haar sah man ihm seine siebenundfünfzig Jahre an, er ging aufrecht und mit einer Spannkraft, die ihn um mindestens zehn Jahre jünger machte. Feierlich schwenkte er das Weihrauchfass und hüllte den Altar in den wohlriechenden Rauch, dann schwenkte er das Fass dreimal in Richtung Gemeinde und überreichte es dem neben ihm stehenden Priester als gehöre es zum Kronschatz.
»In nomine patris, et filii, et spiritus sancti!«, führte er die Hand in einer erhabenen und ausladenden Geste.
»Amen!« kam es von Priestern und Gemeinde wie aus einem Mund, und gleichzeitig mit den anderen vollendete della Motta das Kreuzzeichen. Wenn er katholische Messen hörte, fühlte er sich zu Hause, kein Vergleich mit den Zeremonien anderer Konfessionen! Die der Orthodoxen vielleicht ausgenommen, auch dort richtete sich nichts an den Verstand sondern war nur sinnliches Erlebnis. Natürlich hätte er den lateinischen Worten folgen können, die der Kardinal nun rezitierte, schon die Jesuiten hatten ihm die alte Sprache eingetrichtert und er las immer noch Vergil und Horaz. Lieber aber versank er in die Betrachtung der Altarbilder und lauschte dem Chor, sog den Geruch des Weihrauchs ein, den Duft des Mystischen! In schweren Schwaden hing er in der Luft und verlieh dem Dom und allen Anwesenden ein weiches, nebuloses Aussehen.
Die vornehme Gesellschaft hatte sich zum Hochamt eingefunden, selbst der Hof war zu Allerheiligen erschienen. In der ersten Bank saßen der alte Fürst neben seiner Gemahlin, daneben die beiden Söhne und dahinter die Töchter. Die jüngste trug Trauerkleidung, das musste Sophie sein. Das Schwarz wirkte unpassend an ihr, sie war fast noch ein Mädchen. Da war wohl nicht nur die Mätresse zwischen ihr und dem wesentlich älteren Leopold gestanden.
Auch diese Dame war anwesend, es war für della Motta leicht, sie zu finden. Berückend schön, höchst sinnlich in ihrem dunklen Gewand. Aber düster. Das wäre er an ihrer Stelle auch. Wie viele Mätressen wurden verbannt, sobald sie die Gunst ihres Liebhabers verloren! Und wenn der Geliebte tot war, war ihre Zeit ohnehin abgelaufen. Andererseits hatte sie sich als Gefährtin des ausgesprochen unpolitischen Leopold kaum mächtige Feinde machen können, und wenn nicht Sophie auf ihrer Entfernung vom Hof bestand, hätte sie durchaus Chancen, ihr gewohntes Leben weiterzuführen. Hinter der ernsten Fassade witterte della Motta eine lebenslustige Frau, und mit ihrem Aussehen fand sie bestimmt leicht einen neuen Galan. Im Augenblick war ihre Trauer vielleicht aufrichtig, von langer Dauer war sie gewiss nicht.
Und da war natürlich der Herzog, in nächster Nähe zur Fürstenfamilie. War es klug gewesen, ihn herauszufordern, den Ersten Minister, Vertrauten des Fürsten? Solch eine Stellung nahm man nicht aus Zufall ein, Sondheim war machtgierig, skrupellos und intelligent, solch einen Mann machte man sich nicht frühzeitig zum Gegner! Gleich beim Eintreten in den Salon hatte er Sondheim erkannt, die Miniatur wurde dem Herzog äußerst gerecht. Und trotzdem ließ er sich durch ihn provozieren. Er musste endlich seinen verdammten Hochmut in den Griff bekommen!
In die Menge kam Bewegung, trat man schon zur Kommunion an den Altar? Er kniete vor dem Kardinal nieder und empfing den Leib Christi. Und fühlte einen bohrenden Blick im Rücken, jemand beobachtete ihn scharf. Der Herzog natürlich, Ressau war sein wichtigster Rivale und Sondheim wollte etwas über ihre Beziehung zueinander herausfinden. Der Gottesdienst ging zu Ende, der Kardinal schritt noch einmal den Mittelgang ab, sprengte Weihwasser mit kräftigen Bewegungen, erst nach links, dann nach rechts. Hob beide Arme zum Segen. Triumphales Orgelgetose und im Triumph verließ er den Dom.
Della Motta hatte keine Eile aus der Kirche zu kommen sondern beobachtete gelassen die Menge. Noch zwischen den Säulen bemühten sich zwei Kavaliere um dieselbe Hofdame, andere Aristokraten unterhielten sich bereits über die Jagd oder das Kartenspiel. Die bigotte Fraktion des Hofes behielt ihr würdevolles Gesicht immer noch bei und tauchte die Finger ins Weihwasserbecken. Diese Leute zogen gewiss die Messe in der Privatkapelle vor, und nur der hohe Feiertag hatte sie genötigt, sich unters Volk zu mischen.
Nach der weihevoll düsteren Kirche war die Sonne so grell, dass della Motta im ersten Moment blinzeln musste, als er ins Freie trat. Auf dem Kirchenplatz herrschte Feststimmung, die Bürger machten dem Fürsten und seiner Familie zwar artig ihre Aufwartung, konnten es aber in Wahrheit kaum erwarten, nach Erledigung dieser Pflicht Freunde und Nachbarn zu treffen. Ehrbare Frauen standen in Gruppen beisammen, während Mägde auf die herumtollenden Kinder aufpassten. Die Männer fanden sich in angeregten Gesprächen zusammen, Jünglinge machten den Mädchen schöne Augen. Einige adlige Herren stellten zwar hübschen Bürgerstöchtern nach, stets unter dem argwöhnischen Blick der Väter dieser Mädchen, doch anders als im Salon blieb hier der Hof unter sich.
Sein Blick fiel auf die Frau von Meyn, schon immer hatte er den leichtesten Zugang zum Hof über die Damenwelt gefunden. Auch diesmal dauerte es nicht lange, bis er eine Einladung zur Mittagstafel erhielt, und gerade wollte er zu seiner Kutsche gehen, als ihm ein sommersprossiger Junge in den Weg trat. Wo hatte er dieses Gesicht schon einmal gesehen? Richtig, einer der Ministranten hielt ihm das Billett entgegen. Das ging ja schneller als erwartet!
Zum sicher zehnten Mal sah der Kardinal nach der Uhr auf der Konsole, die Minuten wollten einfach nicht vergehen. Zu lesen hatte er längst aufgegeben und für Korrespondenz hatte er erst recht keinen Kopf, er stand auf und trat ans Fenster. Keine der Kutschen dort unten hielt vor dem erzbischöflichen Palais, alle brachten sie ihre Insassen zu irgendwelchen anderen Gesellschaften. Und es war ohnehin noch zu früh, der Marchese konnte noch gar nicht hier sein. Unruhig schritt Ressau auf und ab. Was sollte diese Nervosität! Er war nach dem Fürsten der mächtigste Mann bei Hof und sorgte sich wegen der Teestunde mit einem Fremden?!
Nun ja, der zweitmächtigste, räumte er ein, vielleicht hatte Sondheim noch ein wenig mehr Einfluss, aber das sollte sich bald ändern. Der Fürst hatte heute nicht gut ausgesehen, von Tag zu Tag verfiel er mehr, und wenn er die Herrschaft an Karl abgeben musste, dann stand Ressau bereit. Den Erbprinzen hatte er fest in der Hand, und kam Karl endlich an die Macht, waren die Tage des Herzogs gezählt. Doch bis zum Tod des Fürsten musste er sich mit den kleinen Triumphen begnügen. Wie gestern im Salon der Meyn, diese Schlappe gönnte er Sondheim von ganzem Herzen. Geschah ihm ganz recht, warum konnte er den Italiener auch nicht in Ruhe lassen? Es war doch offensichtlich, dass man sich mit dem besser nicht anlegte! Gleich bei seinem Eintreten hatte Ressau das gewusst. Nicht, dass der Marchese direkt Streit gesucht hätte, aber das Temperament, das unter der eleganten Oberfläche schlummerte, war deutlich spürbar. Der würde niemals nachgeben, der ließ sich auch von einem Sondheim nicht einschüchtern. Solch einen Mann durfte man nicht herausfordern, den musste man benutzen.
Ressau hatte die Kraft gespürt, die von della Motta ausging, seinen unbändigen Willen, aber auch noch etwas anderes, Gefährliches. In den richtigen Händen war der Marchese eine tödliche Waffe. Und diese Waffe galt es sich rechtzeitig zu sichern! Es war riskant, gewiss, aber er wusste, wie man Menschen zu Werkzeugen machte, und della Motta mit seiner Eitelkeit, mit seiner Selbstverliebtheit, war leicht zu gewinnen. Er befand sich auf dem Weg hierher, alles lief nach Plan, warum also diese Unruhe?
Dieses Warten machte ihn noch verrückt! Er brauchte unbedingt Ablenkung, und Ruhe fand er am besten bei seinen Skulpturen. Kaum betrat er den Saal mit den Repliken, entspannte er sich. Langsam schritt er die Statuen ab, blieb beim Laokoon stehen und versenkte sich in den Todeskampf des Priesters gegen die Schlangen. Jeden Muskel kannte er auswendig und doch faszinierte ihn der Anblick jedes Mal aufs Neue. Stille Einfalt, edle Größe, wie wahr! Er ging weiter und ließ seinen Blick träumerisch auf dem Barberinischen Faun ruhen, der ihn einladend und sehr unanständig erwartete. In der Antike musste sich ein Mann nicht verstellen, damals durfte ein Mann Männer lieben. Und hier kamen die Krieger. Liebevoll fuhr er mit der Hand über den Borghesischen Fechter und streichelte den Sterbenden Gallier. Fühlte ihre kräftigen Körper, ihre energischen Proportionen. Und jetzt die Götter, der Apoll vom Belvedere und Praxiteles’ Hermes, so glatt, so schön, so perfekt wie nur Unsterbliche es sein können. Seine Hände formten die Muskeln von Apollonios‘ Torso vom Belvedere nach. Und plötzlich stand Michelangelos David in der Tür.
Ressau war vollkommen in das Erlebnis der Plastiken versunken gewesen und hatte den Marchese nicht kommen gehört, und da stand er auf einmal! Er hatte tatsächlich Davids Körper, die lässige und doch kräftige Haltung eines Kämpfers. Den sehnigen Hals, die schöne Nase, das stolze Profil. Nur sein Gesicht war markanter, er war beileibe kein Jüngling mehr. Außerstande, seinen Blick von della Motta zu nehmen, streckte Ressau ihm die beringte Hand zum Kuss entgegen. Geflissentlich übersah der Marchese sie und umrundete die Laokoon-Gruppe mit einem Kennerblick.
»Ihr solltet sie einmal abends, im Schein der Fackeln sehen!«, geriet Ressau ins Schwärmen. Della Motta warf ihm einen kurzen Blick zu und betrachtete weiterhin die Statue.
Es war keine gute Idee gewesen, die Skulpturen aufzusuchen. Ressau wollte einen klaren Kopf haben, hatte sich aber seinen Sinnen ausgeliefert, und die spielten ihm nun einen teuflischen Streich. David. Was für ein Unsinn! Natürlich war ihm aufgefallen, dass der Marchese gut aussah, aber die Körperlichkeit des Italieners hatten ihm erst die Kunstwerke ins Bewusstsein gebracht. »Kommt, Ihr seid nicht hier, um Euch über Kunst zu unterhalten. Im Teesalon können wir bequemer reden.«
Nun saß ihm della Motta also gegenüber. Auch Davids Beine.
Aus! Schluss mit dem Unfug, zur Sache! Della Motta schien zum Glück nichts zu bemerken, wirkte entspannt und ließ den Löffel in der Tasse kreisen. Nur die Finger bewegten sich, die Spitzenmanschette zuckte in winzigen Bewegungen, alles andere an ihm war absolut ruhig. Aufreizend ruhig. Ressau sah ihm eine Weile zu, beobachtete, wie er die Tasse an die Lippen führte und genießerisch dem Tee nachschmeckte. Der Marchese schien alle Zeit der Welt zu haben, ließ sich durch sein Schweigen nicht verunsichern und forderte ihn nicht einmal durch einen Blick auf, das Gespräch zu beginnen.
»Ihr seid also gestern angekommen?«, verzichtete Ressau auf ein sinnloses Kräftemessen. »Hoffentlich war Eure Reise nicht zu beschwerlich?«
»Den Umständen entsprechend.« Della Mottas Stimme klang angenehm, dunkel. Ein sonorer Bariton mit einem weichen Timbre, italienisch eben, obwohl sein Deutsch nahezu akzentfrei war.
»Die Wege sind immer noch katastrophal, Räuber machen die Wälder unsicher, und ich kann das Rütteln der Kutschen nicht ausstehen«, gestand Ressau. »Reisen zählt zwar zu den notwendigen, aber gewiss nicht zu den erfreulichen Seiten des Lebens. Kommt Ihr direkt von Euren Gütern in Italien?«
»Aus Wien.«
»Vom Kaiserhof? Wie ist es dort?«
»Wie an allen anderen Höfen auch.«
»Der Kaiser soll recht reformfreudig sein?«
»Für einen Herrscher geradezu radikal.«
»Darüber müsst Ihr mir mehr erzählen!«
»Ich fürchte, dafür bin ich nicht der Richtige, mein Interesse an Politik hält sich in Grenzen.«
Aha, wir halten uns also bedeckt. »Und wie ist das Leben in der Kaiserstadt?«, versuchte Ressau es mit einem anderen Thema.
»Man liebt dort Behaglichkeit, schätzt Musik und frönt dem Genuss. Und den Tafelfreuden«, fügte der Marchese mit einem Schmunzeln hinzu. »Sie eifern den Franzosen nach, aber der italienische Einfluss ist immer noch stark.«
»Euer Deutsch ist vortrefflich, beherrscht Ihr die Sprachen aller Länder so gut, in denen Ihr Euch aufhaltet?«
»In vielen.«
»Um diese Fähigkeit seid Ihr zu beneiden!«
Der selbstzufriedene Ausdruck auf della Mottas Gesicht war nur kurz zu sehen, aber Ressau war er nicht entgangen.
»Verglichen mit Wien ist unsere Residenz sicher bescheiden. Ihr seid hoffentlich mit allem nötigen Komfort umgeben, wohnt doch im Schloss?«
»In einem Bürgerhaus, ich habe auch da alles, was ich brauche. Vor allem den Vorteil, mich jederzeit zurückziehen zu können.«
»Und doch meidet Ihr nicht die Gesellschaft. Wie hat Euch der Salon der Meyn gefallen?«
»Die Dame hat Geschmack, zumindest was diesen Maler betrifft. Kein Genie, aber von passablem Können.«
»Ihr interessiert Euch also wirklich für Kunst?«
»Wäre ich sonst dort erschienen?«
Ressau bedachte den Marchese mit einem Blick, der Bände sprach. »Wir wissen beide, warum Ihr dort wart. Natürlich könnt Ihr auch den mühsamen Weg über die mittlere Riege nehmen, aber ein Wort von mir und Ihr seid Mitglied des innersten Zirkels.«
Ein seltsames Lächeln zuckte in den Mundwinkeln des Marchese. Und mit einem Mal war alles Weiche, Elegante verschwunden, da waren nur mehr Energie und Kraft. Und Gefahr. Er sah den Kardinal unverwandt an. »Und was habt Ihr davon, Eminenz?«
»Einen Verbündeten.« Ressau gab sich Mühe, dem intensiven Blick standzuhalten.
»Braucht Ihr denn einen?«
»Nicht jeden. Aber ich will Euch.«
»Ah.«
Ressau ließ sich nicht täuschen, er hatte das kurze Aufglimmen in della Mottas Augen gesehen. Da war der Stolz, mit dem er gerechnet, auf den er gesetzt hatte.
»Ihr habt mich gestern beeindruckt, wie Ihr dem Herzog Paroli geboten habt.«
Ein leichtes, verächtliches Schnauben. »Das fandet Ihr außergewöhnlich?«
Der Kardinal ließ sich nicht beirren, er spürte die Zufriedenheit seines Gegenübers, mochte er noch so sehr mit falscher Bescheidenheit kokettieren. »Abgesehen von mir seid Ihr der Einzige, der sich nicht vor Sondheim fürchtet.«
»Was weniger für mich, als vielmehr gegen die Männer am Hof spricht.«
»Wenn Ihr es so sehen wollt ...«
Die Härte in della Mottas Blick war gewichen und hatte Herablassung Platz gemacht. Betretene Stille. Della Motta studierte das Gesicht des Kardinals, und Ressau hatte den Eindruck, als versuche er, seine Gedanken zu lesen. Endlich nahm der Marchese das Gespräch wieder auf: »Was macht Euch so sicher, dass ich Euch als Verbündeter von Nutzen sein kann?«
Dass Ihr nicht einmal vor einem Mord zurückschrecken würdet. »Dass wir die selben Interessen haben.«
»Eure Feindschaft mit dem Herzog haltet Ihr also für ein gemeinsames Interesse?«
»Sollte ich mich getäuscht haben?«
»Sondheim ist kein Problem. Nicht mehr lange.«
Nur della Mottas kalter, abfälliger Blick verhinderte, dass der Kardinal in schallendes Lachen ausbrach. »Das sollte er hören! Er würde Euch dafür den Hals umdrehen.«
»Das brächte er nicht fertig.« Nicht einmal ein Schmunzeln, einfach eine Feststellung.
»Das glaube ich Euch aufs Wort. Werdet Ihr also für mich arbeiten?«
»Ich arbeite für niemanden.«
»Und dennoch habt Ihr einen gewissen Ruf. Ich gehe davon aus, dass er nicht unbegründet ist?«
»Die Leute erzählen viel.«
»Aber nicht jeden beliebigen Mann halten sie für einen Spion. Ich frage nicht, in wessen Auftrag Ihr hier seid, denn Ihr würdet mich ohnehin belügen. Aber Ihr habt deutlich gemacht, dass Ihr für Sondheim keine große Sympathie hegt.«
»Ich leiste mir keine Sympathien. Für mich zählt einzig, wessen Absichten sich mit den meinigen decken.«
So unähnlich waren sie sich gar nicht. »Und selbstverständlich habt Ihr nicht vor, mir diese Absichten zu verraten.«
Er erhielt nur ein mitleidiges Lächeln. »Ich werde Euch gegen den Herzog unterstützen, wenn Ihr mich in die höchsten Kreise einschleust. Und jetzt erzählt mir, was ich über die Verhältnisse am Hof wissen muss!«
Della Motta war ein aufmerksamer Zuhörer, nur hie und da warf er eine kurze Frage ein. Es war unmöglich herauszufinden, wie viel er bereits wusste, unmöglich, sich über seine tatsächlichen Absichten klar zu werden. Doch dafür war noch Zeit, wichtig war, dass Ressau ihn auf seine Seite gebracht hatte. Ein Klopfen an der Tür unterbrach sie.
Der Kardinal bedachte seinen Sekretär, einen jungen Priester, mit einem finsteren Blick, er hatte sich doch jede Störung verbeten! Aber es musste wichtig sein, sonst hätte der Pater sich geduldet, bis der Marchese gegangen war, und hätte den Gast auch nicht so unsicher gemustert. Sichtlich unschlüssig, ob er den Italiener als Vertrauten behandeln durfte, beugte er sich zum Ohr des Kardinals. – – –
Das konnte unmöglich wahr sein! »Wann?!«
»Vor wenigen Minuten. Er kam sofort hierher.«
»Und es ist vollkommen sicher? Kein Irrtum?«
»Da kann es keinen Irrtum geben.«
Der Marchese betrachtete die Tapisserien und gab vor, nicht an der Nachricht interessiert zu sein, doch als der Pater den Raum verlassen hatte, zog er fragend eine Augenbraue hoch. Der Kardinal erhob sich. »Wir werden unser Gespräch ein anderes Mal fortsetzen, ich muss unverzüglich ins Schloss.« Della Mottas Gesicht blieb ausdruckslos, aber während Ressau ihn beobachtete, formte sich sein Entschluss. Er wusste, dass der Marchese sein Angebot nicht ausschlagen würde: »Begleitet mich! Ihr solltet Sondheim unbedingt zuvorkommen.« Jetzt würde sich herausstellen, wie nützlich dieser Spion war.
Della Motta eilte an der Seite des Kardinals die Prunkstiegen hoch, vorbei an Gemälden und Fresken, über Marmor, Sternparkett und dicke Teppiche, doch er hatte keine Augen für die Schönheiten des Schlosses. Im zweiten Stock schnaufte Ressau vor Anstrengung, hastete aber weiter, den Gang entlang, auf eine Zimmerflucht zu. Stieß dort mit dem Herzog zusammen, der ebenfalls außer Atem war, und wie zwei kleine Bengel zwängten sie sich gleichzeitig durch die Tür.
Im Raum wimmelte es von Lakaien und Hofleuten. Hysterisch kreischende, sensationslüsterne Damen und Männer, die sich gegenseitig in Geschäftigkeit und klugen Reden übertrumpften und jedermann, vor allem aber sich selbst, davon überzeugten, Herren der Lage zu sein. Ein einziges Durcheinander, in dem man unmöglich etwas entdecken konnte, wenn die Spuren nicht ohnehin schon vernichtet waren. So ging das nicht. Er fasste Ressau am Ellbogen, blickte über die Anwesenden und machte eine Kopfbewegung in Richtung Türe. Der Kardinal nickte, sah aber kurz auf Sondheim, und beiden war klar, dass zumindest der Herzog sich weigern würde, den Raum zu verlassen.
Ressau fand einen anderen, unauffälligen Weg das Zimmer zu räumen: Er begann damit, die Anwesenden zu befragen. Della Motta hörte nicht zu, Hauptsache der Herzog hielt die Befragung für eine Einmischung in seinen Zuständigkeitsbereich. Und prompt schaltete er sich sofort ein, jetzt überboten sich die beiden Rivalen gegenseitig und alles scharte sich um die Würdenträger, denn niemand wollte sich auch nur ein Wort entgehen lassen. Keinem fiel auf, dass der Kardinal dabei die Schar in Richtung Eingang lenkte, nicht einmal Sondheim.
Endlich leer! Della Motta sah sich um, was sich ihm bot, war das Bild einer Verwüstung. Er befand sich im Arbeitszimmer, Prinz Diethard lag tot am Boden, in seiner Brust steckte ein Stilett. Umgeworfene Sessel deuteten auf einen Kampf hin, Papiere waren vom Schreibtisch gefegt. Das Tintenfass war ebenfalls auf den Boden gefallen, sein Inhalt ergoss sich auf den Teppich und färbte ihn schwarz. Mit dem Fuß schob della Motta einen Bogen in Sicherheit.
Er beugte sich über den Toten. Die Verletzung war Diethard von vorne beigebracht worden. Dann konnte er unmöglich am Schreibtisch gesessen sein, der war zu breit, um über ihn hinweg einen kraftvollen Stoß zu führen. Hatte Diethard den Täter überrascht, als der die Papiere durchsuchte? Er bückte sich nach den auf dem Boden verstreuten Schriftstücken. Skizze, Skizze, Plan, Skizze, Plan, Plan, Skizze. Der Prinz wollte offenbar ein Lustschloss bauen, diese Kalkulationen passten dazu. Für Material, für Künstler, für Handwerker, Landschaftsarchitekten ... Konnte der Bau eines Schlosses Motiv für einen Mord sein? Unwahrscheinlich. Da, etwas anderes. Pädagogische Überlegungen: Wie weit muss oder darf die Aufklärung des Volkes gehen. Immer dieselbe Handschrift, vermutlich Diethards eigenes Werk. Keine Zeit, das alles zu studieren, ein flüchtiger Blick musste reichen. Volksaufklärung, Volksaufklärung, das auch. Keine private Korrespondenz. Noch eine Skizze. Auf den Schlossstapel. Moment, was stimmte damit nicht? Schnell, ein anderes Blatt her, irgendeins. Genau, das Papier war anders. Dicker. Bräunlicher als die übrigen Bögen. Er faltete den Plan zusammen, schob ihn in seinen Ärmel und griff nach dem nächsten Bogen.
»Was tut Ihr hier?«
Die herrische Stimme des Herzogs!
Della Motta erstarrte in der Bewegung, dafür rasten seine Gedanken. Wie lange stand Sondheim schon in seinem Rücken und beobachtete ihn? Jetzt unbedingt die Nerven behalten. Bedächtig aufstehen und umdrehen. Und dann Flucht nach vorne, am besten mit gelangweiltem Gesicht. »Jedenfalls etwas Vernünftigeres als Ihr«, richtete er sich auf. »Wisst Ihr nun mehr als der Kardinal?«
Das hatte gesessen, das Auge des Herzogs loderte auf vor Wut. »Legt das sofort wieder weg! Ihr habt kein Recht, diese Papiere zu lesen.«
Della Motta warf einen zögerlichen Blick auf das Blatt, und entrüstet riss der Herzog es ihm aus der Hand. Jetzt trieb der Marchese das Spiel auf die Spitze, sah dem Bogen sehnsüchtig und enttäuscht nach, wendete sich aber zur Tür.
»Ihr bleibt hier!«
»Versucht, mich zu halten!«
In dem Moment sah er Rot. Kardinalsrot. Bereit, ihm Rückendeckung zu geben, war Ressau herbeigeeilt, wenigstens war sein Verbündeter kein Feigling. Sondheim funkelte den Kardinal an, dann della Motta und wieder den Kardinal. Schien einen Moment zu überlegen, ob er die Konfrontation fortsetzen sollte, entschied sich aber anders. »Versiegelt die Räume!«, bellte er einen Offizier der Palastwache an und grinste daraufhin Ressau schadenfroh ins Gesicht. Der Offizier war sicher ein Vertrauensmann des Herzogs, niemand konnte nun ohne die ausdrückliche Genehmigung Sondheims die Gemächer des Prinzen betreten.
Della Motta sah verdrießlich drein und zischte italienische Verwünschungen. Sein südländisches Temperament ging mit ihm durch, er hatte sich zwar so weit im Griff, nicht lautstark zu schimpfen, aber man konnte ihm seinen Zorn durchaus anmerken. Ressau beherrschte sein Mienenspiel besser, zeigte ein ausdrucksloses Gesicht, doch della Motta konnte spüren, dass auch der Kardinal innerlich kochte. Und seinetwegen höchst irritiert war, ein Spion, der seine Gefühle nicht verbergen konnte, war ihm offenbar noch nicht untergekommen. Der kleinste Höfling beherrschte diese Kunst besser als der Marchese della Motta!
Der Marchese beruhigte sich erst, als sie sich wieder im Salon des erzbischöflichen Palais befanden. Zumindest einigermaßen. Er verzichtete auf den angebotenen Sessel und marschierte stattdessen unter Ressaus tadelnden Blicken vor dem Kamin auf und ab.
»Zeigt Ihr Euren Ärger stets so offensichtlich?!«, fuhr Ressau ihn an. »Es ist widerwärtig, Sondheim diesen Triumph zu bereiten.«
»Meinetwegen soll er diese Freude ruhig haben.«
»Hättet Ihr Euch zusammengenommen, wüsste er nicht, dass er uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Hat man Euch denn nicht beigebracht, Eure Gefühle zu verschleiern?«
»Das muss man wohl vergessen haben.«
»Herrgott, spielt nicht auch noch beleidigt! Ihr seid wahrlich aus dem Alter heraus, in dem man Euch den Heißsporn zugesteht. Sagt mir lieber, was Ihr herausgefunden habt!«
»Was denkt Ihr wohl? Der Herzog hat mich viel zu früh unterbrochen, kein Mensch kann den Schauplatz eines Mordes in so kurzer Zeit erschöpfend untersuchen.«
»Es gibt also keinen Hinweis auf den Täter?«
»Ich habe ihn zumindest noch nicht entdeckt.«
»Ein berühmter Spion geht als Erster an den Schauplatz eines Mordes und kann nichts finden!«, höhnte der Kardinal.
»Ich sagte: Noch nicht.«
»Ach natürlich. Ihr seht euch ja gleich noch einmal um.«
»Habt Ihr einen besseren Vorschlag?«
Der Kardinal zuckte die Achseln.
»Was kam bei Eurer Befragung heraus?«, erkundigte sich della Motta, nun merklich ruhiger.
»Auch nichts. Niemand wurde beim Betreten der Gemächer gesehen, was merkwürdig ist, da stets ein Lakai an der Tür steht. Er muss den Mörder kennen und ihn decken, doch es war weder der richtige Zeitpunkt, noch der passende Ort, die Wahrheit herauszufinden.«
Welchen Ort hielt der Kardinal wohl dafür geeignet? Waren ihm zu viele Zeugen anwesend für eine nachdrückliche Form der Befragung? Zimperlich war Ressau gewiss nicht, der Kardinalspurpur hinderte ihn kaum, drastische Mittel anzuwenden, wenn es seinen Absichten förderlich war. »Vergesst den Posten, gewiss nimmt ihn jetzt der Herzog in die Mangel!«
»Sondheim! Er wird sich auch das Zimmer ansehen und die Beweise beiseite schaffen.«
»Nur die, die er findet.«
»Aber ja doch! Er ist Euch zwar als Hofmann um Längen voraus, aber zumindest kein ausgebildeter Spion und wird alles übersehen, was Ihr ihm so zuvorkommend liegen gelassen habt! Und wie wollt Ihr es überhaupt anstellen, nochmals in den Raum zu gelangen? An der Wache kommt Ihr nämlich nicht vorbei, das ist einer von seinen Leuten.«
»Auf dem selben Weg wie der Mörder.«
»Und der begegnete nicht dem Türposten?«
»Nein.«
»Dann müsste er durch Wände gehen können.«
»Das tut er auch.«
Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war der Kardinal nahe dran, della Motta für verrückt zu erklären, er mochte sich wohl langsam fragen, ob die Allianz seine klügste Idee gewesen war.
»Womit wird Euer Palais beheizt, Eminenz?«
»Mit Holz natürlich, wie jedes Haus.«
»Das bedeutet, eine Menge Holz muss durch den Palast geschleppt werden. Man sieht aber niemals Träger auf den Stiegen.«
»Natürlich nicht, weil das Gesinde die Hintertreppen benutzt.« Jetzt hellte sich Ressaus Gesicht in allmählichem Erkennen auf. »Selbstverständlich, die Diener haben eigene Wege in einem Palast!«
»Und diese verlaufen innen, hinter den offiziellen Räumen, und sind meist durch Tapetentüren mit den Prunkzimmern verbunden.«
»Ihr dürft aber nicht in Eurer normalen Kleidung auftreten, die Diener würden sofort Argwohn schöpfen und Sondheim benachrichtigen.«
»Ebenso wie Euch.«
»Nun ja«, schmunzelte der Kardinal geschmeichelt. »Nicht nur Sondheim hat seine Leute. – Welche Verkleidung wählt Ihr? Wärt Ihr gerne ein livrierter Lakai?«
»Nein, die Hofleute dürfen keine Notiz von mir nehmen.«
»Also ein Handwerker.« Ressau maß ihn prüfend. »Für einen Rauchfangkehrer seid Ihr leider zu groß. Schade, das hätte zu Eurer italienischen Herkunft gepasst. Könnt Ihr vielleicht überzeugend mit Glas umgehen? Mit Spiegeln? Oder viel besser noch mit Stuck? Dazu bräuchtet Ihr Gefäße, in denen Ihr Gips transportieren könnt, und Werkzeug. Ihr würdet kein Aufsehen erregen, wenn Ihr etwas herumtragt.«
»Viel zu auffällig. Ich muss ein kleiner, bedeutungsloser Knecht sein, den niemand beachtet. Ein Holzträger oder Küchengehilfe etwa.«
»Ich verstehe. Habt Ihr die nötige Kleidung?«
Der Kardinal war jetzt ganz bei der Sache, seine Zweifel über seinen Bündnispartner schienen verflogen. Das war doch mal etwas anderes als die üblichen Hofintrigen!
3
»Wie lange müssen wir denn noch warten? Ich bin hundemüde«, gähnte Anna, und Giacomo konnte sie irgendwie verstehen, immerhin hatte das Mädchen den ganzen Tag geschuftet. »Es gibt Leute, die früh aufstehen müssen! Dein Herr ist ganz schön rücksichtslos!«
Das war er. Oder nein, das war er eigentlich nicht. Nicht rücksichtslos. Nur gedankenlos, wie alle hohen Herren. Aber Giacomo hatte sich so sehr daran gewöhnt, auf ihn zu warten, dass es ihm schon nicht mehr auffiel. Er fand immer etwas zu tun, und wenn nicht, ging er eben in die Küche zu den Mägden.
»È bene, er ist in Ordnung.«
»Bist du schon lang bei ihm?«
»Zehn Jahre.«
»Alle Achtung!«
»Und du?«
»Ach, mal hier, mal da. In dem Haus bin ich seit sechs Monaten.«
»Ein schönes Haus, bellissima.«
»Ja, wenn man drin wohnt, aber nicht, wenn man es in Ordnung halten muss. Warum seid ihr überhaupt hier und nicht im Schloss?«
»Weil der Marchese Bewegungsfreiheit mag.«
»Komischer Kerl, dein Herr. Wenn ich den Luxus haben könnt, tät ich nicht lang überlegen.«
»Non è male, hier geht’s uns auch nicht schlecht. Eine ganze Etage für uns ...«
»Für ihn. Du hast nur eine Kammer.«
»Bah, aber ich muss nicht in der Gesindestube schlafen. – Hörst du? Er kommt.«
»Na endlich!«, sprang Anna auf um die Tür aufzuschließen.
»Nicht so schnell! Ich muss doch noch …« Giacomo riss den Rock von der Stuhllehne und schlüpfte im Laufen hinein. Der Marchese schritt kommentarlos an ihnen vorbei und sofort die Stiege hoch. »Bring warmes Wasser rauf, Anna, dann kannst du schlafen gehen!«, hatte es nun auch Giacomo eilig.
»Klar doch, gnädiger Herr.«
Giacomo schubste sie leicht. »Also bis morgen. Zum Markt.«
»Beeil dich schon! Dein Marchese wartet.« Sie drückte ihm den Kerzenleuchter vor die Brust, und er huschte an Visconti vorbei, um ihm die Stiegen hinauf zu leuchten.
Oben goss sich der Marchese ein Glas Wein ein und begab sich damit ins Arbeitszimmer, nahm ein gefaltetes Blatt Papier aus dem Ärmel und legte es auf den Schreibtisch. Giacomo trug den Frack in den Ankleideraum, um ihn auszubürsten, und als er zurückkam, kopierte der Marchese bereits das mitgebrachte Papier.
»Was ist das?«
»Irgendein Plan, ich habe noch keine Ahnung, wofür.«
Visconti machte nie den Fehler der Herrschaften, die Diener für blind und taub zu halten, aber er wusste natürlich auch, dass er vor Giacomo keine Geheimnisse haben musste. Giacomo war der einzige Mensch, dem sein Herr bedingungslos vertraute, und darauf war er nicht wenig stolz. Und nie im Leben hätte er ihn enttäuscht.
Nicht nach dem, was der Marchese für ihn damals in Venedig getan hatte. Blindlings war Giacomo in die Falle getappt, die ihm die appetitliche Alessa gestellt hatte, er konnte einem hübschen Mädchen einfach nicht widerstehen, und diese hatte ihr Handwerk wirklich beherrscht. Diesen großen, unschuldigen Augen etwas abzuschlagen, wäre ein Verbrechen an allen Frauenzimmern gewesen! Die Nacht war leidenschaftlich, schade nur, dass am nächsten Morgen die gesamte Barschaft des Signor Carducci fehlte. Und zu dumm, dass Giacomo als Hausdiener des Tuchhändlers Zugang zum Geld hatte. Die abgefeimte Alessa war spurlos verschwunden, und er hatte die ganze Meute am Hals. Hätte der Marchese ihm nicht geholfen, hätte Giacomo am Galgen geendet.
Seine Stellung bei Signor Carducci war er los, und kein anderer Herr hätte einem Dieb eine anständige Arbeit gegeben. Keiner, außer der Marchese della Motta. Der nahm ihn nicht nur in seine Dienste, sondern vertraute ihm sogar immer größere Beträge und Wertsachen an. Einmal fragte er den Herrn, ob er denn keine Angst hatte, dass er mit dem Geld durchbrannte. Visconti hatte ihm einfach ins Gesicht gelacht: »Weit kommst du damit sicher nicht.« Giacomo hielt es für eine versteckte Drohung, erst sehr viel später begriff er, wie genau sein Herr Menschen einschätzen konnte. Dass er kein Risiko eingegangen war, als er ihn vor der Strafverfolgung gerettet hatte. Dass er nicht hoffte, sondern einfach wusste, dass sein Diener eine ehrliche Haut war.
Er guckte dem Marchese über die Schulter und schaute sich die Skizze an. »Wo habt Ihr die her?«
»Aus dem Arbeitszimmer des Prinzen Diethard.«
»Ihr wart schon heute bei der Fürstenfamilie?« Das war diesmal ja flott gegangen.
»Nicht direkt. Diethard war bereits tot, als ich ihn kennen lernte.«
»Tot.«
»Ermordet.«
»Von wem?«
»Das weiß ich noch nicht.«
Visconti reichte ihm kommentarlos beide Bögen und ging ins Ankleidezimmer voraus. Es war auch keine Anweisung nötig, Giacomo wusste auch so, was er zu tun hatte. Das Original rollte er zusammen und schob es in den hohlen Griff der Haarbürste, die Kopie ließ er unter dem Einsatz der Rasiermesser-Kassette verschwinden. Sie hatten viele Plätze für heikle Gegenstände. Wie das Innere eines Stiefel- oder Tanzschuhabsatzes. Säume von Fräcken oder, noch besser, von Giacomos Röcken. Die gängigen Orte, die jedermann einfielen, waren für andere Sachen reserviert. In die Geheimfächer eines Sekretärs, in den Raum unter einer Matratze oder hinter ein Bild, auch unter lose Dielen im Boden kamen nur Dinge, die gefunden werden sollten. Und sie hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, Duplikate anzufertigen, trotz aller Vorsicht konnte es passieren, dass jemand ein Original entdeckte.
Der Marchese nahm die Perücke ab und wusch sich die Schminke aus dem Gesicht, während Giacomo die Weste auf lose Knöpfe oder sonstige Schäden überprüfte. Nichts auszubessern, das würde sich bald ändern. Aber sie standen ja erst am Beginn, da lief es meistens noch ruhig.
»Wie war’s beim Kardinal?«
»Wie geplant. Er glaubt, mich benützen zu können.«
»Weiß er von der Skizze?«
»Das fragst du nicht im Ernst!«
Ein doppeltes Spiel, wieder einmal. Auch kein gemeinsamer Gegner wie dieser Herzog änderte etwas daran.
»Ich muss morgen zeitig aufstehen.«
»Pjotrs Gewand?«
»Ja.«
Klar. Früh aufstehen hieß meistens Pjotr. Für Herrschaften begann der Tag später als für Dienstboten, das galt auch für Visconti. Wenn er sich zu nachtschlafender Zeit aus dem Bett bequemte, dann fast immer, um den Knecht zu spielen.
Giacomo mochte Pjotr, denn der war sein Geschöpf. Er hatte es zunächst für eine Laune gehalten, als der Marchese ihn aufforderte, ihm die Welt des niedrigen Volkes zu zeigen, die der Knechte und Unterprivilegierten, der Taglöhner. Giacomo hatte ihm die Mischung aus Interesse und Ekel angesehen und erst nicht glauben wollen, was der Marchese daraufhin verlangte: Giacomo sollte ihm beibringen, sich wie ein Knecht zu benehmen! Und so war er der Lehrer seines Herrn geworden, bis sich der unter dem Dienstpersonal mit der gleichen Sicherheit bewegte, wie am höfischen Parkett. Sie saßen mit dem Pöbel in den Kaschemmen oder kauten einen Kanten Brot in den Gesinderäumen, dort war Visconti nur Riccardo, der sich duzen ließ und venezianischen Dialekt sprach. Später studierte er die Sprachen und Eigenheiten unterschiedlicher Nationen, und mittlerweile ging er als böhmischer Handwerksgeselle ebenso durch, wie als irischer Stallbursche, französischer Koch oder deutscher Tischler. Dass Visconti mehrere Sprachen fast akzentfrei beherrschte, war bekannt, doch kaum einer wusste, dass der arrogante Marchese in ebenso vielen Dialekten fluchen konnte wie ein Kutscher.
Die Nacht war nur kurz gewesen, aber Giacomo stand schon im Ankleidezimmer bereit. Die Verwandlung des Adligen in einen Knecht war eine aufwendige Prozedur, die sein ganzes Können erforderte. Della Motta rieb sich den Schlaf aus den Augen und fuhr sich mit der Hand über das Kinn. Unangenehm, dass die Rasur heute ausbleiben musste, um seinem Gesicht die aristokratische Feinheit zu nehmen. Giacomo bürstete auch nicht sein Haar, bis es glänzte, sondern kämmte es nur gerade so weit, dass es nicht völlig ungepflegt wirkte, und band es mit einem Lederriemen lose im Nacken zusammen. Die Hände wurden mit Kohlen geschwärzt und er wusch sie nur notdürftig, so dass der Kohlestaub unter den Nägeln hängen blieb und die Handrücken einen fleckigen Grauschleier behielten. Die manikürten Fingernägel konnten sie freilich nicht einreißen, das hätte die Rückverwandlung unmöglich gemacht. Früher hatten sie auch die Handflächen aufgeraut, bis della Motta einmal beim abendlichen Kartenspiel aufgeflogen war. Pjotr war er nur für ein paar Stunden, und die edle Schale des Marchese durfte er nicht zerstören.
»Nütze den Tag, um dich in der Stadt umzuhören! Ich will wissen, ob man außerhalb des Schlosses bereits über Diethards Ermordung redet.«
»Geht klar. Übrigens faselt irgendein Bauer etwas über die Schlangen.«
Della Motta verdrehte die Augen. Hätte Giacomo ihm das nicht bereits gestern sagen können?! »Hast du ihn gesehen?«
»Nein, aber Marie, eine wirklich fesche Blonde, ich sage Euch, die kann ...«
»Erspare mir deine Frauengeschichten!«
»Verzeiht! Also diese Marie hat mir von ihm erzählt.«
»Und was genau hat sie dir gesagt?«
»Dass die Schlangenbrüder wegen Leopolds Tod kämen.«
»Was weiß ein Bauer über den Schlangenorden?«
»Vielleicht hat er zufällig davon gehört und will sich wichtig machen?«
»Der Bund arbeitet im Geheimen. Von dem hört man nicht zufällig.«
»Dann gehört er eben selber dazu.«
»Suche den Bauern und finde heraus, mit wem er Kontakt aufnimmt!«
Er selbst musste ins Schloss und konnte sich jetzt nicht um den mysteriösen Gesellen kümmern. Die neuerliche Untersuchung des Tatorts drängte, bevor der Herzog wichtige Beweise zur Seite schaffte. Wenn er es nicht schon längst getan hatte!
Die Luft in den engen Gängen war stickig, und das Licht fiel nur spärlich herein. Pjotr trug einen riesigen, mit Holzscheiten vollbepackten Korb auf den Schultern und gab sich Mühe, nicht mit den vorbeieilenden Dienstboten zusammenzustoßen. Jahrelanger, täglicher Dienst im Schloss ließ sie ihren Weg mit traumwandlerischer Sicherheit finden, während für ihn jeder Gang, jeder Winkel neu war. Dennoch war seine mangelnde Ortskenntnis ein wesentlich geringeres Risiko als die ungewohnte Last. Er war als Neuzugang dem Trupp zugeteilt worden, der sich um die Befeuerung der Öfen zu kümmern hatte, und bemühte sich um den Anschein, er wäre mit derlei Tätigkeiten seit langem vertraut. Das Problem war dabei nicht, das Feuer zu entfachen, sondern den sperrigen Korb herumzuschleppen, ohne sich durch frühzeitige Erschöpfung zu verraten. Es war noch dunkel gewesen, als er seine Arbeit aufnahm, doch die Schlossbewohner erwarteten beim Aufstehen warme Räume, dienstbereite Zofen und Kammerdiener, frisches Gebäck und dampfenden Kaffee. Ein Kammerdiener rammte ihn, und er mühte sich ab, den Holzkorb auszubalancieren. Gerade noch rechtzeitig besann er sich seiner momentanen Stellung, grunzte nur missmutig und wollte seinen Weg fortsetzen. Er erhielt einen neuerlichen Stoß, diesmal absichtlich. Er zog den Kopf ein und schluckte seinen Ärger hinunter.
Drei Stunden wurde geschuftet, bis auch die letzte Hofdame angekleidet war, und der verschlafenste Kavalier sein Frühstück eingenommen hatte. In den Prunkzimmern nahm das Leben seinen vertrauten Gang, während sich das Gesinde in der Küche zu einer Zwischenmahlzeit versammelte. Hier galt es besonders vorsichtig zu sein. Pjotr setzte sich mit den anderen Knechten an den Tisch, riss sich einen Kanten Brot ab und schlürfte seine Suppe. Rohe Tischsitten waren ihm zuwider und er konnte sich nicht überwinden, auch noch die Essensgeräusche der anderen nachzumachen.
Aber äußerlich unterschied er sich kaum von ihnen. Hemd und Hose waren aus einem derben Stoff, seine Füße steckten in klobigen Schuhen, und was Giacomos Maskerade nicht bewerkstelligen konnte, hatten mittlerweile die Luft in den Gängen und die schwere Arbeit besorgt: Schweiß stand ihm auf der Stirn und das Hemd klebte ihm feucht am Körper, Staub hing ihm in den Haaren. Verräterisch waren nur die Augen, deshalb vermied er den offenen Blick, ließ einige Haarsträhnen in die Stirn fallen und strich sie nur gelegentlich mit dem Handrücken zur Seite, seine Mundwinkel hingen mürrisch herunter. Er legte es nicht darauf an, mit anderen Dienern ins Gespräch zu kommen, er wollte sich lediglich ungestört und vor allem von den Herrschaften ungesehen im Schloss umschauen.
Die Pause war zu Ende und jeder nahm seine Arbeit wieder auf. Nun ging es weniger hektisch zu als am Morgen, und er hoffte, sich leichter absetzen zu können. Allmählich hatte er sich auch die nötige Orientierung verschafft, nun traute er sich zu, nicht nur die Gemächer des Ermordeten rasch zu finden, sondern ebenso schnell wiederum fliehen zu können.
Vorsichtig öffnete er mit dem Dietrich die Tapetentür und lugte in Diethards Arbeitsraum. Das Zimmer war leer, Sondheims Verfügung kam ihm entgegen. Kurz überlegte er, ob er den Korb hinein schaffen sollte, was eine schnelle und vor allem unbemerkte Flucht erschwerte. Das Risiko musste er jedoch in Kauf nehmen, ein herrenloser Holzkorb im Gang neben einer verbotenen Tür war nämlich viel zu auffällig.
Der Tote war mittlerweile weggeschafft worden, auch sonst wirkte das Zimmer aufgeräumt. Und die Papiere waren fort, verdammt! Sondheim war ihm doch zuvorgekommen!
Della Motta machte sich an den Schreibtisch, vielleicht war ja noch irgendetwas zu retten. Eine Schublade war abgesperrt, ebenfalls kein Hindernis für seinen Dietrich, er zog sie auf und sortierte die darin befindlichen Gegenstände. Das Siegel, ein Stundenbuch, ein seltsam geformter Metallgegenstand, der einem Zahnrad ähnlich sah. Ein Bündel Briefe, mit einer blauen Schleife zusammengebunden. Die nahm er an sich, ebenso das Metall, und schob die Lade zu. Warum schloss man eigentlich ein Gebetbuch weg? Er öffnete die Lade nochmals.
Nur das Siegel ließ er an seinem Platz, dafür hatte er keine Verwendung. Um Diethards Korrespondenz zu fälschen, kannte er ihn und seine Gewohnheiten nicht hinreichend. Aber war es glaubwürdig, dass lediglich das Siegel sich in dieser Lade befand? Er sollte falsche Fährten legen, alles, was unter Verschluss war, erhielt Bedeutung und würde den Herzog eine geraume Zeit beschäftigen. Einige Briefe aus einer anderen Lade schienen ihm dafür geeignet, dann sperrte er wiederum zu.
Und was, wenn Sondheim schon am Schreibtisch gewesen war und den Inhalt der verschlossenen Lade selbst manipuliert hatte? Befand della Motta sich jetzt im Besitz falscher Beweise? Darauf musste er es ankommen lassen.
Er blickte sich im Raum um und überlegte, was er sich als Nächstes ansehen sollte. Die Laden der Konsole enthielten nichts Interessantes, die Uhr darauf war auf halb zehn stehen geblieben, weil niemand daran gedacht hatte, sie aufzuziehen. Ein Toter brauchte keine Zeitangabe. Hinter den Gemälden war nichts, ebenso wenig unter dem Teppich.
Della Motta rief sich ins Gedächtnis, wo der Diethard gelegen war, und bewegte sich einmal von der offiziellen Türe, dann wieder von der Tapetentüre aus auf die Stelle zu. Der Prinz war ungefähr so groß gewesen wie er selbst, das Stilett stak in der Brust, also musste der Täter etwas kleiner sein, sonst stimmte der Winkel nicht. Und er musste etwa von hier aus …
Stimmen! In der Antichambre! Und Schritte! Della Motta fuhr herum, sprang zu seinem Korb hinüber und riss ihn in die Höhe. Zu hastig, einige Holzscheite kollerten auf den Boden und er sammelte sie rasch ein. Verflucht, dort drüben war noch eins, er packte es und sah gleichzeitig, wie sich die Klinke rasch nach unten bewegte. Mit Schwung flog die Tür auf, er starrte auf zwei Soldaten und in Sondheims überraschtes Gesicht!
»Fasst ihn!«, bellte der Herzog sofort. »Er darf nicht entkommen!«
Die beiden Soldaten stürzten sich schon auf ihn, er warf ihnen den Korb entgegen und sprang durch die Tapetentür, rannte nach links, den Gang entlang. Hinter sich hörte er Lärm und gebrüllte Befehle, im Nu wimmelte es von Soldaten. Immer nach unten fliehen, doch über die Stiegen kamen auch Soldaten herauf, mit gezogenem Säbel. In eine andere Richtung, um die Ecke, den anderen Gang entlang, nochmals Richtung wechseln, die Gegner verwirren, sie abhängen. Es funktionierte nicht, die Schritte kamen näher. Etage wechseln, dann eben nach oben! Dritter Stock, auch da überall Soldaten, hinter ihm her oder ihm entgegen. Doch Gewalt!
Er fühlte heißen Atem im Nacken und riss das Messer aus dem Hemdsärmel, wirbelte herum, zog die scharfe Klinge über ein Gesicht. Das Gebrüll rief die anderen herbei, er entriss dem Verletzten den Säbel. Fort! Verdammt, wo war er? Lauter Sackgassen, wieder umkehren, nach rechts! Er keuchte, stolperte vorwärts, hinter ihm Schritte, um ihn herum! Doch hinunter, die Stiege war jetzt frei ... Aaaahh! Hinterhältiges Pack! Kopf einziehen, abrollen, er schlug auf dem Treppenabsatz auf und sein Atem raste! Soldaten trampelten die Stufen herunter, jetzt hatte er den Säbel, aber es waren zu viele, zwei könnte er töten, aber nicht fünfzehn! Wieder weiter, seine Beine zitterten. Durchhalten! Immer dieses verdammte Geräusch, überall Laufschritt und Soldatenstiefel! Dort hinten lag die Küche, drei Gänge noch, dort ging es ins Freie! Verflucht, wieder versperrt! Zurück ins Dunkel.
Luft! Loslass...!
Man presste ihm eine Hand auf den Mund, eine andere krallte sich um seinen Hals, verzweifelt trat er, schlug nach den Kerlen, wenigstens den Hals freibekommen! Der Druck ließ nicht nach, sie entwanden ihm den Säbel und zerrten ihn in eine Kammer.
Hastig knöpfte der eine Soldat seine Uniformjacke auf, der zweite blickte della Motta in die Augen und nickte ihm zu. Der dritte lockerte vorsichtig den Griff.
»Eure Kleider! Schnell!«
Er atmete schwer und stoßweise, aber sein Gehirn arbeitete rasch. Er schlüpfte aus Hemd und Hose, legte die Uniform an, vertauschte die plumpen Schuhe gegen die Stiefel und setzte die Perücke auf. Streifte die Handschuhe über. Hoffentlich fielen die Bartstoppeln nicht auf. Dann fesselten sie den bisherigen Besitzer der Uniform, leicht und ohne ihm Unannehmlichkeiten zu bereiten. Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme, die ihn bei vorzeitiger Entdeckung von jedem Verdacht reinwaschen sollte. Denselben Zweck erfüllte ein lockerer Knebel, niemand sollte dem Soldaten vorwerfen können, nicht um Hilfe gerufen zu haben.
Jetzt nahmen die zwei echten Soldaten den falschen in die Mitte und marschierten mit ihm im Eilschritt durch die Gänge, öffneten eine Pforte und brachten ihn ins Freie. Kaum an der frischen Luft, änderten sie ihren Gang, nun hasteten sie nicht mehr auf der Suche nach einem flüchtigen Einbrecher, sondern gingen mit größter Selbstverständlichkeit über den Hof, auf die Stallungen zu. Zu dritt ritten sie an der Torwache vorbei, salutierten und machten sich auf ihre Streife durch die Stadt.
Diese führte sie nicht allzu weit, am Dienstboteneingang eines großen Palais wurde der Marchese in Empfang genommen, während seine Retter sich wieder ins Schloss begaben, um einen flüchtigen Spion zu jagen.
»Bravo, Ihr gebt einen schmucken Soldaten ab!« Der Kardinal klopfte della Motta vergnügt auf die Schulter.
»Das war knapp. Ich danke Euch.«
»Ich hatte so eine Ahnung, dass Ihr Rückendeckung brauchen könntet. Leider wart Ihr für Walter zu schnell. – Ein Lakai, der Euch bei Entdeckung sofort ins Freie bringen sollte«, fügte er erklärend hinzu. »Aber wie ich höre, seid Ihr so rasch geflohen, dass er nicht die mindeste Chance hatte, einzugreifen. Man sagt, mit besserer Ortskenntnis wärt Ihr sogar entkommen.« Der bewundernde Ton, den er anschlug, war Ressau selbst peinlich und über die Messerattacke auf den Soldaten sprach er lieber nicht. Obwohl er sie von Anfang an gespürt hatte, ja sich gerade aus diesem Grund mit dem Marchese verbündet hatte, war ihm die Gewaltbereitschaft seines Komplizen nicht geheuer. »Hattet Ihr diesmal mehr Erfolg?«, fragte er absichtlich ruppig, um seine Selbstachtung wiederherzustellen.
Wortlos langte della Motta in den Rock und legte mehrere Gegenstände auf den Tisch: Ein Bündel Briefe, ein Brevier und ein eigenartiges Metallstück. Unwillkürlich griff Ressau zuerst nach dem Stundenbuch und wog es in der Hand. Seltsam! Mit einem Kopfschütteln wandte er sich den Briefen zu. Allein schon die blaue Schleife, mit der sie zusammengebunden waren, sagte ihm, was er von ihnen zu halten hatte, und ein flüchtiger Blick auf den Inhalt gab ihm Recht. Warum in aller Welt hatte der Marchese einen Haufen Liebesbriefe gestohlen? Wieder ein Fehlschlag.
»Wieso gerade diese Dinge?«
»Sie befanden sich in der einzigen versperrten Lade.«
»Dann ist Euch der Herzog zuvorgekommen. Er hat den Inhalt vertauscht und Euch einen Stapel wertlosen Liebesgesülzes untergeschoben.«
»Und das Stundenbuch? Ein alberner Scherz?«
»Anzunehmen. Ich frage mich nur, woher er es nahm. Das letzte Buch, das ich in Diethards Besitz vermutet hätte, ist ein Brevier.«
»Nicht wahr? Die Abhandlung über die Volksaufklärung und dann das Gebetbuch. Mir will sich einfach der Zusammenhang nicht erschließen.«
»Da gibt es auch keinen. Diethard war ausgesprochen unreligiös. Es kann ihm nicht gehören.«
»Also ein Täuschungsmanöver?«
»Natürlich.«
»Nur einmal angenommen, der Herzog war doch noch nicht am Schreibtisch: Vielleicht bewahrte der Prinz das Gebetbuch eines anderen auf?«
Ressau seufzte. Der konnte eine Niederlage wohl nicht wegstecken! Nicht genug, dass er abermals gescheitert war, war er auch noch ein schlechter Verlierer und wollte nach den wertlosen Briefen wenigstens dem Brevier ein Geheimnis abringen. Aber bitte, es schadete zumindest nicht, wenn er das Buch genauer prüfte, es nach Kommentaren oder sonstigen Zeichen durchsuchte. Ressau verglich es sogar mit seinem eigenen, stellte die beiden Zeile um Zeile gegenüber, konnte aber keine Abweichung feststellen.
Unterdessen widmete sich Visconti erneut den Briefen und weigerte sich, auch sie so einfach abzuschreiben: »Der Schrift nach immer dieselbe Dame. Aber sie bleibt anonym, zeichnet nur mit ›die Ihrige‹, ›Eure ergebene Freundin‹, ›Euch in Liebe verbunden‹ und so weiter.«
»Ich sage ja, wertloses Zeug!«
»Vielleicht doch nicht. Seht her!«
Der Marchese reichte ihm einen Brief und wies ihn auf eine bestimmte Stelle hin. Die Schreiberin schilderte einen Unfall, eine Schlange hatte ihr Pferd scheuen lassen, und sie dadurch in höchste Gefahr gebracht. Sie ereiferte sich über diese kriechenden Kreaturen, diese doppelzüngigen Geschöpfe.
»Sehr anschaulich. Aber inwiefern soll uns das nützen?«
»Vergleicht es mit dem hier! Und dem.«
Lauter ähnliche Stellen, in denen von Windungen, von geschmeidigen Würmern und schuppigen Ekeln die Rede war.
»Na und? Die Geliebte des Prinzen scheint eine ausgesprochene Abneigung gegenüber Schlangen zu hegen.«
»Ja, aber erst ab dem vierten Brief. Davor ist nur die Rede von heimlicher Verehrung, von Wahrheiten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.«
»Also von der Offenbarung ihrer Liebe.«
»So soll es zumindest aussehen. Wusstet Ihr, dass man auf dem Markt von Brüdern der Schlange redet?«
Nur ungern gab Ressau zu, dass seine Spitzel hier offenbar versagt hatten: »Wer soll das sein?«
»Ich hatte gehofft, Ihr könnt mir das sagen.«
»Was genau erzählt man sich denn?«
»Dass die Schlangenbrüder bald wegen Leopolds Tod kämen.«
»Um ihn zu rächen?«
»Möglich.«
»Dann stehen die Wittelsbacher hinter dieser Gruppe.«
»Deren Interesse ist doch offensichtlich, die würde man beim Namen nennen.«
»Ihr denkt an eine Geheimgesellschaft. Politisch?«
»Politisch, philosophisch, religiös, alles was Euch einfällt.«
»Hm, religiös sagt Ihr ...«
»Was?«
»Es mag ein bisschen weit hergeholt sein, aber es ging einmal das Gerücht, dass in einer nahe gelegenen Ruine satanische Kulte zelebriert werden.«
»Teufelsanbeter? In Deutschland? Im achtzehnten Jahrhundert?«
»Ein Gerücht, wie gesagt.«
»Und? Seid Ihr ihm nachgegangen?«
»Man fand nichts. Aber in der Umgebung der alten Burg sammeln die Kräuterfrauen gerne Pflanzen. Ihr wisst ja, wie schnell der Aberglaube aus den heilkundigen Frauen Hexen zu machen pflegt.«
»Und die Kirche. Brachte man sie in Verbindung mit Schlangen?«
»Nein. Aber denkt doch an Satans Gestalt in der Genesis!«
»Ihr habt Recht. Wenn es hier tatsächlich eine satanische Sekte gibt, könnten die Briefe verschleierte Informationen über sie enthalten.«
»Der Bericht einer Spionin?«
»Oder eines Spions. Hier, die Schrift ist ebenmäßig, sehr schön. Weiblich. Fast zu weiblich.«
»Das könnt Ihr erkennen?«
»Es wurde nicht zügig geschrieben, eher gemalt. Der oder die Schreiberin hat viel Mühe darauf verwandt, der Schrift ein gefälliges Bild zu geben. Das steht aber an manchen Stellen im Widerspruch zum Inhalt, wie etwa hier beim Erlebnis mit dem Schlangenbiss. Bei der Schilderung einer echten Gefahr wäre die Feder doch wesentlich schneller über das Papier geführt worden.«
Das machte Sinn.
»Und das Brevier könnte ebenso Tarnung für etwas anderes sein.«
Also machten sie sich ein weiteres Mal über das Buch her, doch sie konnten es drehen und wenden wie sie wollten, sie vermochten nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Und dennoch ließ sich der Marchese nicht davon abbringen, dass mit dem Gebetbuch etwas nicht stimmte. Über den dritten Gegenstand hatten sie bislang nicht gesprochen. Das seltsame Metallstück ergab weder für Ressau, noch für della Motta Sinn, auch dieses Ding erhielt seine Bedeutung erst durch die Aufbewahrung in der verschlossenen Lade. Ihr einziger Anhaltspunkt blieben vorerst die Briefe. Und die zu decodieren erforderte viel Zeit, Zeit, die sie zumindest an diesem Tag nicht mehr hatten. Ressau sah della Motta zwar an, dass er nur zu gerne weitergearbeitet hätte, doch im Theater sollte erstmals die italienische Primadonna auftreten, ein Ereignis, das er sich auf keinen Fall entgehen lassen wollte.
Der Marchese machte Anstalten, die entwendeten Sachen wieder an sich zu nehmen, doch das gab Ressau nicht zu. Sie waren Komplizen, aber die Führerschaft überließ er dem Anderen gewiss nicht. Im Gegenteil, wollte er ihn tatsächlich benutzen, musste er aufpassen, dass der den Spieß nicht umdrehte. Ihm das Gefühl von Überlegenheit zu geben und ihm tatsächlich eine Machtposition einzuräumen, war zweierlei. Nach einigem Hin und Her einigten sie sich darauf, die Beute zu teilen, der Marchese erhielt die erste Hälfte der Papiere und das Brevier, an dem ihm so viel gelegen war.
Ressaus Augen blieben an der Hand hängen, die die Gegenstände zusammenraffte, er folgte den Fingern, wie sie sich der Brust näherten und die Sachen in den Rock schoben. Die Uniform stand dem Mann gut, sie unterstrich seine Figur und betonte die Schultern. Die dunklen Bartstoppeln gaben dem Gesicht etwas Verwegenes. Und ohne sein Zutun brach es aus Ressau hervor: »Wollt Ihr heute im Theater mein Gast sein?«
4
Charlotte von Rostow fand Sophie in ihrem Ankleidezimmer, wo sie trotzig ihr Spiegelbild anfunkelte.
»Ich hasse dieses Kleid!«
»Die strenge Trauerzeit ist bald vorüber.«
»Wie lange denn noch! Wie lange muss ich Trübsaal blasen, obwohl die ganze Welt weiß, dass ich Leopold nicht ausstehen konnte?«
»Sophie!« Die Gräfin wählte einen Ton, der den Vorwurf mit sehr viel Geduld und Verständnis abmilderte. Die Prinzessin war jung, wer konnte es ihr übel nehmen, dass sie mit zwanzig Jahren nicht die trauernde Witwe spielen wollte? Der Herzog hatte die Ehe mit Leopold arrangiert, aber die Gräfin wusste, wie sehr Sophie unter der Verbindung gelitten hatte. Die Hochzeitsnacht war ein Schock für sie gewesen und auch später kam Leopold mit entnervender Regelmäßigkeit in Sophies Schlafzimmer, um seine Rechte einzufordern. Und keinen kümmerte es, wie sehr sie sich vor diesem dicken, wesentlich älteren Körper ekelte. Erst als ihm der Herzog dann Caroline zuführte, ließ Leopold seine Frau endlich in Ruhe, es war eine der seltenen Gelegenheiten, in denen Sondheim Sophie einen Dienst erwiesen hatte.
Auch über die Mätresse musste Sophie noch eine Entscheidung treffen.
Als hätte sie ihre Gedanken gelesen, fragte die Prinzessin unvermittelt: »Meinst du, ich muss die Köchlin vom Hof verbannen?«
»Niemand würde dir einen Vorwurf machen. Du kannst dich aber auch als großzügig erweisen.«
»Immerhin hat sie mir meinen Mann vom Leib gehalten.«
Die behutsamen Bemühungen der Gräfin waren also auf fruchtbaren Boden gefallen. »Dann zeige dich gnädig, nur solltest du niemandem den wahren Grund dafür mitteilen. – Und jetzt komm, deine Damen warten!«
Sie trennten sich erst wieder im Theater, wo Sophie der Aufführung von der Fürstenloge aus beiwohnen würde. An diese schlossen sich die Logen des Herzogs und des Kardinals an, und es galt als fast ebensolche Ehre, Gast einer der beiden Würdenträger zu sein wie der des Fürsten. Ein Privileg, das jeder von ihnen nach strategischen Gesichtspunkten gewährte. Ob es sich um einen Diplomaten, eine schöne Dame, einen reichen Bürger oder einen Höfling handelte – wer in eine der Logen eingeladen wurde, genoss besondere Aufmerksamkeit.
Die Loge von Sophies Damen befand sich im zweiten Rang, und die Gräfin nahm vorne an der Brüstung Platz und ließ den Blick über den Zuschauerraum gleiten. Der Hof war fast vollzählig versammelt, abgesehen von der Fürstenfamilie war nur der Kardinal noch nicht erschienen. Auch die reichen Bürger waren hier, eben begrüßte Kaufmann Molden den Verleger Strack. Die Gattinnen der beiden waren vornehm herausgeputzt, wenngleich nicht ganz so kostbar wie die Hofdamen, reichen Bürgerinnen stand für den Theaterbesuch nur die Parure, der Halbputz zu.
Hinter sich hörte die Gräfin Männerstimmen, die Verehrer der anderen Damen hatten die Loge betreten. Fräulein von Mahr, die Jüngste in Sophies Hofstaat, erfreute sich besonderer Beliebtheit, ein naives Küken, das mit seinen fünfzehn Jahren noch nicht die geringste Ahnung vom Leben hatte. Und schon gar nicht von Männern. Wie sie sich in deren Bewunderung suhlte! Ihre Busenfreundin, die Tochter des Grafen von Polt, war nur zwei Jahre älter, und was sie hinter der Mahr an Schönheit zurückstand, glich sie durch Dümmlichkeit aus. Auch sie konnte sich nicht über Mangel an männlichem Interesse beklagen, das sie selbstgefällig auf sich bezog, während es in Wahrheit ihrem einflussreichen Vater galt. Da war die stille Frau von Bandau wesentlich angenehmer, auch sie war mit neunzehn Jahren noch jung, aber bereits verheiratet. Die fünfte im Bunde war die Gräfin von Minich, die ihr selbst vom Alter her zwar am nächsten stand, aber in ihrer Einfalt viel eher den Mädchen glich. Auch die Minich war verheiratet, mit Diethards Kammerherrn, für den nun eine neue Aufgabe gesucht werden musste.
Die Gräfin kümmerte sich nicht um das tändelnde Geschwätz, es war doch immer das Gleiche. Wieso hörten Frauen immer noch auf die Komplimente und Liebesschwüre von Männern, wann wurden sie endlich klüger? Sie war fertig damit, ein für alle Mal. Männer waren nur an einem interessiert, abgesehen von ihren Ränken, Jagden und ihrem Drang nach Selbstdarstellung. Alle waren sie gleich, die feinsinnigen wie die polternden, die schönen wie die hässlichen. Die letzte Mode war, sich philosophisch zu geben und als Kunstkenner aufzutreten. Intellekt hatte den stumpfsinnigen Hedonismus verdrängt, aber sie ließ sich nicht täuschen. Männer waren animalisch und primitiv, das Einzige, was sie an Frauen schätzten, waren ihre Körper und ihre Nachkommenschaft. Und oft nicht einmal die.
Ein Raunen ging durch den Zuschauerraum und pflanzte sich bis zu den oberen Rängen fort. Hatte bereits ... nein, die Fürstenloge war noch leer. Sie spürte, wie sich neben ihr die Gräfin von Minich anspannte und das Opernglas ans Auge hob, um besser sehen zu können. Die Mädchen versuchten, einen Blick über ihre Schulter zu erhaschen, und selbst die ruhige Bandau war plötzlich ganz aufmerksam. Molden tuschelte mit seiner Frau und wies ihr mit einer Kopfbewegung die Richtung. Alle sahen jetzt zur Loge des Kardinals.
Ressau hatte wie immer den besten Moment abgewartet, um sich der ungeteilten Aufmerksamkeit sicher zu sein, er hatte es immer schon verstanden, seinen Auftritt zu inszenieren. Wie er da stand mit seiner hohen Gestalt, angetan mit dem Kardinalspurpur, gut aussehend und stattlich, verstand sie die Gerüchte um seine Mätressenwirtschaft. Beweise dafür gab es freilich keine, aber Kirchenfürst hin oder her, auch er war ein Mann.
Und doch galten die Blicke nicht ihm, sondern dem Unbekannten, der neben ihm die Loge betreten hatte. Fast so groß wie der Kardinal, ebenso schlank, aber auf eine geschmeidige, kräftige Art. Sein graublauer Habit war aus kostbarem Stoff, silberdurchwirkt, der Schnitt ließ auf französische Machart schließen, während die Zopfperücke ein Zugeständnis an den deutschen Geschmack war. Der Haltung nach zu urteilen, war er es gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen, er zeigte keine Spur von Verunsicherung oder Verlegenheit. Er tat, als merke er gar nicht, dass er sich im Zentrum der Aufmerksamkeit befand, trug eine distinguierte Miene zur Schau und ließ seinen Blick blasiert und ziellos über den Raum schweifen.
Das aufgeregte Gegacker der jungen Hühner hinter ihr war nicht auszuhalten.
»Wer ist das?«
»Ich weiß nicht.«
»Wie gut er aussieht!«
»Ob er länger hier bleibt?«
»Vielleicht sogar bis zum Ball?«
»Dann tanzt er bestimmt mit dir.«
»Meinst du? Oh hoffentlich hast du Recht!«
»Könnt Ihr nicht einmal an etwas anderes denken?«, schalt sie die beiden entnervt.
»Wisst Ihr, wer das ist, Gräfin?«
»Was kümmert es Euch? Ein Gast des Kardinals, und damit außerhalb Eurer Reichweite.«
Dass er Ressaus Gast war, war das Einzige, was sie an ihm interessierte. Dass er adlig war, sagte ihr die Hofgala, die er trug. Kein Bürger hätte es gewagt, in Grande parure zu erscheinen, und auch, dass er kein Abgesandter der Kirche sein konnte, verriet seine Aufmachung. Sie hatte nichts von einem hohen Besuch aus dem Ausland gehört, und zum hiesigen Hof zählte er nicht. Wenn der Kardinal aber jemanden zu sich in die Loge bat, steckte immer etwas Wichtiges dahinter. Es war Grund genug, den Fremden im Auge zu behalten.
Auch der Herzog beobachtete den Auftritt, mit dem er fest gerechnet hatte. Natürlich wieder wie aus dem Ei gepellt, die Schneiderrechnung dieses Beaus musste gigantische Höhen erreichen. Kaum zu glauben, dass er wenige Stunden zuvor noch als Holzknecht herumgelaufen war. Er hatte ihn nur flüchtig gesehen, hätte ihn beinahe nicht erkannt, wären da nicht diese seltsamen Augen gewesen. Die Damenwelt tat ganz verrückt, bei ihr schien dieser Geck ja gut anzukommen. Und bewusst war sich der Kerl seines Erfolges durchaus, genoss ihn, auch wenn er versuchte, sich die Aura des Unbeteiligten zu geben. Diese unerträgliche Arroganz!
Glücklicherweise erschien jetzt die Fürstenfamilie und zog die Blicke auf sich. Gar nicht gut sah der Fürst aus. Wie viel Zeit blieb wohl noch, um nach Diethards Ermordung die Strategie neu auszurichten? Wen konnte Sondheim Karl entgegensetzen? Die mannstolle Katharina vielleicht? Oder Sophie, dieses Kind? Die ersten Akkorde rissen ihn aus seinen Gedanken, und er konzentrierte sich auf die Bühne, die Kulisse zeigte einen Tempel an der Küste von Tauris. Gluck wieder einmal, sollte ihm recht sein. Die Sängerin der Iphigenie interessierte ihn weit mehr. Anna Ranieri war eine berückend schöne Frau, endlich etwas fürs Auge, die Musik war Sondheim nämlich herzlich egal.
Ein leichter Luftzug verriet ihm, dass jemand die Loge betreten hatte, noch bevor ihm ein Lakai das Billett reichte. »Während Orests Wahnsinn auf dem Schnürboden.« Wieder nur eine einzige Zeile, keine Unterschrift, aber ein Siegel. Eine sich windende Schlange! Sondheims Herz schlug schneller.
Dass die entsetzlichen Arien immer so lange waren, wann kam endlich diese Wahnsinnsszene? Ein griechischer Muttermörder, seine von Artemis entführte Schwester, alles antiker Mumpitz! Was interessierte ihn das, wenn sein geheimnisvoller Besucher in der Oper war! Na endlich, Orest sang um seinen Verstand, und Sondheim verließ die Loge.
Er war nicht zum ersten Mal hinter der Bühne, und niemand dachte daran, ihn aufzuhalten. Das hätte er auch keinem geraten und unbehelligt stieg er die schmale Treppe hinauf. Der eigentliche Schnürboden bestand aus einer Unmenge an Seilen und Zügen, an denen die Kulissenbahnen befestigt waren, die Seile liefen über Rollen und Schlitten, und kein vernünftiger Mann würde ein Gespräch auf solch einem Schlitten führen. Während Sondheim noch überlegte, dass wohl der darüberliegende Rollenboden gemeint war, trat plötzlich ein Mann aus dem Dunkel, fasste ihn am Arm und zog ihn eine Etage höher.
Von keinem anderen hätte Sondheim diese Behandlung geduldet! Doch das war der Mann, der ihn vor dem Marchese gewarnt hatte. Und ein Feind des Marchese war ein potenzieller Verbündeter. Der Unbekannte war in einen Domino gehüllt und trug eine venezianische Maske, ein weiteres Ärgernis. »Was soll dieses Versteckspiel, wer seid Ihr?«, blaffte Sondheim statt einer Begrüßungsfloskel.
»Ein Feind des Marchese.« Der starke italienische Akzent war nicht zu überhören. Als ob einer von dieser Sorte nicht schon reichte!
»Das legte bereits Eure erste Botschaft nahe.«
»Visconti darf auf keinen Fall sein Ziel erreichen!«
»Und Ihr kennt dieses Ziel?«
»Euch zu stürzen.«
»Ha, er wäre nicht der Erste, der das versucht. Aber er kennt mich gar nicht, weshalb sollte er meinen Sturz wollen?«
»Er muss Euch nicht kennen, er hat einen Auftrag.«
»Von wem? Vom Papst?«
»Wie kommt Ihr auf den Papst?«
»Warum macht er wohl sonst gemeinsame Sache mit dem Kardinal?«
»Es geht um großen Einfluss und Macht.«
»Also ist sein politisches Desinteresse doch nur Fassade?«
»Visconti ist kein Politiker, sondern ein Spion. Und ein Intrigant allererster Güte, nehmt Euch vor ihm in Acht!«
»Das habt Ihr mir bereits einmal empfohlen. Haltet Ihr mich für einen Anfänger?«
»Ihr dürft ihn auf keinen Fall unterschätzen!«
»Lassen wir das! Also er will meinen Platz einnehmen?«
»Ich habe es Euch bereits gesagt, er ist kein Politiker. Er wird verschwinden, sobald seine Mission erfüllt ist.«
»Was wisst Ihr über ihn, außer, dass er gefährlich ist?«
»Sein Vater stammt aus Oberitalien, wo er auch seine Güter hat. Er wurde von Jesuiten erzogen, studierte in Bologna die Rechte und widmete sich dann der Philosophie. Die Freimaurer wurden auf ihn aufmerksam, später die Illuminaten.«
»Della Motta ist ein Illuminat?«
»Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.«
»Und da kollaboriert er mit dem Kardinal?! Und wie passt das überhaupt zu seiner jesuitischen Erziehung?«
»Ihr vergesst, dass er ein Spion ist. Vielleicht hat er den Illuminaten ja weisgemacht, dass er abtrünnig ist, und vielleicht lässt er die Jesuiten glauben, er forsche den Geheimbund nur aus.«
»Ist er käuflich?«
»Nein, denn er ist reich. Ihn reizt die Macht, aber nicht die politische, sondern die Fähigkeit, Menschen zu manipulieren. Seinen Willen und seine Ideen durchzusetzen. Für ihn ist alles ein Spiel und er spielt es mit sehr hohem Einsatz.«
»Jeder Mann hat einen wunden Punkt, welcher ist seiner?«
Die Stimme des Vermummten änderte sich, sie verlor ihren neutralen Ton und nahm ein verächtliches Zischen an: »Er ist unglaublich eitel und steht unter dem Zwang zu gefallen. Und er hat eine Leidenschaft für schöne Frauen.«
»Sagt mir etwas, das ich nicht bereits weiß!«
»Er ist in höchstem Maße ungeduldig. Mit anderen und mit sich selbst.«
»Wie äußert sich diese Ungeduld? Verliert er das Interesse?«
»Eher seine Selbstbeherrschung.« Sondheim hätte schwören mögen, hinter der Maske ein verschlagenes Grinsen wahrzunehmen. In der Tat war die Unfähigkeit, seine Gefühle zu verbergen, am Hof eine tödliche Schwäche. Wer durchschaubar war, war leicht zu eliminieren. »Er benutzt andere, aber er hasst es, selber Werkzeug zu sein.«
»Dann könnte seine Allianz mit dem Kardinal auf diesem Weg gesprengt werden.«
»Gebt ihm das Gefühl, dass nicht er den Priester manipuliert, sondern dass er nur dessen Marionette ist, und er wird ihm in den Rücken fallen.«
»Wie kommt es, dass Ihr solche Dinge über ihn wisst?«
»Unsere Wege kreuzten sich vor einiger Zeit«, brummte der andere. Mittlerweile ließ er sich seinen Hass nicht mehr so deutlich anmerken. »Dabei lernte ich ihn ziemlich gut kennen.«
»Und was ist der Grund für Eure Feindschaft?«
»Der tut nichts zur Sache.«
»Ihr habt mir von Viscontis Bildung erzählt, aber die allein macht ihn noch nicht zum Spion. Er ist einer ganzen Kompanie entkommen, das muss er doch irgendwo gelernt haben.«
»Oh ja, er hatte hervorragende Lehrer.«
»Wie sieht es mit Gewalt aus? Würde er töten?«
»Auf jeden Fall. Bevor er ein Ziel verloren geben muss, mordet er.«
»Er kann also nicht verlieren.«
Abermals hatte Sondheim den Eindruck, dass die Miene hinter der Maske einen boshaften Ausdruck annahm, nun klang die Antwort eindeutig rachsüchtig: »Nein, das kann er nicht. Aber diesmal wird er es. Dazu bin ich hier.«
Dass es sich um eine persönliche Rechnung handelte, die der Unbekannte mit dem Marchese offen hatte, war Sondheim längst klar. Ihm konnte es gleich sein, solange er davon profitierte.
»Ihr wollt mir also helfen, den Marchese zu Fall zu bringen?«
»Im Gegensatz zu den Diensten Viscontis sind meine käuflich.«
Jetzt war die Katze aus dem Sack! »Und was würde mich das kosten?«
»Zehntausend Reichstaler.«
»Ihr seid verrückt!«, rief Sondheim empört, obwohl er für die Unterstützung sogar das Doppelte bezahlt hätte. »Was weiß ich schon über Euch? Ihr habt eine persönliche Differenz mit einem Meisterspion, den Ihr über die Klinge springen lassen wollt. Dafür soll ich Euch nicht nur als Vorwand dienen, sondern Euch Eure Rache auch noch vergolden.«
»Ihr zieht nur in Betracht, was der Marchese ist. Das allein rechtfertigt bereits den Preis. Doch Ihr wisst nichts über mich.«
»Ihr habt es ja vorgezogen, Eure Identität nicht zu lüften. Also wer seid Ihr?«
»Nicht wer seid Ihr, sondern was seid Ihr? Wer kann einen Spion zur Strecke bringen? Doch nur einer, der denkt wie ein Spion. Der dasselbe gelernt hat wie er.«
»Ihr wollt mir damit doch nicht etwa sagen, dass auch Ihr einer seid?«
»Der beste.«
Das war nun freilich eine kühne Behauptung. Spione gab es in Europa zur Genüge, warum sollte sein Gesprächspartner also keiner sein? Aber war er dem Marchese tatsächlich überlegen? War er ihm wenigstens ebenbürtig? Andererseits schien er ihn zu kennen, also konnte er nicht vollkommen nutzlos sein.
»Fünftausend.« Er stellte sich auf Verhandlungen ein, zu seiner Überraschung nahm der Fremde jedoch sofort an. War der Preis etwa doch zu hoch? »Zweitausend morgen früh bei mir, den Rest, wenn Ihr Erfolg hattet.«
Das war dem Kerl nun keineswegs recht, aber Sondheim gab nicht nach.
»Braucht Ihr sonst noch etwas? Zugang zum Hof?«
»Für den Augenblick nicht. Und niemand darf etwas von meiner Existenz erfahren, am allerwenigsten der Marchese.«
»Mein Pförtner hat Euch gesehen.«
»Der kennt nur einen Boten, den er nicht einmal voll zu Gesicht bekam. Macht Euch um ihn keine Sorge. Weiß sonst noch jemand von mir?«
»Mein Sekretär hat Eure Botschaft gelesen.«
»Belasst es dabei! Es ist besser, wenn ich im Dunkeln arbeite. Was habt Ihr in Bezug auf den Marchese bereits unternommen?«
»Auftrag gegeben, sein Personal zu infiltrieren.«
»Sollte mich wundern, wenn es Euch gelingt. Er ist äußerst vorsichtig und vertraut nur seinem Kammerdiener.«
»Das ist ärgerlich, denn ich vermute ihn im Besitz von wichtigen Dokumenten.«
»Welche Art von Dokumenten?«
»Das weiß ich eben nicht. Er hat sie heute gestohlen.«
»Ja, er ist verdammt schnell.«
»Ihr wisst davon?«
»Ich bin ein Spion.«
»Wie kann ich Euch finden?«
»Ich finde Euch.«
Das kam gar nicht in Frage, der tat ja geradezu, als ob er nach Belieben mit einem Ersten Minister umspringen könne. Waren alle Spione so überheblich? »So läuft es nicht, wenn Ihr für mich arbeitet. Ich bezahle Euch, also will ich Euch auch erreichen, wenn ich es für richtig halte.«
»Wenn es unbedingt sein muss, dann schickt dem Wirt vom ›Goldenen Fass‹ eine Nachricht für Christoph. Aber seht zu, dass man Euch dort nicht sieht und dass der Brief keine Rückschlüsse auf Euch zulässt. Zeichnet mit V. Der Inhalt der Botschaft ist egal, tarnt Euch als Viehhändler, bestellt Schweine oder Ziegen. Wenn ich eine Nachricht erhalte, suche ich Euch auf, sobald es sicher und unbeobachtet geschehen kann. Aber vertraut dem Schreiben niemals das an, was Ihr mir tatsächlich sagen wollt!«
Allmählich glaubte der Herzog doch, mit einem Spion zu sprechen, ein normaler Mensch hätte sich wohl kaum solche übertriebenen Vorsichtsmaßnahmen ausgedacht. Es sollte ihm recht sein. Immerhin galt es, einem anderen Spion das Handwerk zu legen.
5
Ressau beobachtete della Motta von der Seite. Die halb geschlossenen Augen, die rechte Hand, die locker auf dem Oberschenkel lag, und deren Finger mit winzigen Bewegungen die Musik begleiteten, einmal leise den Takt mitklopften oder einen Akkord mit einem nachdrücklichen Streichen bekräftigten. Der Körper des Marchese schien sich die Musik anzueignen, und Ressau ertappte sich, dass er im Einklang mit ihm die Luft anhielt, die Spannung genoss und am Ende der Phrase den Atem langsam verstreichen ließ. Von allen seinen Gästen war dies der erste, den die Musik offenbar berührte. Die letzten Töne verebbten, und während aus den Nachbarlogen schon stürmischer Beifall erklang, schien della Mottas Blick erst aus weiter Ferne zurückzukehren.
»Vortrefflich!«, beugte sich Ressau heftig applaudierend zum Marchese. »Ist die Ranieri nicht herrlich?«
Der Italiener gab sich einen Ruck, sein Auge wurde wieder klar, und er richtete sich noch eine Spur gerader auf, spendete nun auch klatschend Anerkennung. »Der Fürst kann sich glücklich schätzen, sie für sein Theater engagiert zu haben. Wie lange soll sie bleiben?«
»Vorerst eine Saison. Wir werden beim Empfang noch Gelegenheit haben, mit ihr zu sprechen.«
»Es sollte mich wundern, wenn sich die Gespräche um die Musik drehten.«
»Ihr habt Recht, die Spekulationen um Diethards Tod werden dem Auftritt der Primadonna ernsthafte Konkurrenz machen.«
»Ohnehin ist es sonderbar, dass diese Aufführung stattfand, solche Vergnügungen so kurz nach dem Tod eines Prinzen sind doch höchst unschicklich. Ich hätte damit gerechnet, zumindest die Fürstenloge leer zu sehen.«
»Ihr kennt eben die Verhältnisse dieser Familie nicht. Unter den Kindern von Serenissimus herrscht offene Feindschaft, keiner gibt sich auch nur Mühe, das zu verbergen. Und Diethard war ein Aufklärer, der mit seinen fortschrittlichen Ideen weder bei seinem Bruder, noch beim Herrscher auf Gegenliebe stieß.«
»Unterschiedliche politische Auffassungen können auch Gründe für einen Mord sein.«
»Aber doch nur bei einem Thronerben. Karl wird Fürst, Diethard hätte keinen Einfluss gehabt.«
»Gerade deshalb. Diethard war nur der Zweite in der Thronfolge, seine modernen Ideen konnte er nur dann umsetzen, wenn er seinen Bruder rechtzeitig beseitigte. Und Karl beeilte sich, dieser Gewalttat zuvorzukommen.«
»Auf keinen Fall! Das ergibt keinen Sinn. Nein, nein, nein, es ist absolut unmöglich. Karl ist fromm, er würde sein Gewissen nicht mit einem Mord belasten!«
»Und doch kann Angst eine sehr starke Motivation sein.«
»Vergesst Karl, er war es nicht!«
»Wohl, weil es Euren Interessen zuwider läuft?«
Das musste sich Ressau nicht bieten lassen, diesen sarkastischen Ton, den abfällig verzogenen Mundwinkel konnte sich della Motta vielleicht dem Herzog gegenüber herausnehmen, aber sicher nicht ihm! Abrupt drehte er sich um und verließ die Loge. Das Achselzucken des Marchese konnte er nicht mehr sehen, aber umso deutlicher fühlen. Er spürte della Motta hinter sich, seine Aura herablassender Nachsicht. Nachsicht!
Niemand brauchte von ihrem Zwist zu wissen, schon gar nicht der Herzog, also gab Ressau sich unbefangen, doch kaum saßen sie allein in der Kutsche, wandte er sich brüsk ab. In der Kutsche war es kalt, aber es lagen Pelze bereit und heiße Ziegel, an denen sie sich die Füße wärmen konnten. Der Marchese zog die Felle eng um die Schultern, um sich einigermaßen vor dem Frost zu schützen, er mochte die Kälte sichtlich nicht. Wie war der bloß im russischen Winter zurechtgekommen?! Ressaus Schweigen schien ihn nicht zu stören, versonnen sah er seinem Atem nach, der in der Kälte gefror und Wölkchen bildete. Er würde gewiss nicht einlenken, aber auch Ressau hatte seinen Stolz.
Irgendetwas schien mit della Mottas Schuh nicht zu stimmen, jedenfalls schälte er sich jetzt aus seinen Pelzen, beugte sich hinunter und überprüfte die Befestigung der Schnalle. Sein Kopf war in der Nähe von Ressaus Knie, nicht einmal eine Handbreit davon entfernt. Zwischen Perücke und Kragen zeigte sich ein schmaler Streifen nackter Haut.
Ressau sah zum Fenster hinaus, aber er konnte nicht anders, er musste sich zurückdrehen und auf die bloße Stelle schielen. Eine schwarze Haarsträhne lugte ein wenig unter der Perücke hervor, und er war versucht, sie zurück zu schieben. Della Mottas Atem strich an seinem Knie vorbei, kitzelte ihn, und Ressaus Oberschenkel spannte sich an.
Was tat der Marchese da nur so lange, der Schuh war doch vollkommen in Ordnung!
Ressaus Finger zuckten. Das wollte der doch, der legte es doch darauf an, dass er ihm das Haar zur Seite strich, der forderte die Liebkosung geradezu heraus! War es wirklich möglich?!
Aber Sodomie war verboten! Seine Hand verharrte wenige Zoll über der verlockenden Stelle, sein Puls raste. Da richtete sich della Motta plötzlich auf, in einer schnellen Bewegung zog Ressau die Hand zurück, und della Motta sah ihm mit einem offenen Blick in die Augen. Und gab vor, seine Verwirrung nicht zu bemerken.
Natürlich ließ sich der Herzog nichts anmerken, aber innerlich kochte er. Niemals hätte er es für möglich gehalten, wie leicht und schnell sich dieser unerträgliche Italiener in die Gunst der Herrscherfamilie schlich. Der Fürst lachte! Wann war das zuletzt geschehen? Dass Ressau diesem Schuft den Zutritt zum höchsten Kreis eröffnete, hatte Sondheim nicht verhindern können, und doch war der Weg von der ersten Vorstellung bis zum vertrauten Gespräch ein langer. Aber della Motta nahm ihn im Sturm! Er schien für jeden eine Sonderbehandlung parat zu haben, die Fürstin hing fasziniert an seinen Lippen, und ihr Gemahl amüsierte sich, wie schon lange nicht mehr. Ressau stand daneben, mit stolzgeschwellter Brust, als ob della Mottas Triumph auf sein eigenes Konto ging. Geradezu, als ob er eine atemberaubende Frau präsentierte, und der Glanz der Geliebten auf den Begleiter strahlte. Verrückter Pfaffe.
Dass die Frauen diesem Schönling zu Füßen lagen, konnte Sondheim ja gerade noch verstehen. Aber der Fürst?! Tatenlos musste er hinnehmen, dass der Marchese selbst den Herrscher, einen gestandenen Mann, verführte! Wo war die junge Korff, die wäre ihm jetzt gerade recht, um seine Wut abzukühlen! Frauen! Nie waren sie zur Hand, wenn man sie brauchte! Und wo blieb sein Köder, wann machte sie sich endlich an diesen Bastard heran? Heute noch sollte della Motta sie besitzen, sie der langen Liste seiner Eroberungen hinzufügen und als weiteren Beleg seiner Unwiderstehlichkeit betrachten. Der hielt sich bestimmt für einen Liebhaber vom Range Casanovas und kam nicht im Traum auf die Idee, dass er sich mit der Dame auch den Herzog ins Bett holte.
»Ich muss Euch tadeln, Marchese. Es ist nicht recht, Eure Gesellschaft auf den Fürsten zu beschränken. Hier gibt es auch andere Leute, die begierig auf eine Unterhaltung mit Euch sind.«
Unverblümte Worte, aus dem Mund einer betörenden Frau. Jeder Zoll an ihr strahlte Sinnlichkeit aus, und ihre Augen forderten della Motta offen heraus. Er verbeugte sich vor der Dame und maß etwas länger als nötig ihre üppige Gestalt, ihre geschmeidigen Bewegungen, die einem Mann höchste Wonnen verhießen. Jedem Mann oder ihm?
»Prinzessin Katharina, ich möchte euch Riccardo Visconti Marchese della Motta vorstellen«, übernahm der Kardinal die Formalitäten und bestätigte, was sich della Motta bereits gesagt hatte: Nur eines seiner Kinder durfte es wagen, die Unterhaltung des Fürsten zu stören. »Die Prinzessin ist der Liebling des Hofes und des Volkes.«
Katharina schenkte dem Kardinal einen geringschätzigen Blick und auch der Herzog verdrehte die Augen, Ressaus Kompliment fiel auf steinigen Boden. Aber es war noch etwas anderes in Sondheims Ausdruck, etwas, das della Motta stutzen ließ. Grausamer Hohn, und der galt nicht dem Kardinal, sondern ihm selbst.
»Folgt mir, Marchese!« Sie duldete keine Weigerung, der Fürst entließ ihn mit einem wohlwollenden Wink, und er bot der Prinzessin den Arm. »Ihr solltet mir dankbar sein, dass ich Euch aus der ermüdenden Konversation mit meinen Eltern erlöst habe.«
Sein Dank hielt sich in deutlichen Grenzen, so belanglos der Inhalt des Gesprächs auch gewesen war, so erfreulich war seine Wirkung auf den Fürsten. »Und wohin bringt Ihr mich, Madame? Wo finde ich Eurer Meinung nach lebhaftere Unterhaltung?«
»Ist es möglich? Seid Ihr der einzige Mann im Saal, der nicht alles dafür geben würde, einige Worte mit mir alleine zu wechseln?«
Sie wollte den galanten Kavalier? Den konnte sie haben. »Wie konnte ich zu hoffen wagen, dass mir solche Ehre zuteil wird? Es ist für den einfachen Falter nicht ratsam, sich zu stark nach dem Licht zu sehnen. Er könnte daran verbrennen.«
»Marchese, Ihr und ein Falter! Ihr seid der schönste und exotischste Schmetterling, der sich an unseren Hof verirrt hat. Und Ihr wisst es auch.«
»Meine Fremdheit ist nichts im Vergleich zu Eurer Schönheit. Aber ich hielt es für klüger, sie aus der Ferne anzubeten, nicht jeder Dienst ist noch am Tag nach dem Fest erwünscht.«
Sie berührte seinen Oberarm mit dem Fächer. »Das herauszufinden, mein lieber Marchese, steht bei Euch.«
Wie er es hasste, dieses Spiel aus zweideutigen Worten und ebensolchen Blicken. Machte sie sich lediglich einen Spaß mit ihm, oder legte sie es tatsächlich darauf an, ihn zu verführen? Und vor allem, welche Folge hätte ein Schäferstündchen mit ihr? Unter Umständen hätte er am nächsten Tag unwiderruflich die Residenz zu verlassen, oder sie erwartete, dass er ihr ab sofort Tag und Nacht zur Verfügung stand. Beide Optionen kamen für ihn nicht in Frage.
Aber zumindest für diesen Abend schien er sie am Hals zu haben, und er bot seinen ganzen Charme auf, sie gleichzeitig bei Laune und auf Distanz zu halten. Nicht, dass er diese Kunst nicht beherrscht hätte, sie zählte zum höfischen Zeitvertreib und war eine Variante des aristokratischen Gesellschaftsspiels. Aber sie war anstrengend, gerade wegen der scheinbaren Leichtigkeit, die man dabei zur Schau stellte. Ständig musste er auf der Hut sein, den schmalen Grat des Anstands nicht zu verlassen, und dennoch als brillant und witzig zu gelten.
Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, Katharina einzuschätzen und ihre Beweggründe zu erforschen. Aber die frivole Konversation lenkte ihn ab, unmöglich, jemandem mit kühlem Verstand zu begegnen, wenn die Instinkte verrückt spielten! Der verführerische Blick über den Fächerrand war nicht zu übersehen, der heimliche Druck ihrer Finger auf seinem Handrücken mehr als stimulierend. Schon wieder bewegte sie den Fächer, verschaffte sich Kühlung. Und ihm Hitzen, denn die Federn tanzten vor ihrem Busen auf und ab und verfehlten ihn höchstens um einen halben Zoll.
Mit Worten wehrte della Motta sie noch ab, aber sein Körper gab sich bereits geschlagen. Die Anspannung seiner Muskeln ließ sich nicht mehr verhindern, zum Glück verborgen vom schweren Stoff des Habits. Konnte sie merken, dass sich sein Atem beschleunigte? Dass er die Augen nicht mehr vom tanzenden Fächer nehmen konnte, vom weißen Fleisch, das er immer wieder streifte? Musste sie sich wirklich auch noch zu seinem Ohr neigen, mit ihrem Atem seinen Hals streicheln, als sie ihm etwas Aufreizendes zugurrte? Seine Wange wie zufällig mit ihren Locken kitzeln?
Und dann ihr plötzlicher Rückzug, der strafende Klaps, den sie seinem Arm mit dem Fächer verpasste, als er den Bann mit einem geistreichen Scherz brach. Ein vorübergehender Rückzug, denn schon sammelte sie sich zur nächsten Attacke. In ihren Augen glomm Triumph auf, als er nach ihrer Hand griff und sie zur Seite zog. Gerade noch rechtzeitig hatte er die Weibsperson bemerkt, die herangerauscht kam und die Prinzessin um ein Haar gerammt hätte. Und die ihn nun entrüstet anblitzte und ihn mit deutlich italienischem Akzent anfuhr:
»Mamma mia, ihr Deutschen! ’aben Ihr nicht lernen, auf Damen zu geben aaht?«
»Mi dispiace signora«, gab er sich dem musikalischen Temperamentsbündel als Landsmann zu erkennen und überhäufte sie mit einem Redeschwall in seiner Muttersprache, wechselte aber mit Rücksicht auf Katharina schnell wieder zu Deutsch. Die Ranieri nahm seine Entschuldigung ebenso hochmütig entgegen wie seine Komplimente für ihre Sangeskunst, beides schien sie vorauszusetzen.
Nun fand er sich zwischen zwei verführerischen Damen. Der erotischen Prinzessin, die mit ihren Reizen nicht geizte und ihn am liebsten gleich in ihr Schlafzimmer gezerrt hätte. Und der Sängerin, die eine eisige Mauer um sich errichtete, die nur vom Lodern in ihren grünen Augen durchbrochen wurde. Er war sich sicher, dass sich unter der braunen Perücke rotes Haar verbarg und dass sich hinter der abweisenden Arroganz eine äußerst sinnliche Hexe versteckte.
Diese Hexe gab ihm jedoch nur zu deutlich zu verstehen, was sie von Männern hielt. Oder zumindest von ihm. Jede seiner Redewendungen quittierte sie mit einem herablassenden Verdrehen ihrer Augen, und ihre wunderbare Stimme troff von Hohn, wenn sie seine Floskeln notgedrungen erwiderte. Und doch ging etwas Erregendes von ihr aus. Er tat ihr den Gefallen und schwieg, aber während sie mit der Prinzessin sprach, ließ er verstohlen seine Augen über ihren Körper wandern. Der schwanengleiche Hals forderte Zärtlichkeiten geradezu heraus, die makellosen Schultern waren unbedeckt, und zu gerne hätte er den Ansatz der Ärmel noch weiter hinuntergeschoben, um die schlanken Arme zu bewundern. Die alabasterfarbene Haut ihres Dekolletés weckte verwegene Träume in ihm! Den Worten folgte er schon eine geraume Weile nicht mehr, er beobachtete, wie sich ihr Collier mit ihrem Busen hob und senkte, während sie sprach. In Gedanken umfasste er ihre Taille, wunderte sich, wie ein so schlanker Körper solch gewaltige Töne hervorbringen konnte. Die Proportion ihres Kleides ließ sehr lange Beine erahnen, die er sich wie alles Übrige an ihr perfekt geformt vorstellte. Unter den zahlreichen Lagen des blassgrünen Seidentaftes vermutete er Verheißungen, die einem Mann den Verstand rauben konnten. Sie war mindestens genauso schön wie die Prinzessin, aber unendlich unnahbar. Und gerade darum begehrenswert.
Er kannte seine Wirkung auf Frauen und auch wenn er nicht erwartete, jede von ihnen zu erobern, wenn er stolze und zurückhaltende Damen achtete, ja sogar schätzte, war er es nicht gewohnt, so unverhohlen abgewiesen zu werden. Die Ranieri verhielt sich ihm gegenüber geradezu beleidigend, sie stellte mehr als Stolz und Distanz zur Schau – sie zeigte ihm offen ihre Verachtung! Dabei waren sie sich nie zuvor begegnet, er konnte keinen Grund für diesen Affront finden. Seine Galanterie ihr gegenüber hielt sich strikt im Rahmen dessen, was eine Dame erwarten durfte. Ja, hätte er sie unterlassen, hätte sie ihn der Missachtung zeihen können! Aber er wusste auch, wann es klüger war, sich zurückzuziehen, und überließ die Damen ihrer Konversation. Wenigstens war er Katharina fürs Erste los.
Die Straßen waren menschenleer, nur eine einsame Kutsche ohne Wappen oder sonstige Kennzeichen bog in die Nebenstraße zum Theater ein. Der Herzog war der einzige Insasse und es gab nur einen Weg, ihn zu besänftigen. Alles war schief gelaufen, und dafür sollte die Ranieri bezahlen.
Katharinas Interesse an seinem Feind hatte er zwar nicht eingeplant, aber es war vorherzusehen gewesen, es gab kaum einen Mann, an dem sie nicht ihre Macht erprobte, und dass der gut aussehende Marchese ein gefundenes Fressen für sie war, hätte er sich denken können. Sondheim grinste hämisch, manchmal konnte Attraktivität auch ein Fluch sein. Das mochte sich wohl auch della Motta sagen, er hatte gar nicht glücklich an der Seite der mannstollen Prinzessin ausgesehen. Ahnte er, dass sie ihm zum Verhängnis würde? Dabei hatte sie ihn fast schon eingewickelt, und wen Katharina einmal am Haken hatte, ließ sie nicht so schnell wieder los. Und dann musste die Ranieri alles verderben! Absolut kein Gefühl für den richtigen Zeitpunkt. Und wie sie diesen Laffen dann auch noch behandelte, ihr abweisender Hochmut. Dilettantin!
Sondheim hämmerte energisch gegen das Tor, bis ihm endlich eine mollige Haushälterin öffnete. »Das wird aber auch Zeit!«
»Die Signora empfängt heute keinen Besuch mehr.«
»Mich wird sie empfangen.« Er schob das Weib kurzerhand zur Seite und stürmte die Stufen hinauf, ohne anzuklopfen riss er die Tür zu den Privaträumen der Primadonna auf. Sehr gut, sie befand sich bereits im Negligé und ließ sich von der Zofe das feuerrote Haar ausbürsten.
»Ihr wagt es, in das Schlafzimmer einer Dame einzudringen?«, empörte sich die Ranieri.
»Die Dame wird es hinnehmen müssen«, spottete er. »Hinaus!«, blaffte er die Zofe an. Das Mädchen zuckte zusammen und sah unsicher seine Herrin an. »Na wird’s bald, oder muss ich Ihr erst zeigen, wer hier das Sagen hat?« Bestürzt rannte das junge Ding davon, und er war mit der Ranieri allein. Registrierte zufrieden, dass die Sängerin nervös mit einer Haarnadel spielte. »Du hast mich heute sehr enttäuscht, wie willst du das wieder gut machen?«
»Enttäuscht? Eure Wünsche waren doch nirgends besser aufgehoben!«
»Ach ja? Und warum wälzt sich der Marchese dann jetzt nicht in deinen Laken? Ich hätte nicht gedacht, dass ein selbstverliebter Geck dir solche Schwierigkeiten macht!«
»Er ist noch nicht reif dafür.«
»Pah, er war mehr als reif. Er war überreif! Wenn du deinen Auftritt nicht so schlecht berechnet hättest, wäre er jetzt in den Händen der fürstlichen Nymphomanin.«
»Eben.«
»Was, eben? Sie hätte wenigstens ausgeführt, wozu du nicht das Geschick hattest.«
»Meint Ihr? Die Prinzessin soll sein Gemüt also dermaßen beschäftigen, dass er an nichts anderes mehr denkt? Ihr haltet sehr wenig von Eurem Gegner.«
»Ich hielt noch zu viel von ihm, er ist ja nicht einmal in der Lage, ein Weib zu nehmen, das sich ihm an den Hals wirft.«
»Mit Verlaub, doch Ihr täuscht Euch gewaltig. Der Marchese ist es gewohnt, zu siegen und eine Frau, die ihm so leicht für eine Nacht gehört, erscheint ihm nicht als Trophäe«, erklärte sie überlegen. »Sagtet Ihr nicht, ich solle ihn betören, ihm die Sinne verdrehen, bis er nicht mehr klar denken kann? Sollte ich ihn nicht von mir abhängig machen, sodass er mich nicht mehr aus seiner Nähe lassen will?«
»Und wie zum Teufel willst du das erreichen, wenn du ihn dermaßen schroff fortstößt? Er wird es sich nun gut überlegen, dir den Hof zu machen.«
»Ihr seid ein Meister der Intrige, Herzog, aber von der Liebe habt Ihr nicht die geringste Ahnung«, höhnte sie wie eine, die sich auskannte. Sie wandte sich wieder dem Spiegel zu und ergriff die Bürste.
»Nein, wirklich nicht?«, trat er hinter sie und fasste mit beiden Händen ihre Schultern. Die Bürste fiel mit einem leichten Klappern auf den Tisch.
Sondheim betrachtete die Sängerin über den Spiegel, ihre Unruhe erregte ihn, ein diabolisches Glitzern trat in seine Augen.
»Bitte lasst mich in Ruhe, ich bin müde!«
»Nein, meine Schöne, schlafen kannst du später. Zuerst zeig mir, wie du den Marchese umgarnen willst!«
Ihr Körper versteifte sich unter seinen Händen. »Ich werde ihn gar nicht umgarnen, ich werde ihn im Gegenteil immer wieder zurückweisen. Er ist anders als Ihr, er nimmt nichts mit Macht oder Gewalt. Er ist ein Jäger, und je schwieriger die Beute zu erlangen ist, desto wertvoller erscheint sie ihm. Glaubt mir, er wird mich verführen, er wird alle seine Kräfte anstrengen, um mich zu besitzen. Und erst, wenn er mir mit Haut und Haaren verfallen ist, werde ich ihm vielleicht gehören.«
»Welche Verschwendung! Und bis es so weit ist, soll dein Bett kalt bleiben? Das lasse ich nicht zu.« Er streifte ihr das Negligé über die Schultern, sodass sie nur mehr im Korsett vor ihm saß, bedeckte ihren Hals mit nassen, gierigen Küssen und versenkte seine Linke in den Ausschnitt des Mieders.
»Nein, ich will nicht. Geht jetzt. Bitte!«
»Du willst ganz gewiss, denke an deinen Vater! Steh auf!«
Sie gehorchte widerwillig und wehrte sich nicht. Seine rechte Hand griff an ihrem Leib tiefer, ertastete das untere Ende des Mieders und schob sich unter den Bund des Unterrocks. Er fühlte das weiche Fleisch und presste sich von hinten an ihren Körper.
»Willst du immer noch nicht?«
»Nein.«
»Sag, dass du mich willst!« Er befreite ihre rechte Brust aus dem Korsett, knetete sie, bis die Brustwarze steil aufgerichtet stand. »Los, sag es!«
Sie ließ die Berührungen über sich ergehen, blieb aber eisern stumm. Er riss die Verschnürung ihres Mieders auf.
»Zieh dich aus, ich will dich nackt sehen! Ganz nackt!«
Mit seinen Blicken kam er ihr zuvor, noch bevor sie die einzelnen Kleidungsstücke ablegte, schutzlos stand sie vor ihm, während er immer noch vollständig angezogen war. Nur die Wölbung in seiner Hose verriet, dass er sie heftig verlangte. Er ließ seine Augen über ihren Körper wandern und betrachtete ihn eingehend und kalt.
»Lehn dich über den Stuhl!«
Er nahm sie von hinten, wie eine Zofe, nicht wie eine Primadonna. Zeigte ihr, was sie wert war. Und er war grob, fasste sie hart an, während er brutal in sie hineinstieß. Es kümmerte ihn nicht, ob er ihr weh tat, als er schnell wie immer seine Befriedigung fand.
»Dein Vater wird mit dir zufrieden sein. Und was den Marchese betrifft, enttäusche mich nicht!«
»Giacomo!«
»Was? Schon jetzt? Schnell, gib mir meine Hose!« Giacomo sprang aus dem Bett.
»Warum ist er schon zurück? Du hast gesagt, er kommt spät!«
»Was weiß denn ich? Wo ist mein Hemd, dov’è?«
»Giacomo!«
»La scarpa, meinen Schuh, gib mir meinen Schuh rüber!«
Er flog ihm entgegen.
»Nicht böse sein, cara mia!«
»Du Lump!«
»Ich bin doch genauso sauer wie du!«
»Giacomo!!!«
»Ich muss zu ihm. Gib mir einen Kuss. Un bacio!«
»Hol ihn dir doch von deinem feinen Herrn!«
»Der küsst aber nicht so gut wie du.« Er kniff Anna in die Wange und drückte ihr einen festen Schmatz auf die Lippen. »Wir treffen uns morgen. Versprochen.«
Im Hinauslaufen steckte er die Hemdzipfel in den Hosenbund.
»Giaco...«
»Bin schon da, Herr, bin schon da! Verzeiht, ich habe schon geschlafen.«
»Miserabler Lügner. Die kleine Magd von gestern?«
»Anna.«
»Sorge dafür, dass sie verschwindet! Tu, was du willst, aber tu es nicht hier heroben. Denk an Venedig!«
Giacomo ging in seine Kammer, aber Anna war schon die Hintertreppe hinabgehuscht. Venedig, Venedig. Da hatte er sich übertölpeln lassen. Musste der Herr ihn immer wieder daran erinnern? Ach nein, jetzt ging das wieder los, das grenzte ja schon an Verfolgungswahn, jetzt kontrollierte der Marchese auch noch die Verstecke! Ja doch, die Skizze war noch da, Anna war die ganze Zeit bei Giacomo im Bett gelegen.
»Die Briefe?«
Giacomo zeigte sie ihm.
»Das Brevier?«
»Unter dem doppelten Boden im Koffer. Ich wusste nicht, wohin damit, es ist zu groß.«
»Das ist nicht gut, dort sieht man als Erstes nach. Bring es her!«
Na dann war er mal gespannt, wo der Meister das Ding verstecken würde. Was wurde das jetzt, warum riss sich der Marchese ein Haar aus? Aha, gar nicht so dumm. Ein schwarzes Haar zwischen den Seiten des Buches, jeder würde es für seines halten. Obwohl ...
»Wird man glauben, dass Ihr ein deutsches Gebetbuch lest?«
»Du hast Recht. Machen wir es zu meinem!«
Er ging an den Schreibtisch und tauchte die Feder in die Tinte.
»Das ist deutsche Schrift, ich kann das nicht lesen. Was habt Ihr geschrieben?«
»›Danke für Eure tatkräftige Hilfe. Vertraut in Gott.‹«
»Eine Widmung. Von wem?«
»Monsignore Franz Möllau.«
»Wer ist das?«
»Keine Ahnung.« Der Marchese schmunzelte. »Aber wenn ich es mir recht überlege ...« Er setzte zwei Buchstaben hinter den Namen.
»›S. J., Societas Jesu, Ihr habt ihn zum Jesuiten gemacht?«
»Nur so eine Idee. Wenn ich dem Kardinal helfe, warum sollte ich nicht auch mit anderen Jesuiten in Verbindung stehen? Leg es in mein Nachtkästchen, sobald die Tinte trocken ist! Wie weit bist du mit den Briefen gekommen?«
»Fünf habe ich geschafft. Es ist nicht so leicht, etwas zu kopieren, wenn man die Schrift nicht beherrscht.«
»Ich mache morgen selbst weiter. Du mischst dich wieder unters Volk und hältst die Ohren offen. Und bei der Gelegenheit besorgst du auch gleich Konfekt.«
»Ah, Ihr habt auch die Bekanntschaft einer Dame gemacht?«
»Einer Dame? Einer impertinenten Schaustellerin. Aber von erlesener Schönheit.«
»Wie heißt denn Eure Anna?«
»Anna.«
»Ihr macht Witze.«
»Nicht im Geringsten. Anna Ranieri.«
»Die Primadonna selbst? Seit wann gebt Ihr Euch mit dem fahrenden Volk ab?«
»Seit ... ach lassen wir das, ich habe meine Gründe. Besorge mir einfach die Pralinen!«
6
Della Motta saß am Schreibtisch, vor ihm lagen die gestohlenen Papiere, doch grüne Augen störten seine Konzentration. Er wusste, dass er nichts übereilen durfte. Mit diesem Frauentyp kannte er sich aus, bei dem musste er sich in Geduld üben. Es war Vormittag, ohnehin zu früh für Besuche.
Giacomo besorgte gerade die Naschereien, würde dann am Markt Erkundigungen einholen und seine Mahlzeit in einem der Gasthäuser einnehmen. Während della Motta frühstückte, hatte Anna den Ofen befeuert und die Zimmer gerichtet, hatte ihm dann eine Kanne Kaffee gebracht und war nach unten verschwunden. Er konnte daher ungestört arbeiten, aber das Abschreiben war mühsam und langweilig. Immer wieder kamen ihm Gedanken an die Ranieri dazwischen.
Es dauerte Stunden, bis er endlich die Feder beiseite legte und sich nach einem geeigneten Versteck für die Kopien umsah. Erst als sie sicher verstaut waren, nahm er sich abermals die Originale vor. Er spitzte die Feder und zog einen leeren Bogen aus der Schreibmappe.
Der Inhalt des ersten Briefs war belanglos, die Schreiberin hatte Diethard tags zuvor gesprochen, war vom Prinzen ebenso fasziniert, wie von der Konversation, seinem Geist und seinen fortschrittlichen Ideen. Sie müsse im Dunkeln bleiben, da sie durch ein Eheversprechen gebunden sei, könne ihre Briefe nicht namentlich zeichnen, aber seit dem gestrigen Tag wisse sie, dass ihre Herzen im Einklang schlugen. Keine Doppelbödigkeiten. Sollte es sich doch nur um ein amouröses Abenteuer handeln? Die Wortwahl war weiblich, vielleicht hatte er sich ja getäuscht, als er einen männlichen Autor vermutet hatte. Vielleicht hielt er Reinschriften in der Hand, das würde die Regelmäßigkeit der Schrift erklären. Wer war der Absender? Vielleicht konnte ihm das Papier einen Hinweis geben. Es war ein gutes, teures Blatt, kein billiges Lumpenpapier. Er notierte:
Wer?
Gutes Papier vermögend?
Erster Kontakt: Hof? Stadt?
Verkehrt D. mit Bürgern?
Er fand das Datum des Schreibens ganz oben, ohne Ortsangabe: 11. Juni 1785, das erste Treffen hatte also am 10. Juni stattgefunden, vor noch nicht einmal einem halben Jahr. Er schrieb:
10. 6. d. J.?
Dann rechnete er zurück und ergänzte:
Freitag.
Es würde nicht leicht sein, herauszufinden, was vor fünf Monaten stattgefunden hatte. Wenn er Pech hatte, nahm alles bei einer ganz harmlosen Gelegenheit und eher zufällig seinen Anfang. Trotzdem machte er sich Stichworte:
Bälle
Salons
Spielplan
Er ließ Raum für spätere Einfälle.
Auf diese Weise kam er nur langsam voran. An der Türe klopfte es, die Köchin ließ fragen, ob der Herr im Haus bliebe oder auswärts zu speisen wünsche. Er verlangte nur einen kleinen Imbiss, und als bald darauf Anna einen Teller mit kaltem Braten, Gebäck und einen Krug Wein brachte, bat er, bis zu Giacomos Rückkehr nicht mehr gestört zu werden. Er wollte noch möglichst lange das Tageslicht nutzen, das Flackern des Kerzenscheins würde die Untersuchung der Briefe früh genug erschweren. Bald schon war er wieder in die Lektüre vertieft, und seine Notizen füllten Bogen um Bogen.
Abermals hatte er etwas gefunden, das seinen Verdacht erregte: Die Schreiberin berichtete von einer Jagd, aber die Art und Weise, wie sie das tat, machte ihn stutzig. Sie schrieb mit Leidenschaft darüber, auch die Schrift hatte hier mehr Schwung, war nicht mehr so präzise wie auf den ersten Seiten. Es war das genaue Gegenteil dessen, was ihn gestern beim Bericht über die Schlange gestört hatte. Hier fand er auf einmal die vermisste emotionale Beteiligung, hier spiegelte sie sich nicht nur in den Worten, sondern auch im Schriftbild wider. Er blätterte zum früheren Brief zurück und verglich die Stellen. Dann schrieb er mit raschem, festem Strich: Schreiber = Mann, Erlebnis mit Schlangen erfunden. Erfunden unterstrich er.
Er war tief in seine Arbeit versunken, die Geräusche im Haus nahm er längst nicht mehr wahr und die auf der Straße schon gar nicht. Irgendwann wurde es zu dunkel, er zündete die Kerzen an und wandte sich wieder den Briefen zu. Der Docht zischte, und er kürzte ihn. Unten ging die Haustür, jemand unterhielt sich gedämpft. Er beugte sich abermals über seine Notizen. Die Stiege knarrte, jetzt merkte er doch auf. Und dann ging alles viel zu schnell.
Stiefel trampelten durch den Salon, unmöglich, die Briefe verschwinden zu lassen! Und die Notizen, den Schlüssel dazu! Die Lade war sinnlos, zum Verstecken fehlte die Zeit, er hielt die Papiere an die Flamme, aber sie fingen nicht schnell genug Feuer. Und schon stürzten die Soldaten herein, drei Soldaten und der Herzog! Er ließ die Papiere auf die Tischplatte fallen und stieß das Tintenfass um, doch Sondheim war noch schneller. Mit einem Satz war der Herzog am Tisch, riss die Aufzeichnungen an sich und versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht.
»Das war ein Fehler, Marchese! Und jetzt gebt heraus, was Ihr gestohlen habt!«
Della Motta schmeckte Blut, ohne zu denken stürzte er sich auf den Herzog und wurde von zwei Soldaten zurückgerissen. Sondheim schmetterte ihm die Faust mit solcher Wucht ins Gesicht, dass ihm noch mehr Blut aus der Nase sickerte. »Macht ihn fertig!«, zischte er, und in den Worten lag sein ganzer Hass. Die Soldaten ließen sich das nicht zweimal sagen. Quer über das Gesicht des einen verlief ein noch frischer Schnitt, der Mann hatte allen Grund, sich zu rächen!
Della Motta packte den gusseisernen Kerzenleuchter und knallte ihn dem einen vor die Stirn, dem zweiten rammte er den Ellbogen in die Seite und stürzte zum Nebenraum. Aber er hatte die Tür noch nicht erreicht, da hielt ihn ein scharfer Schmerz zurück, der dritte Soldat hatte ihn an den Haaren gepackt und zerrte ihn daran rückwärts, in die Mitte des Zimmers. Er dachte nicht daran, aufzugeben, schlug nach dem Soldaten, der ihn weiterhin fest an den Haaren hielt und ihn mit voller Kraft zu Boden schleuderte. Der Stuhl stand im Weg, er stürzte mit der Wange gegen die Kante, umklammerte den Knöchel seines Gegners, riss ihn nieder, sprang auf, versuchte, die Tür zu erreichen, aber nun waren die beiden anderen wieder da. Ohne Waffe ging es nicht, er brauchte seinen Degen! Der Kerl auf dem Boden griff nach seinem Fußgelenk, er schüttelte ihn mit einem kräftigen Tritt ab, aber da hatten ihn bereits die beiden anderen, zerrten ihm die Arme auf den Rücken und hielten ihn fest. Jetzt kam auch der dritte wieder auf die Beine, sein verunstaltetes Gesicht war hasserfüllt.
Er wusste, was jetzt kam, spannte die Bauchmuskeln an und blockte den Schlag ab, aber der zweite folgte zu schnell. Die Soldaten gaben ihn nicht frei und verschafften ihrem Kumpan Gelegenheit für einen weiteren Treffer, und jetzt knickte er ein. Übelkeit wallte in ihm hoch, er versuchte vergeblich, sich zu befreien, als ihn schon der nächste Hieb in die Magengrube traf. Seine Beine versagten ihm den Dienst, aber wie in einer eisernen Klammer fühlte er sich festgehalten, immer wieder in die Höhe gezerrt, nur damit die Schläge weiter auf ihn eintrommeln konnten. Er krümmte sich vor Schmerz, seine Tritte gingen ins Leere, das Zimmer drehte sich um ihn. Er kämpfte gegen die Ohnmacht an, da hörten sie plötzlich auf. Es war still im Raum, bis auf sein Stöhnen.
Sondheim trat nahe an ihn heran, ganz nahe, packte ihn am Haar und riss ihm den Kopf mit einer ruckartigen Bewegung in den Nacken. Er konnte den Aufschrei nicht unterdrücken und verwünschte sich dafür, die Befriedigung, die in den Augen des Herzogs aufblitzte, schmerzte noch mehr als die körperliche Attacke. Jetzt war das Gesicht seines Feindes an seinem, er roch den Atem des Herzogs, der harte Blick bohrte sich in seine Augen, Sondheims Stimme war eisig.
»Wo ist Diethards Eigentum?« Er schwieg, Sondheim riss scharf an seinem Haar. »Ich höre!«
»Geht zur Hölle!«
Schon wieder drosch Sondheim ihm den Handrücken ins Gesicht. »Ich kann Euch auch totprügeln lassen!«
»Tut Euch keinen Zwang an!« Er konnte nur mehr keuchen. Und erhielt einen weiteren Hieb in den Magen.
Doch Sondheim sah ein, dass er so nicht ans Ziel kam. »Das bringt nichts. Nehmt den Raum auseinander!«
Abrupt ließen sie ihn los, und er schlug auf dem Boden auf, keiner kümmerte sich um ihn. Es lohnte nicht, ihn während der Suche zu bewachen, er konnte sich nicht mehr bewegen. Wie durch einen Nebel nahm er wahr, dass sie die Schubladen durchwühlten, hinter die Bilder sahen, unter die Schränke, dass sie die lockeren Dielenbretter prüften. Aber es war schwer, etwas zu finden, wenn man nicht wusste, wonach man suchte. Er sah die Stiefel, die immer wieder an ihm vorbeistampften, Sondheims bestrumpfte Waden. Die Schnallenschuhe verschwammen vor seinen Augen, sie waren schwarz und auch die Stiefel waren schwarz und das Zimmer war schwarz und die Schwärze erreichte seinen Kopf und schluckte den Schmerz und …
Jemand packte ihn am Kragen und zerrte ihn hoch. Er hing zwischen zwei Männern, seine Füße schleiften über den Boden, erst im Schlafzimmer stellten sie ihn halbwegs auf die Beine. Einer drehte ihm den Arm auf den Rücken und hielt ihn fest, seine Knie gaben nach, er wollte wieder zusammensinken, aber sein Wächter riss ihn wieder hoch.
Sondheim beobachtete ihn wie ein Luchs. Ja, du hast es geschafft, du Bastard, sieh dich ruhig satt! Genieße, dass mich der Schmerz übermannt, die Übelkeit wieder aufsteigt! Aber durch den nebligen Schleier vor seinen Augen sah della Motta keine Genugtuung, der Herzog musterte ihn nicht gehässig, sondern prüfend, und langsam, sehr langsam dämmerte es ihm: Sein Mienenspiel, sein angespannter Gesichtsausdruck sollte ihnen das Versteck verraten, sobald sie sich ihm näherten.
Teure Anzüge wurden im Ankleidezimmer von den Stangen gefegt, die Koffer auf doppelte Böden hin geprüft – wie gut, dass er das Brevier von dort entfernen ließ! Sie verstreuten Giacomos Rasiermesser, und er betete, dass sich der Einsatz der Kassette nicht löste! Die Bürste warfen sie ebenso achtlos auf den Kleiderhaufen, wie die übrigen Toilettegegenstände. Sie zerrten die Matratze aus dem Bett und sahen ins Nachtkästchen. Wendeten sich ab, überlegten es sich anders, einer nahm etwas aus der Schublade.
Nein, nicht! Nicht das Brevier! Wie hält man sein Gesicht ausdruckslos, wenn man vor Schwäche zittert? Wenn der Schmerz einem die Tränen in die Augen treibt, wenn man seine ganze Energie aufbringen muss, sie niederzukämpfen? Wie heuchelt man Gleichgültigkeit, wenn die Selbstbeherrschung mehr Kraft erfordert, als man übrig hat? Sondheim lauert, er weiß, dass nur die Erschöpfung mir das Geheimnis entlocken kann, eine letzte Anstrengung, nur eine noch!
Der Herzog schlug das Brevier auf und las die Widmung. Und dann lachte er: »Das haben die Jesuiten aus Euch gemacht? Ich hätte Euch gar nicht für eine Betschwester gehalten.«
Normal weiteratmen, den Hohn abprallen lassen. Das Buch flog achtlos auf den Boden.
Della Motta war willenlos, als sie ihn in die übrigen Räume schleppten und dort ihre Suche fortsetzten. Dann wieder zurück ins Arbeitszimmer. Hätte er doch nur etwas Harmloses versteckt, nur, damit sie ihn endlich losließen! Aber es gab nichts zu finden und die Enttäuschung darüber machte sich in ihrer Behandlung ihm gegenüber Luft.
»Lasst mich machen, Euer Gnaden, ich werde es schon aus ihm herausprügeln!« Die Stimme gehörte dem Soldaten mit dem zerschnittenen Gesicht, klang roh und ungehobelt und passte zu dem Kerl.
Der Herzog zuckte mit den Achseln, er versprach sich sichtlich nichts mehr davon, sah eine Weile gelangweilt zu und kümmerte sich nicht mehr um die dumpfen Schläge, um della Mottas Nach-Luft-Schnappen, um sein Stöhnen. »Wir gehen!«, entschied er unvermittelt. Ein letzter Schlag und della Motta sackte auf den Boden. Die Soldaten richteten sich die Uniformen und spuckten aus, Sondheim stieg über ihn hinweg. Leichtfüßig liefen sie die Stiege hinunter.
Als Giacomo die Wohnung betrat, sah er zuerst die offenstehenden Türen der Kommode im Salon. Er hob ein Spitzendeckchen vom Boden auf, wich den Scherben einer Keramikvase aus und stellte einen Zinnkrug wieder auf die Konsole. Wer konnte wissen, wie es in den anderen Räumen aussah? Wo war der Marchese, war er entführt, verletzt, tot?
Aber bevor er irgendetwas in Sachen Marchese unternahm, musste Giacomo sich bewaffnen, immerhin konnte der Eindringling noch hier sein und auch ihm auflauern. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, während er nach etwas Geeignetem suchte. Merda, die Öfen wurden von hinten befeuert und es gab daher keinen Schürhaken im Zimmer! Dann musste halt die Bronzeskulptur herhalten, die normalerweise auf der Kommode stand, nun aber auf dem Boden lag.
Auf Zehenspitzen betrat er das Arbeitszimmer, in der Linken den Leuchter, die Rechte mit der Skulptur zum Schlag erhoben. Sie zitterte. Doch hier war niemand. Das heißt, niemand, der nicht hierher gehörte. Er sah den Marchese auf dem Boden liegen und sein erster Impuls war, zu ihm hinzustürzen. Aber Viscontis Lektionen saßen, Giacomo zwang sich, auch alle anderen Räume zu inspizieren, bevor er ihm zu Hilfe eilte. Das Schlaf- und Ankleidezimmer waren verwüstet, aber menschenleer. – Grazie, Madonna mia! – Das Arbeitszimmer sah nur wenig besser aus, und das auch nur, weil sich darin weniger Möbel und somit weniger mögliche Verstecke befanden. Erst nachdem Giacomo sich auch in seiner eigenen Kammer – Merda, der reinste Saustall! –, vergewissert hatte, dass sich außer ihnen beiden niemand in der Wohnung aufhielt, stellte er Leuchter und Waffe auf dem Schreibtisch ab und kniete sich neben dem Herrn nieder.
Der lag bewegungslos, zusammengekrümmt, die Hände gegen den Leib gepresst. Er rührte sich nicht, aber er atmete. Gott sei Dank! Vorsichtig drehte Giacomo ihn auf den Rücken. Wegen der aufgelösten Frisur wusste er schon, dass der Marchese nicht einfach überrumpelt und von hinten niedergeschlagen worden war, aber erst am Gesicht sah er, wie heftig der Kampf gewesen war. Die Stelle über dem rechten Jochbein war stark geschwollen, das gab einen ordentlichen Bluterguss. Aus der Nase rann dunkelrotes Blut, die Lippe war dick und aufgeplatzt. Auch das Hemd war blutbefleckt, aber soweit er nach einer hastigen Untersuchung feststellen konnte, gab es keine offenen Wunden, das Blut stammte sicher von Lippe und Nase. Behutsam nahm er die Hände des Herrn zur Seite und tastete den Körper nach Brüchen ab. Visconti stöhnte gequält auf.
Benommen hatte der Marchese wahrgenommen, wie ihn jemand auf den Rücken drehte, aber er wollte die Augen nicht aufschlagen. Konnte er nicht immer so liegen? Sich einfach nicht bewegen, warten, bis dieser unsägliche Schmerz endlich nachließ? Er hatte das Gefühl, als würde sein ganzer Körper nur aus seinem rebellierenden Magen bestehen, aber er konnte sich nicht einmal übergeben. Spürte nur diese wahnsinnigen Krämpfe, die sein Inneres zerrissen. Jemand nahm seine Hände fort, die er gegen den Leib gepresst hielt, um den Schmerz wenigstens ein klein wenig zu betäuben. Die Knie wurden vorsichtig gestreckt, dann fühlte er zwei Hände, die ihn behutsam abtasteten, ihm jedoch wie Schmiedehämmer vorkamen. Seine Rippen taten weh, aber erst als die Hände über seinen Bauch wanderten, hätte er schreien mögen.
War ein Laut über seine Lippen gekommen? Jedenfalls wurde die Untersuchung abgebrochen, er lag kurze Zeit unbehelligt da, auf dem Rücken, und zog wieder die Bauchmuskeln zusammen. Wollte sich krümmen, einrollen. Da wurde ein Knie unter seinen Nacken geschoben, unter seinen Rücken, ein Arm stützte ihn nun, hob seinen Oberkörper an. Etwas Kühles wurde ihm an die Lippen gehalten, etwas Nasses, er schmeckte Wein. Zwei, drei Schlucke wurden ihm eingeflößt, dann hätte er sich beinahe doch übergeben. Stattdessen hustete er, hätte erneut aufschreien mögen, als sich sein Zwerchfell dabei spannte. Er musste aufwachen, musste diesem Jemand sagen, er solle ihn in Ruhe lassen, einfach da liegen lassen, sterben lassen.
Jetzt sprach der andere, aus weiter Ferne klangen Worte an sein Ohr, dumpf, drängend. Sie nannten ihn Marchese, immer eindringlicher. Er musste diesem Drängen nachgeben, damit er endlich wieder zurück in die Ohnmacht gleiten konnte. Er spürte an der Art, wie dieses Marchese ausgesprochen wurde, dass man ihm keine Ruhe lassen würde, bis er ein Lebenszeichen von sich gegeben hätte. Mit unendlicher Anstrengung öffnete er die Lider. Und sah ins besorgte Gesicht seines Dieners.
»Was ist geschehen?«
Della Motta wollte antworten, formte die Worte mit seinen Lippen, doch als er Luft holte, um ihnen auch einen Klang zu verleihen, verkrampfte er sich erneut vor Schmerz. Er ließ sich gegen Giacomos Arm sinken, wollte die Augen schließen, wurde aber nun gerüttelt. Seit wann war Giacomo so grob? Erneut der Geschmack von Wein, diesmal musste er ihn nicht schlucken, sein Diener benetzte ihm nur die Lippen damit. Er tastete nach Giacomo, und der half ihm nun vorsichtig, sich weiter aufzurichten. Sofort kam wieder diese Woge des Schmerzes, er zog die Beine an, kniete nun neben seinem Helfer. Giacomos Arm legte sich um seine Schultern, della Motta drohte vornüber zu kippen, als er sich wieder vor Qual zusammenkrümmen wollte, doch der Diener hielt ihn an den Schultern fest. Giacomo zog ihn in die Höhe, ließ ihn erst los, als er ihm den Stuhl in die Kniekehlen geschoben hatte, und die Lehne seinen Rücken stützte.
»Bleibt ruhig, Marchese, ich bin gleich wieder bei Euch!«
Giacomos Schritte entfernten sich in den Nebenraum, della Motta hörte etwas Schweres, das zurechtgerückt, dann Stoff, der glatt gestrichen wurde. Giacomo musste das Bett machen, das die Soldaten zerwühlt hatten, als sie die Matratzen aus dem Bettkasten zerrten. Langsam kam ihm die Erinnerung zurück. Der Herzog war hier gewesen, sie hatten ihn überrascht. Die Briefe. Die Notizen.
Giacomo kam zurück und half ihm aufzustehen.
»Was haben sie mitgenommen?« Della Motta flüsterte, so schmerzte ihn das Sprechen am wenigsten.
»Ich weiß es noch nicht. Kommt!«
Giacomo hatte sich seinen Arm über den Nacken gelegt, um ihn besser stützen zu können, und führte ihn ins Schlafzimmer. Jeder einzelne Schritt peinigte ihn, und er war heilfroh, als er sich endlich auf die Bettkante setzen konnte.
Giacomo zog dem Marchese das blutbesudelte Hemd über den Kopf, sah nun, was er schon längst befürchtet hatte, den um die Mitte grün und blau geschlagenen Leib seines Herrn und die Blutergüsse an den Oberarmen. Er hob ihm die Beine aufs Bett, stopfte ihm Kissen in den Rücken, so dass er einigermaßen aufrecht sitzen konnte. Dann zog er ihm die Schuhe aus und breitete die Decke über den nur mit Kniehose und Seidenstrümpfen bekleideten Körper.
»Wollt Ihr noch etwas trinken?«
Stummes Kopfschütteln.
Giacomo ging hinunter, rief nach Anna, und verlangte warmes Wasser und Tücher. Als er an Viscontis Bett zurückkehrte, lag der apathisch in die Kissen gelehnt da. Bene, er würde ihm Zeit geben, bis das Wasser heroben war, inzwischen konnte er ja schon mal aufräumen. Am besten, er begann im Ankleidezimmer, da musste er den Marchese nicht allzu lange aus den Augen lassen.
Er sammelte die Rasiermesser ein, zum Glück hatten die Räuber das Geheimfach des dazugehörenden Kastens nicht entdeckt. Die doppelten Böden der Koffer waren nicht schlimm, das Brevier hatte er ja auf Anweisung des Marchese herausgenommen. Als ob der etwas geahnt hatte! Auch der Griff der Haarbürste war noch ganz, was man von den Kleidern nicht sagen konnte. Er prüfte jedes einzeln auf Schäden, bevor er sie aufhing, und bildete einen Stapel mit den Stücken, die er ausbessern musste. Eben hatte er eine schwarze Weste mit Stickerei aus Silbergarn in der Hand, als ihm ein spitzer Schrei das Trommelfell malträtierte. Das musste Anna mit dem Wasser sein, er lief ihr rasch entgegen.
»Was ist hier passiert?«, rief sie bestürzt, und er kaufte ihr die Bestürzung auch ab. »Soll ich vielleicht aufräumen?«
»No, no, das hat bis morgen Zeit, ich mache selbst das Gröbste. Hast du gar nichts gehört? Niente?«
»Doch, es gab großen Lärm oben, aber wir durften nicht nachsehen.«
»Wer hat das gesagt?«
»Die Alte. Der Herzog wollte es so.«
»Der Herzog war hier? Maledetto!«
»Wir mussten in der Küche bleiben, bis der Lärm vorüber war. Und dann sollten wir unten bleiben, der Marchese wollte doch nicht gestört werden.«
»Incredibile, das gibt’s doch nicht! Und das habt ihr geglaubt?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Er hat es selbst gesagt, als ich ihm das Mittagessen gebracht hab.«
Das machte sie sich ja einfach! Aber der Herr war ihr ja egal, für sie bedeutete er nur Arbeit, und seit gestern Nacht war sie erst recht nicht gut auf ihn zu sprechen. Also warum auch die Stellung riskieren und ihm helfen?! Besser, Giacomo gab für den Moment nach, sie hätten nur gestritten, und das nützte dem Marchese gar nichts. Er schickte Anna hinunter und brachte selbst Wasser und Tücher ins Schlafzimmer.
Visconti befand sich noch immer in seinem Dämmerzustand. »Es kann sein, dass das jetzt wehtut«, warnte Giacomo und tauchte den Zipfel eines Tuches ins Wasser. Vorsichtig reinigte er Viscontis Gesicht vom gestockten Blut. Nur als er das Jochbein berührte, zuckte der Marchese zusammen, sonst schien ihm das warme Wasser sogar gut zu tun. »Glaubt Ihr, dass der Wangenknochen gebrochen ist?«
»Nein.« Der Marchese sprach immer noch leise, aber die Stimme klang schon fester als vorher.
»In dem Zustand könnt Ihr keinen Prinzessinnen den Kopf verdrehen.«
Es sollte ein Scherz sein, aber beide wussten, dass der Marchese es sich nicht leisten konnte, vom Hof fernzubleiben. Was bedeutete, dass Schminke die Blessuren verdecken musste, der Gedanke an die dafür notwendigen Berührungen war bestimmt nicht angenehm. Giacomo wusch ihm den Hals und den Oberkörper. Bei der Berührung der Magengegend hätte der Herr gewiss aufschreien können, hatte sich nun aber fest unter Kontrolle.
»Anna sagt, der Herzog.«
Der Marchese nickte. »Und drei Soldaten. Ich konnte an keine Waffe kommen.«
»Diese Mistkerle! Haben sie wenigstens auch etwas abgekriegt?«
»Nicht genug.« Er verzog das Gesicht, als Giacomo die verletzten aber nun gesäuberten Stellen noch einmal begutachtete. »Er hat die Briefe.«
»Alle?«
»Ja. Die Originale.«
»Habt Ihr die restlichen Kopien machen können?«
»Hoffentlich sind sie noch da.« Er bezeichnete Giacomo das Versteck, es war nicht angetastet.
»Auch der erste Teil ist noch vorhanden. Wir haben Glück gehabt.«
»Nur bedingt. Er hat meine Aufzeichnungen. Damit weiß er genauso viel wie wir.«
Giacomo fluchte vor sich hin. »Und nun?«
»Sondheim wird sehr schnell feststellen, dass er nur einen Teil der Papiere erbeutet hat. Du musst den Kardinal warnen.«
7
»Ich hätte es wissen müssen, ich kenne Sondheim, ich hätte es wissen müssen!« Der Kardinal schritt wie ein Irrer im Zimmer auf und ab, fuhr sich mit der Hand ins Haar und schüttelte den Kopf. Giacomo sagte nichts dazu und sah ihn nur an. Abrupt blieb Ressau vor ihm stehen. »Was hat er mitgenommen?«
»Die Briefe.«
»Alle?«
»Tutti, die Originale.«
»Heißt das, Sein Herr hat Kopien gemacht?«
»Si, die sind noch da.«
»Dem Himmel sei Dank!«
»Das Brevier auch.«
»Das Brevier, immer das Brevier, della Motta ist ganz versessen auf dieses Buch! Hat er etwas darüber herausgefunden?«
»Ich glaub, er hat mit den Briefen begonnen.«
»Das war auch richtig so. Glücklicherweise bestand ich darauf, sie zu teilen, auch wenn ich immer noch nicht verstehe, was uns dieses Liebesgeschwätz nützen soll. Er kann Seinem Herrn sagen, außer Schlangen und Floskeln der Verehrung enthalten sie nichts.«
»Der Marchese hat sie entschlüsselt.«
»Er hat ...! Was hat er herausgefunden? Was ist damit?« Ressau packte ihn am Kragen und schüttelte ihn.
»Das hat er mir nicht gesagt.«
»Natürlich«, ließ der Kardinal ihn wieder los.
Von wegen natürlich. Wenn der wüsste, worüber der Marchese mit ihm sprach! Aber klar, der hielt ihn für einen simplen Kammerdiener, dieser hohe Herr. Auch Kardinäle waren nicht klüger als andere Adlige. »Aber er hat sich Notizen gemacht.«
»Und ...?«
»Die sind auch weg.«
Der Kardinal ließ sich in einen Sessel fallen und stützte die Stirn in die Hand. »Das gibt es doch nicht! Das Geheimnis der Briefe gelüftet und Sondheim weiß alles! Herrgott, wie konnte della Motta das zulassen?!«
Giacomo schwieg.
»Mann, er ist ein Spion! Er hätte sich doch vorsehen müssen!«
»Hat er doch, er hat ja Kopien! Und er will, dass Eure Eminenz auch welche machen.«
»So, will er das? Er verliert die Hälfte unserer Papiere und wagt es, mir Anweisungen zu geben?«
Seiner Papiere, du dämlicher Kerl, er hat sie gestohlen. »Er empfiehlt es Euch.«
»Aha, der Meister empfiehlt. Sag Er ihm, dass ich selbst denken kann und dass die Briefe sicher verschlossen sind.«
»Er würde Euch antworten, dass man Schlösser knacken kann.«
»Ach, würde er das? Dann übersieht er, dass Sondheim sich nie so weit vorwagen würde, bei mir einzudringen. Er ist mein Feind, aber er hat Respekt vor mir, er schikaniert nur Personen ohne Einfluss. Fremde. Leute, die sich nicht rächen können.«
Und dafür hältst du den Marchese? Für jemanden, der sich nicht rächt? Idiot! »Ascolti, hört! Der Herzog hat die Briefe nicht einfach gefunden, sondern sie bei einem Überfall erbeutet. Der Marchese hat an den Papieren gearbeitet, Sondheim ist mit seinen Schergen gekommen, hat ihn so zusammenschlagen lassen, dass er nur durch ein Wunder noch lebt, und hat die Papiere mitgenommen. Basta. Aber klar, wenn Ihr sicher seid, dass Euch das nicht passieren kann, muss ich euch auch nicht warnen.« Giacomo drehte auf dem Absatz um und stapfte zur Tür.
»Warte Er!«
»Was noch? Ich muss zurück, nach dem Marchese sehen.«
Jetzt schien der Kardinal sogar ein wenig verlegen. Gut so!
»Sein Herr braucht doch nicht etwa ... einen Priester?«
»Nein, aber viel hätte nicht gefehlt.«
Liebesbriefe! Sondheim hatte Liebesbriefe erbeutet, Visconti hatte ihn schon wieder übertölpelt! Dabei war der erschrockene Blick dieses Mistkerls so echt gewesen! Sein hilfloser Ärger, die Papiere nicht mehr verstecken zu können, der fehlgeschlagene Versuch, sie zu vernichten, das Eingeständnis der Niederlage!
Wenigstens hatte er für den Affront bei der Meyn bezahlt, für seine Herablassung, seinen Hohn. Hatte zu spüren bekommen, dass man sich mit dem Herzog von Sondheim nicht ungestraft anlegte. Das war die Sprache, die dieser arrogante Schuft verstand, so brachte man ihm Respekt bei. Was für ein Glück, gerade den Soldaten mitzunehmen, der eine persönliche Rechnung offen hatte! Dabei hatte Sondheim daran nicht einmal gedacht, seine Wahl war einfach auf drei gefallen, die im Ruf standen, beinharte Schläger zu sein. Dass der Wunsch nach Rache die Kraft des Burschen verdoppeln würde, war ein angenehmer Nebeneffekt, den er erst vor Ort erkannt hatte. Visconti am Boden! Sondheims Befriedigung darüber war allerdings nur von kurzer Dauer, denn letztendlich war der verdammte Italiener doch Sieger geblieben. Liebesbriefe!
Aber da waren noch andere Papiere, von einer anderen Hand, in lateinischer Schrift. Die Tinte teilweise verschmiert, also noch nicht trocken gewesen, als er die Blätter im Frack verstaut hatte, das mussten della Mottas Aufzeichnungen sein. Dass sie auf Italienisch verfasst waren, war kein großes Hindernis, wie jeder gebildete Mann beherrschte auch Sondheim leidlich Latein. Es dauerte zwar eine Weile, aber schließlich hatte er die Notizen entziffert. Und schlagartig besserte sich seine Laune.
Della Motta hatte den Briefen das amouröse Geplänkel nicht abgenommen, und mit seinen schriftlichen Gedanken sah Sondheim nun alles klar vor sich. Wie war der Kerl nur auf die Idee gekommen, dass der Schreiber ein Mann war? Aber er hatte Recht, vollkommen Recht! Denn nachdem dem Herzog die Augen einmal geöffnet waren, erkannte er die Schrift. Auch wenn sie verstellt war, künstlich gerundet, so war nun jeder Zweifel ausgeschlossen. Und damit war er dem Pfaffen und seinem Handlanger einen entscheidenden Schritt voraus! Er hatte die Briefe und er hatte den Code, den Schlüssel zu einer Lektüre über eine groß angelegte Verschwörung. Bis in den Palast war der Orden der Schlangen bereits vorgedrungen, unklar war noch, ob er bereits die Zentren der Macht erreicht und sich in den höchsten Kreisen eingenistet hatte. Der Schreiber wollte versuchen, mehr über die Rituale des Bundes herauszufinden, hoffte, so das Übel an der Wurzel zu packen, und die Köpfe des Ordens mit einem Schlag zu fassen. Dann brachen die Notizen ab.
Konnte er mit den vorhandenen Hinweisen selbst hinter die verschlüsselte Botschaft kommen? Alleine, ohne Hilfe? Irgendetwas sollte Diethard erhalten ... Verdammt! Der Prinz hatte es wohl zusammen mit den Briefen aufbewahrt! Und das bedeutete, dass della Motta es nun besaß. Dieser Mistkerl! Nichts hatte er sich anmerken lassen, mit keiner Wimper gezuckt!
Man musste also nochmals suchen. Aber anders, mit den Augen eines Spions. Er würde den Maskierten darauf ansetzen, den Spion, der selbst mit der Schlange zeichnete. Die Briefe durfte er dem gegenüber allerdings nicht erwähnen, Briefe, die die Machenschaften des Schlangenbundes aufdeckten, zu dem er ja ganz offensichtlich gehörte. Sicher war sicher, Söldnern durfte man nie vertrauen und es konnte nicht schaden, ein Druckmittel gegen diesen ominösen Orden und damit auch gegen den Unbekannten in der Hand zu haben. Und wenn die Schlangen hundertmal gegen die Kirche spielten. Gegen die Kirche und della Motta.
Sophie zupfte ärgerlich an ihrem dunklen, hochgeschlossenen Kleid herum und machte aus ihrer üblen Laune kein Geheimnis. »In diesem unmöglichen Gewand kann ich ihm auch nicht auffallen, kein Wunder, dass er nur meine Schwester sieht! Wie eine läufige Hündin hat sie um ihn gebuhlt!«
»Das könnt Ihr ihr aber wirklich nicht verdenken, Prinzessin«, kicherte die Mahr, »der Marchese sieht auch zu gut aus!« Der strenge Blick der Gräfin verunsicherte sie ein wenig, aber das Mädchen wähnte Sophie diesmal auf ihrer Seite und schmollte leise vor sich hin: »Aber es ist doch wahr, wenn die Prinzessin nicht in Trauer wäre, hätte auch sie ihm schöne Augen gemacht.«
»Es ist genug!«, herrschte die Gräfin sie an. »Ihr schweigt besser oder entfernt Euch.«
Fräulein von Mahr warf einen zweifelnden Blick auf Sophie, aber die machte keinen Mucks. Also straffte sie ihren Rücken und hob trotzig das Kinn. »Verzeiht, Gräfin, wenn die Gespräche der Jugend Euer Gefühl für Anstand verletzen. Prinzessin, erlaubt, dass ich mich zurückziehe!« Sie machte vor Sophie den Hofknicks und verließ würdevoll den Salon.
Sophie bedachte sich kurz und schickte dann auch die anderen Damen fort. Nur als auch die Gräfin Anstalten machte, sich zu erheben, hielt die Prinzessin sie zurück. »Auf ein Wort noch, Gräfin.«
Charlotte von Rostow nahm ihre Stickarbeit wieder auf.
»War das wirklich nötig?« Sophie schlug einen unwirschen Tonfall an.
»Solange sie dich vergessen lassen, wer du bist, werde ich sie zurechtweisen.«
»Aber sie hat Recht. Er gefällt mir eben.«
»Nein, Sophie, nein. Nicht so ein Kerl.«
»Warum nicht? Warum darf immer nur Katharina mit schönen Männern tändeln? Warum kann sie sich jeden nehmen?«
»Glaub mir, den magst du ihr ruhig lassen. Der bringt dir nur Unglück.«
»Woher willst du das wissen? Aufgrund deiner reichen Erfahrung mit Männern etwa? Charlotte, Männer sind nicht grundsätzlich schlecht, nur weil sie dich nicht interessieren.«
»Vielleicht nicht alle, aber der eine.«
»Aber ich will zufällig geraden diesen.«
Immer noch die trotzige Göre! Wirst du denn nie erwachsen, Mädchen? »Du kennst ihn nicht einmal.«
»Da hast du vollkommen Recht, und es macht mich wahnsinnig vor Wut! Während ich in meiner Witwentracht schön brav herumsitzen muss, darf sich Katharina an ihn heranmachen. Nur weil ihre Witzfigur von Mann noch lebt.«
»Mäßige dich, Sophie! Du bist nicht wie sie, was bei ihr eine Neckerei ist, würde bei dir sofort nach Ernst aussehen. Katharina spielt mit ihm, während er dir das Herz brechen würde.«
»Ich bin nicht so dumm, wie du tust.«
»Du kennst keine Männer wie den Marchese. Sie meinen, dass ihnen ihr Aussehen alle Rechte über uns erteilt. Wenn du ihm auch nur den geringsten Anlass zur Hoffnung gibst, wird er nicht ruhen, bis er dich verführt hat. Und nachdem er nicht so ein Widerling wie Leopold ist, sondern dir gefällt, wirst du ihn wieder sehen wollen.«
»Ich bin Witwe, ich kann ihn heiraten.«
»Wozu? Nur, damit dich andere Frauen um einen schönen Gatten beneiden, der dich doch nur betrügen würde? Aber er ist ohnehin nicht der Mann, der heiratet und an einem Ort bleibt.«
»Und doch widerstrebt es mir, ihn Katharina zu überlassen.«
Wenn Sophie wüsste!
›Der Marchese ist Euch auf der Spur. Seid wachsam!‹ Den Zettel hatte die Gräfin längst vernichtet, aber sie sah ihn noch allzu deutlich vor sich. Klein zusammengefaltet war er beim Frühstück unter ihrer Kaffeetasse gelegen, mit einer Schlange gezeichnet. Vier Windungen, die nach rechts aufgestellte Schwanzspitze und das aufgerissene Maul mit den deutlich sichtbaren Giftzähnen. Das Zeichen der Schlangenkrieger!
Die Arbeit der letzten acht Jahre stand auf dem Spiel. Acht Jahre, in denen sie Sophie heimlich erzogen hatte, ihren Geist geschult, sie im geheimen Wissen der Schlange unterwiesen, sie gelehrt, dem Wesen der Dinge nachzugehen. Und das alles hinter dem Rücken der Hofschranzen. Nur so waren sie unbemerkt geblieben, nur so hatten die machthungrigen Männer keine Veranlassung gesehen, sie auszuschalten. Und plötzlich rief Leopolds Tod diesen gefährlichen Gegner auf den Plan! Della Motta zeigte sich offen als Verbündeter des Kardinals, und wenn er wirklich für die Kirche spionierte, war jedes Detail, das er über den Orden herausfand, verhängnisvoll. Seit Jahrhunderten ließ Rom nichts unversucht, das alte Wissen auszurotten. Andererseits hieß es auch, dass er gebildet war, mit den Freimaurern in Kontakt stand, wenn er nicht gar selber zu ihnen gehörte. Das war aber um nichts besser, weder die Kirche, noch die Maurer würden den Durchbruch der Schlange zulassen. Die Nachricht des Schlangenkriegers war absolut ernst zu nehmen.
»Charlotte, was ist mit dir? Woran denkst du?«
Ein Treffen zwischen ihm und der Prinzessin ließ sich nicht verhindern. Sollte sie Sophie von der Warnung erzählen? Nein, es war besser, sie ahnungslos zu lassen, della Motta würde ihre Anspannung sofort bemerken. Wenn er wirklich ein Spion war, hatte man kaum einen Anfänger geschickt. Nicht gegen den mächtigen Bund der Schlangen.
»Impossibile, der Marchese schläft noch!«
Ressau hatte sich herabgelassen della Motta selbst aufzusuchen, anstatt ihn zu sich zu bestellen, und nun stand dieser impertinente Diener da und wollte ihn abwimmeln?!
»Dann wecke Er ihn auf!«
»Mit Verlaub, Eminenz, das werde ich nicht tun. Vielleicht beliebt es Eurer Eminenz, im Salon zu warten.« Der freche Kerl ließ ihn einfach stehen und zog sich in die hinteren Räume zurück, aus denen nun Stimmen erklangen. Von wegen Schlaf, der Marchese war also doch bereits wach. Kurzerhand durchquerte Ressau das Arbeitszimmer und sah sich vor dem Schlafzimmer abermals mit dem Diener konfrontiert.
»No, no, no, ich muss Euch bitten, Eminenz, der Marchese kann noch keinen Besuch empfangen!«
»Unsinn«, Ressau schob den Kerl kurzerhand zur Seite, »ich bin Priester und habe weiß Gott schon genügend Personen im Bett gesehen. Hochrangige, und keiner hat sich darüber beschwert, dass er noch keine Toilette gemacht hatte.« Er zog sich einen Stuhl ans Bett heran. »Großer Gott!« Ressau fasste della Motta am Kinn und drehte seinen Kopf zu sich, um die lädierte Wange zu begutachten, die in den unterschiedlichsten Farben schillerte. Della Motta sah ihn aus umschatteten Augen an, er schien tatsächlich eben erst aufgewacht zu sein, war noch unrasiert, und das lange Haar lag wirr auf dem Polster. Das tiefe Schwarz, die dunklen Augen und die Bartstoppeln gaben ihm ein unheimliches Aussehen. Es war das Wilde, das zweite Gesicht des Spions, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. »Ich warte draußen«, haspelte Ressau und stand etwas zu schnell wieder auf. Doch jetzt überließ er della Motta nur zu gerne seinem Diener.
Der unzivilisierte Marchese war ihm ganz und gar nicht geheuer. Mit Hilflosigkeit wäre er zurechtgekommen, aber er spürte das Rohe, die kaum gezügelte Kraft, und dachte erneut an den Bericht von der Verfolgungsjagd in den Hintergängen des Schlosses. Was musste hier in dieser Wohnung vorgefallen sein, um einen Mann wie della Motta, der zweifellos töten würde um sich zu verteidigen, dermaßen zuzurichten? Ressau stellte sich immer abenteuerlichere Szenen vor, obwohl hier im Salon vom gestrigen Kampf nichts mehr zu sehen war. Irgendwer hatte sämtliche Spuren beseitigt.
Eine halbe Stunde später stand der Marchese endlich in der Tür. Die Rasur musste eine schmerzhafte Angelegenheit gewesen sein, dennoch waren seine Wangen vollkommen glatt, selbst an der verletzten Stelle, die nicht überschminkt war. Das Haar glänzte und war im Nacken mit einer Samtschleife lose zusammengefasst. Er trug eine schwarze und hellgraue Seidenstrümpfe, seine Füße steckten in Schnallenschuhen. Dazu ein Hemd mit offenem Kragen. Kein Frack, keine Weste, ebenso wie die fehlende Schminke der Hinweis, dass della Motta das Treffen als höchst privat auffasste. Wohl der Dank dafür, dass Ressau ihn im Bett überfallen hatte, ohne sich darum zu kümmern, ob er sich repräsentabel fühlte.
»Gehen wir ins Arbeitszimmer!« Der Marchese wartete die Antwort nicht ab und begab sich sofort an den Schreibtisch, auf dem bereits die Abschriften der Briefe lagen. Seine Bewegungen waren langsamer als sonst, ohne Spannkraft, jeder Schritt schien ihm Schmerzen zu bereiten. Als er zu sprechen anfing, gab er sich jedoch den Anschein, als hätte er den gestrigen Vorfall bereits weggesteckt, seine Stimme war klar und fest. »Es ist, wie ich vermutet habe, die Briefe berichten von einem Schlangenbund. Er hat schon den Hof erreicht, aber der Schreiber kennt die Köpfe noch nicht.«
»Nennt er Namen?«, erkundigte sich Ressau.
»Nein, zumindest nicht in dem Teil, den ich entschlüsseln konnte. Ihr habt doch die zweite Hälfte der Briefe mitgebracht?«
Ressau legte sie auf den Tisch. »Konntet Ihr etwas über den Schreiber herausfinden?«
»Nur, dass es mit Gewissheit ein Mann ist. Seid Ihr sicher, dass Ihr die Handschrift noch nie gesehen habt?«
»Ziemlich sicher.«
»Also steht er zumindest nicht in regelmäßiger Korrespondenz mit Euch.« Der Marchese hielt das Blatt gegen das Licht. »Was ist mit dem Papier, kennt Ihr das Wasserzeichen?«
»Es wird am Hof benützt, in jeder Kanzlei. Was den Kreis der Verdächtigen auf drei- bis fünfhundert Personen einschränken dürfte«, zischte Ressau sarkastisch. »Die Dienstboten nicht eingeschlossen, die aber kaum schreiben können.«
Della Motta zog einen leeren Bogen aus der Schreibmappe und begann, alle Briefe mit Datum aufzulisten, schrieb den Inhalt in Stichworten daneben. Der Kardinal sah ihm zu, wie er zügig die Feder über das Blatt führte, die Schrift war wie er, elegant und energisch zugleich. Der höfische Marchese gefiel ihm.
Aber das Wilde, Ungebändigte jagte ihm einen seltsamen Schauer über den Rücken. Einen seltsam angenehmen Schauer! Verstohlen sah er della Motta von der Seite her an. Das markante Kinn, den Bluterguss an der Wange, die verkrustete Lippe, dann wieder das Kinn, die Sehne am Hals, die im offenen Hemdkragen auslief, die Haut, die bei jeder Bewegung aufblitzte. Ein dünner Schweißfilm bedeckte della Mottas Brust, und Ressau fiel auf, dass er nicht so aufrecht saß wie sonst und die linke Hand gegen den Leib gepresst hielt. Vom Frühstück hatte er noch nichts angerührt, sondern trank nur Unmengen Kaffee.
Der Marchese tat, als ob er seine Blicke nicht bemerkte, und gab sich vollkommen in die Arbeit vertieft. Sie kamen gut voran, nachdem er den Code bereits geknackt hatte. Zwar wurden keine Namen genannt, doch die Informationen über den Schlangenorden gingen weit, sehr weit. Der Schreiber hatte herausgefunden, wann die Treffen der Ordensmitglieder stattfanden, obwohl es ihm bisher nicht gelungen war, sich bei einem Ritual einzuschleichen. Er hatte in der Ruine alles so vorgefunden, wie er auf dem Plan bezeichnete, aber der Zugang war versperrt.
»Welcher Plan? Habt Ihr einen Plan gesehen, Marchese?«
Della Motta schüttelte den Kopf.
»Ob der Herzog ihn gefunden hat? Das wäre höchst ärgerlich, dann wäre er uns einen weiteren Schritt voraus.«
»Das muss nicht unbedingt sein. Er wird erst im zweiten Teil erwähnt, in den Briefen, die Ihr hattet. In den anderen Schriften ist nur von etwas die Rede, das er sorgfältig aufbewahren sollte.«
»Das stimmt. Also kann er damit gar nichts anfangen.«
»Es sei denn, er erkennt ihn als Plan der Ruine, sie dürfte tatsächlich der Versammlungsort des Ordens sein. Gehen wir die Briefe weiter durch! An welchen Tagen berichten sie ausdrücklich von Schlangen? Ich vermute, dass diese Stellen Zusammenkünfte des Geheimbundes bezeichnen.« Der Marchese setzte ein Kreuz neben die betreffenden Daten und rechnete. »Merkt Ihr etwas? Es ist stets ein Montag, an dem die Schlangen auftauchen. Alle Briefe sind auf einen Dienstag datiert, und die Erlebnisse des Schreibers fanden am Vortag statt. Wahrscheinlich handelt es sich um abendliche oder nächtliche Beobachtungen, die er erst am nächsten Tag zu Papier brachte. Heute ist Freitag, also treffen sie sich in drei Tagen wieder. Wo liegt die Ruine?«
»Ihr wollt doch nicht etwa hin?«
»Wie sollten wir sonst herausfinden, was dort vor sich geht?«
»Aber das ist gefährlich!«
Della Motta schenkte ihm einen mitleidigen Blick.
Ressau zuckte mit den Achseln. »Sie liegt auf einem Hügel, nordöstlich der Stadt. Ihr müsst nur dem Fluss folgen, dann könnt Ihr sie nicht verfehlen. Mit einem schnellen Pferd benötigt Ihr im Galopp eine Stunde.«
Sie arbeiteten weiter, lasen und kommentierten und während sie ihre Ansichten über den Inhalt der Briefe austauschten, glitt della Mottas Feder beständig über das Papier. Ressau hing immer noch fasziniert daran und deshalb entging ihm auch nicht, dass sie auf einmal zitterte. Er konnte richtiggehend zusehen, wie das Zittern erst leise anfing, dann immer stärker wurde und die Schrift fahrig. Trotzdem zuckte er zusammen, als die Feder unter dem Druck der Hand splitterte und mit einem kratzenden Geräusch einen unschönen Strich quer über dem Bogen hinterließ. Della Mottas Körper war unübersehbar zusammengekrümmt, auf seinen Schläfen standen Schweißperlen.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739313153
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2015 (Juli)
- Schlagworte
- Geheimbund Intrige geheimnisvoller verführer machtspiel ehre und macht verschwörungsthriller historische romane anspruchsvoll mantel und degen geheimer beschützer 18.Jahrhundert Krimi Thriller Spannung