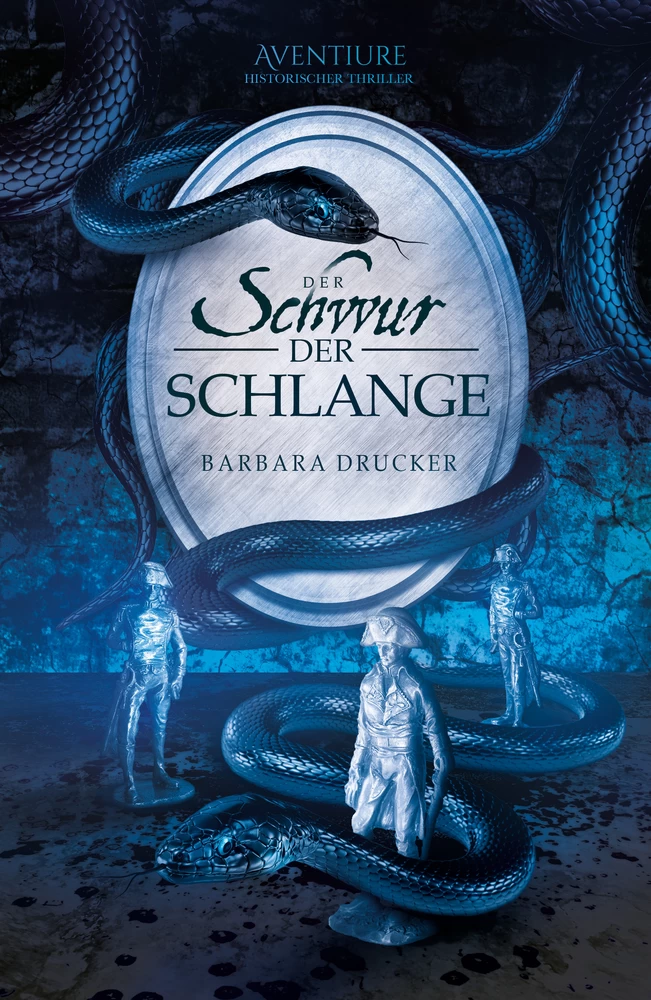Der Schwur der Schlange
Historischer Thriller
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Eine Burg in Oberitalien, 1773
Der Hunger nagte an Riccardo Visconti della Motta, seine Eingeweide rumorten, und obwohl die Sonnenstrahlen tagsüber das Zimmer aufgeheizt hatten, fror er. Beim Rasieren hatten ihm seine Augen aus tiefen Höhlen entgegengeblickt, und das Messer hatte die Bartstoppeln von eingefallenen Wangen geschabt. Achtundzwanzig Tage strenges Fasten schwächten jeden Körper. Doch sein schwarzes Haar glänzte, seine Haut schimmerte wie Porzellan, und sein Blick war so klar wie sein Geist.
»Trinkt«, ermahnte ihn sein Tutor und reichte ihm die Schale mit dem Kräuterwasser. Della Motta versuchte herauszuschmecken, was sie seinem Trunk diesmal beigefügt hatten. Salbei, ein Anklang an Anis und eine gehörige Portion Mohn. Seine Gedanken verloren sich in einem Nebel, durch den rote Blitze zuckten und schwarze Schlangen züngelten.
»Seid Ihr bereit?«
Er streifte die Schnallenschuhe von den Füßen, stieg in die einfachen schwarzen und nickte.
Sie würden zu fünft sein, drei seiner Kameraden warteten bereits in der schmucklosen Kammer, in die der Tutor ihn führte. »Riccardo!« Federigo eilte ihm entgegen, schlug ihm leutselig auf die Schulter und musterte ihn grinsend von oben bis unten. »Fühlst du dich nicht nackt ohne deinen Degen?« Sein flammend rotes Haar hing ihm wie immer wirr um den Kopf, die Schleife, die es zusammenhalten sollte, hing schief.
»Dreh dich um.« Er nahm Federigo an den Schultern und band ihm den Zopf neu. »Wenigstens heute könntest du auf dein Aussehen achten.«
»Wozu? Ich bin der Sohn eines Hufschmieds, kein Adliger.«
»Halt still. Du wirst sehen, sie werden dich am Ende noch strega nennen.«
»Hexe wäre doch mal ein origineller Kriegername.«
»Mir ist egal, wie sie mich nennen.« Der Letzte von ihnen schlenderte herein. »Hauptsache mich ruft niemand mehr Francesco.«
»Was stört dich an Francesco?« Federigo schüttelte den Kopf, doch die Schleife hielt.
»Vor allem der lächerliche Namenspatron, den meine Mutter sich eingebildet hat.«
Della Motta hob den Mundwinkel zu einem spöttischen Lächeln. Der Unterschied zwischen dem eigenbrötlerischen Francesco und dem bescheidenen Heiligen aus Assisi konnte gar nicht größer sein. Auch Franceso war abgemagert, seiner energischen Aura hatte das Fasten jedoch nichts genommen.
»Ich wünschte, meine Familie könnte mich heute sehen!« Federigos Miene nahm schwärmerische Züge an. »Findet ihr es nicht schwer, ihnen nichts zu erzählen?«
»Gewöhn dich besser dran.«
Francesco hatte leicht reden, sein Vater würde der Zeremonie ja beiwohnen.
»Sie erwarten Euch.« In der Tür stand ein Mann, der genauso in schwarze Kniehosen, schwarze Strümpfe und einen schwarzen Rock gekleidet war wie ihre Tutoren, auch an seiner Seite hing ein Degen. Sehnsüchtig schielte della Motta auf die Waffe und unterdrückte ein Lächeln. Federigo hatte recht, ohne Degen fühlte er sich unvollständig.
Der Mann wanderte langsam durch den Raum, musterte sie sorgfältig, ordnete sie nach der Größe und bedeutete Francesco und ihm, die Plätze zu tauschen. Ihr kleiner Zug setzte sich in Bewegung, aufsteigend wie die Karriere im Orden, deren erste Stufe sie nun erklimmen würden. Dass della Motta selbst als Letzter ging, nahm er als vielversprechendes Zeichen.
Im Burghof brannte keine einzige Fackel, nur die Sterne über ihnen spendeten fahles Licht. Millionen von Sternen, heute bei Neumond sah man sie besonders gut, und die Milchstraße zog sich wie ein Schleier aus feinem Staub über das Firmament. Alle wichtigen Zeremonien fanden in den Nächten statt, in denen die Große Schlange sich häutete. Von der hohen Zinne aus beobachtete sie ein Käuzchen und drehte ihnen den Kopf nach, während sie ihre Füße im Gleichklang aufsetzten und schweigend den Hof durchschritten.
Sie erreichten das Hauptgebäude, in dem die große Halle lag. Sie wirkte auf ihn genauso wie vor drei Jahren, nur dass man ihm diesmal nicht die Augen verbunden hatte und er heute statt des mit Borten besetzten Frac à la française lediglich ein weißes Hemd trug. Wie damals wies ihm der Geruch von Feuer den Weg, die hohen Steinmauern warfen das Geräusch ihrer Schritte zurück, und als Federigo sich räusperte, hallte es. An der Seite ihrer Tutoren zogen sie durch das Spalier. Zwölf Männer standen zur Rechten, zwölf zur Linken, vierundzwanzig Zeugen, mit Degen bewaffnet, in der Tracht der Krieger und mit Fackeln in der Hand. Der Mann am oberen Ende nickte Francesco zu, und unwillkürlich kniff della Motta den rechten Augenwinkel ein wenig zusammen. Er wusste, dass Francescos Vater zu ihnen gehörte, doch er hatte nicht geahnt, dass er einen solch hohen Rang bekleidete.
»Brüder!« Feierlich breitete der Meister beide Arme aus, und ebenso feierlich klang seine Stimme. Wie die eines Bischofs in einer Kathedrale. »Wir sind zusammengekommen, um fünf mutige Männer in unsere Reihen aufzunehmen und der Großen Schlange zu weihen.«
Stoff raschelte, als die Zeugen gleichzeitig ihre rechte Hand aufs Herz legten. Della Motta fühlte, dass sein Tutor hinter ihm ebenfalls die Geste vollzog.
»Drei Jahre lehrten wir sie unser Wissen, drei Jahre überstanden sie körperliche und geistige Prüfungen, drei Jahre, in denen wir sie zur kriegerischen Elite des Ordens schliffen. Zwölf junge Männer sind vor drei Jahren angetreten, nur diese fünf haben sich als fähig und würdig erwiesen.«
Der Meister stellte die Tutoren vor, die ihnen sechsunddreißig Monate zur Seite gestanden waren. Die sie zu Unmöglichem angetrieben, die sie nach den unweigerlichen Zusammenbrüchen aufgefangen und ihnen den Schweiß, die Tränen und das Blut getrocknet hatten. Stellvertretend für alle Fechtmeister, Reitlehrer, Meister der Dechiffrierkunst, der Seelenkunde, der Verkleidung, der Spurensuche und all den Künsten, die Spione beherrschen mussten. Della Motta schätzte jeden einzelnen seiner Lehrer, und doch schweiften seine Gedanken hinüber zu seinen Gefährten. Drei Jahre der Kameradschaft, drei Jahre sich aufeinander bedingungslos verlassen.
»Wasser reinigt«, rief ihn die Stimme des Meisters wieder zum Ritual zurück. Wie lange war er mit seinen Gedanken abgedriftet? »Es nimmt die Schminke ab und zeigt uns den wahren, unverstellten Menschen. Wascht euch Gesicht und Hände, zum Zeichen, dass euer Wille und eure Taten aufrichtig sind!«
Ein Schlangenkrieger schritt ihre Reihe ab und hielt jedem von ihnen ein silbernes Becken unter die Hände, ein zweiter goss aus einem Krug Wasser über ihre Finger. Es erinnerte della Motta an die Fußwaschung in der Gründonnerstagsliturgie oder an das Lavabo des Priesters während der Eucharistiefeier. Nur ragte hier kein Hochaltar im Hintergrund auf, sondern das Standbild der Großen Schlange, von einem Feuerbecken beleuchtet. Er musste den Kopf in den Nacken legen, um es in seinem ganzen Ausmaß zu betrachten. Vor drei Jahren hatte man es vor ihm, dem Novizen, verhüllt.
»Die Erde schenkt uns Nahrung und trägt unsere Schritte, abends betten wir unsere Körper auf sie, und am Ende unseres Lebens nimmt sie uns in ihrem Schoß auf. Die Schlange bewegt sich nahe der Erde, sie zeichnet mit ihrem Körper jede ihrer Formen nach. Deshalb ist sie unser Vorbild. Sie ist die Tochter der Erde und steht für unsere enge Verbundenheit mit der Großen Mutter.« Der Meister tauchte einen Finger in eine Schale mit Erde und malte ihnen eine Schlange auf die Stirn. Wie das Sühnekreuz an Aschermittwoch, nur dass der Schlangenkult um etliche Jahrhunderte älter als das Christentum war.
Die Helfer, die vorhin Becken und Krug getragen hatten, traten nun mit einer Räucherschale und einem kunstvoll geschnitzten Kästchen vor den Meister. Della Motta verstand die Worte nicht, die der Meister murmelte, während er dem Kästchen verschiedene Kräuter und Hölzer entnahm, um sie in die Schale zu tun. Die alte Sprache des Kultes konnten nur Priester und Eingeweihte der höheren Grade, doch es würde der Tag kommen, an dem auch er sie beherrschte.
»Die Luft lässt uns atmen«, deklamierte der Meister und fächelte dem ersten von ihnen den Rauch ins Gesicht. »Als Wind kann sie große Zerstörungskraft entfalten, aber ohne sie würden wir sterben. Wie die Luft sind die Gedanken unserer Bruderschaft: mächtig und frei. Atmet!«
Federigo unterdrückte ein Husten. Francesco trat unruhig von einem Bein auf das andere, doch als della Motta ihn verwundert ansah, schüttelte Francesco abweisend den Kopf. Der Duft nebelte nun ihn selbst ein, der Rauch roch nach schwerem, würzigem Holz und machte ihn taumeln. Instinktiv hielt er die Luft an. »Atmet tief ein«, flüsterte sein Tutor von hinten. »Sehr tief.«
Das war ein Fehler, denn jetzt war er regelrecht benommen. Die Halle wankte um ihn, die Silhouetten der Schlangenkrieger verschwammen, und ihm war, als bewegte sich das Standbild und die Schlange kröche auf ihn zu. Die Beschwörung des Feuers bekam er nur mehr am Rande mit, er hörte die Namen seiner Freunde, er merkte, dass sie einzeln vortraten, und spürte, dass sich Francescos Unruhe von Minute zu Minute steigerte. Mühsam versuchte er, die Einzelheiten zusammenzubringen: diese Angst, den Geruch von verbranntem Fleisch, den Rauch, der ihm fast die Sinne raubte. Der Mohn im Trank fiel ihm ein, er durchwühlte seine Erinnerung nach der Wirkung von Mohn, aber er konnte nicht mehr klar denken. Er bekam nicht mehr mit, wann Francesco von seiner Seite wich, um vorzutreten, nur die Worte des Meisters erreichten ihn wie aus einer fernen Welt: »Du bist mutig und stark wie ein Löwe, du wirst einst ein gefürchteter Kämpfer sein. Dein Name sei fortan Leone.«
Er fühlte das zufriedene Nicken von Francescos Vater.
Sein Tutor legte ihm die Hand auf die Schulter, schob ihn sanft vor, und mechanisch stieg della Motta die vier Stufen zum Standbild hoch, vor dem der Meister ihn erwartete. In der Feuerschale knisterte Holz, ein seltsam geformtes Eisen mit hölzernem Griff lag zwischen den Scheiten.
»Knie nieder!«
Der Boden unter ihm war kalt, die Reflexe der Flammen zuckten über das Gesicht des Meisters.
»Das vierte Element ist das Feuer, es bringt Wärme und Licht oder Vernichtung. Das Feuer steht für unseren Willen. Nichts geht über den Willen der Gemeinschaft. Schlage den linken Ärmel hoch!«
Er tat es, und kaum fiel sein Blick auf seinen entblößten Arm, schoss ihm das Wissen um die betäubende Wirkung des Mohns zurück ins Gedächtnis. Auf einmal machte Leones Angst Sinn, der eklige Geruch und die Mahnung des Tutors, den Rauch zu inhalieren.
»Reiche mir deine linke Hand!«
Er musste sich zwingen, den Arm auszustrecken, zitternd ruhte seine Hand in der des Meisters.
»Riccardo Visconti, fühlst du dich der Aufgabe eines Schlangenkriegers gewachsen?«
»Ja.«
»Die Zugehörigkeit zu unserem Bund ist ewig, und so muss auch deine Entscheidung sein – stets und für immer gültig. Bist du dazu bereit?«
»Ja.«
»Versprichst du, das Wissen, das wir dich gelehrt haben, für die Interessen des Ordens einzusetzen?«
»Ich verspreche es.«
Der Meister umschloss seine Hand fest und sah ihm lange und bedeutungsvoll in die Augen. »Riccardo Visconti, schwörst du, fortan jede Schlange zu beschützen und mit deinem Blut zu verteidigen?«
Er erwiderte den Blick mit tiefstem Ernst, seine Stimme ließ seine Brust vibrieren und mit jeder Faser seines Körpers antwortete er: »Ich schwöre.«
»So trage die Schlange bis an das Ende deines Lebens.«
Der Meister griff nach dem glühenden Eisen, der Tutor umschloss fest della Mottas Schulter, und della Motta lief der Schweiß von den Schläfen. Ich schwöre, betete er sich vor, mit meinem Blut zu beschützen, ich schwöre! Er atmete tief ein, füllte seine Lungen mit Luft und spannte seine Muskeln an, um der Folter etwas entgegenzusetzen. Der Schmerz kam plötzlich und heftig, er versuchte, den Arm wegzureißen, aber der Meister hielt ihn fest und presste unerbittlich das Eisen auf seine Haut. Die Luft blieb ihm weg, er kämpfte gegen die Übelkeit an, krümmte sich zusammen und berührte mit der Stirn den Boden. Aber er schrie nicht.
Er zitterte am ganzen Körper. Zwei Schlangenkrieger legten ihm einen Mantel um die Schultern und richteten ihn auf. Er fühlte das feierliche Gewicht. Solch einen Mantel hatten einst die Kreuzritter getragen, lang und weit, aus weißem Stoff. Nur prangte auf seinem nicht das Ritterkreuz, sondern die vierfach gewundene Schlange. Der Meister schob ihm den Siegelring der Schlangenkrieger über den Finger. »Du bist gebildet und klug, du bist geboren für die großen Höfe und wirst einst Fürsten gängeln. Du bist der Aristokrat unter den Schlangenkriegern und wirst einmal den weltlichen Titel deines Vaters erben. Von nun an sei auch dein Kriegername ›Marchese‹.«
Einer der Helfer reichte dem Meister einen Degen mit polierter Klinge und kunstvoll ziseliertem Stichblatt. Der Griff war mit dunkelblauer Fischhaut und silbernen Schnüren umwickelt. Der Meister berührte mit der Klinge erst della Mottas linke Schulter, dann die rechte und noch einmal die linke und hielt ihm die Waffe mit dem Griff voran entgegen.
»Von nun an gehört dein Leben den Schlangen, und die Schlangenkrieger weihen dir das ihre.«
1
Das Jahr 1788 brauchte Männer wie ihn. Cesare Scarlatti lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und betrachtete das Portrait seines Namensvetters. Cesare Borgia, Machiavellis Vorbild für Il Principe, den Machtpolitiker und perfekten Fürsten. Heute waren die Zeiten genauso stürmisch wie vor dreihundert Jahren, und die Stunde schlug kühnen Männern mit großen Plänen.
Er beendete seine Zwiesprache mit dem Renaissancefürsten und beugte sich wieder über die Nachricht. Sein Haar fiel ihm dabei über die Schultern, er trug es offen wie sein Idol, und die einzelne weiße Strähne zerschnitt sein Gesichtsfeld in zwei Teile. Er klemmte sie hinters Ohr und las zum dritten Mal den Brief. Straßburg! Wütend krallte er die Finger um den Schrieb und zerknüllte ihn in seiner Faust. Auf dem Schafott sollte Marconi sein oder wenigstens in der Bastille! Der sollte seine Litaneien beten, zur Großen Schlange und seinetwegen auch zu allen Heiligen, römischen Göttern, griechischen Göttern, persischen und wusste der Teufel, welche ihm sonst noch einfielen. Stattdessen schickte er Briefe! Was brauchten die in Reims denn noch? Namen, der Treffpunkt, die genaue Zeit! Ein Staatsfeind auf dem Silbertablett, nur zugreifen hätten sie müssen!
Scarlatti strich das zerknüllte Papier wieder einigermaßen glatt. Wut löste keine Probleme. Was hätte Cesare Borgia getan?
Alle Dämonen der Hölle mussten Marconi beigestanden haben! Wenn er dem jetzt keinen Schlangenkrieger schickte, konnte er gleich ein Schuldeingeständnis unterschreiben und es dem Rat unterbreiten.
»Wie heißt der Mann, auf den Marconi so große Stücke hält?«
»Der Priester? Kiefer.« Sein Sekretär hatte wie immer geduldig gewartet und Scarlattis Gedankengänge nicht unterbrochen.
»Nein, der von uns.«
»Chrétien.«
»Der soll ihn aus Straßburg herausholen.« Er kannte Chrétien lediglich aus Berichten, nur mehr wenige Schlangenkrieger führte er selbst. Sein Talent verschwendete er nicht für Routinen und schon gar nicht für Bürokratie, Cesare Scarlatti plante im großen Maßstab. Während sein Sekretär das gut geölte Räderwerk in Schwung setzte und Chrétiens Auftrag zusammengestellt wurde, machte er sich an die eigentliche Arbeit.
In Europa gärte es, in den Debattierklubs und Freimaurerlogen wurden immer kühnere Gedanken geäußert, die Journaillen schrien die Unzufriedenheit der Bürger laut heraus, und die Druckerpressen standen keinen Augenblick still. Die Notabelnversammlung war gescheitert, die Staatskasse immer noch leer, doch der Adel verteidigte seine Privilegien mit der gleichen Energie, mit der die Bürger sich darüber empörten. Kein Tag verging, an dem nicht eine neue Flugschrift kursierte. Die Zeit war reif, und wenn das Pulverfass hochging, dann konnte er keinen Sand im Getriebe des Ordens gebrauchen.
Flugschriften. Erst heute hatte er doch wieder eine über die Österreicherin gesehen, und das brachte ihn auf eine neue Idee. Sein Werkzeug war falsch gewesen, er musste jemanden benutzen, der ein persönliches Interesse daran hatte, ihm den Stachel aus seinem Fleisch zu schneiden. Jemanden, dessen eigenes Wohl vom Gelingen abhing. Marconi war in Straßburg und in Straßburg war Kardinal Prince Rohan. Scarlatti kniff die Augen zusammen und dachte den Gedanken noch einmal von Anfang bis zum Ende durch. Der als Halsbandaffäre bekannte Skandal hatte den Kardinal nicht nur mehrere hunderttausend Livre gekostet, sondern auch sein Amt als Großalmosenier und den Zugang zum Hof. Arglos war Rohan damals auf die Betrüger hereingefallen und hatte im Namen der Königin um das kostbarste Halsband Europas verhandelt, ebenso arglos würde er eine Gelegenheit ergreifen, sich zu rehabilitieren. Scarlatti durchsuchte die Blätter auf seinem Schreibtisch, zog die pornografische Skizze hervor, die Marie Antoinette darstellte, und hielt sie neben Marconis Brief. Ja, nickte er und griff zur Feder. Während das Volk die verschwenderische Königin hasste, gäbe der Kardinal alles, um ihre Gnade zu erlangen.
›Werter Prince,
Dankt mir, denn ich habe ein sicheres Mittel gefunden, Euch wieder in die Gunst Ihrer Majestäten zu setzen! Ihr werdet den König von einer großen Sorge befreien, sodass er nicht anders kann, als Euch zu vergeben. Selbst Marie Antoinette wird ihren ergebenen Diener in Euch erkennen.
Vor einigen Tagen zog Giovanni Marconi als Mitverschwörer des Herzogs von Orléans den königlichen Zorn auf sich, konnte jedoch fliehen. Wie ich soeben erfuhr, will es Euer Glück, dass Marconi sich bei den Juden in Straßburg versteckt hält. Ihr versteht, dass der König in Anbetracht seiner verwandtschaftlichen Beziehung zum Duc d’Orléans eine diskrete Lösung bevorzugt.‹
Er zeichnete mit dem Namen, den er Rohan gegenüber bereits früher benutzt hatte, und versiegelte den Brief. Aus der Karaffe schenkte er sich Wein ein und prostete Cesare Borgia zu. Ihr wart ein hervorragender Lehrmeister, Herzog von Valentinois!
Finster und monumental wie ein Wehrbau ragte Notre-Dame auf, die Wasserspeier starrten drohend auf Leone herab, doch er ließ sich von ihnen nicht beeindrucken und bog in die schmale Gasse ein. Falls sie je nach einem Muster angelegt worden war, musste es im Kopf eines Verrückten entstanden sein. Nicht einmal zu Mittag leuchtete die Sonne alle Winkel aus, geschweige denn jetzt, nach Einbruch der Dämmerung. Von den Fassaden blätterte der Verputz und entblößte das Mauerwerk, Wind und Wetter hatten die Fensterrahmen verzogen und das Holz aufspringen lassen. Nichts wies darauf hin, dass hier ein Advokat seine Räumlichkeiten hatte.
Leone drückte die Pforte auf und betrat das finstere Stiegenhaus. Es roch muffig, nach jahrhundertealtem Gemäuer, und in unterschiedlichen Grüntönen zeichnete Schimmel bizarre Muster auf die Mauern, gelegentlich unterbrochen von Wasserflecken. Die Fenster hatte seit Jahrzehnten niemand gereinigt, sie waren trüb von Regenspuren, Staub und Fliegendreck und ließen gerade genug Licht herein, um die ausgetretenen Steinstufen zu erkennen. In einer Wendeltreppe schraubten sie sich nach oben, eine schiefe Schnecke, die sich spiralförmig bis unters Dach verlor.
Die Tür in der dritten Etage war ebenso so roh gezimmert wie alle anderen und unterschied sich von ihnen nur durch das gute Schloss. Leone zog einen Dietrich aus der Rocktasche und schob ihn ins Schlüsselloch, bewegte den ersten Bolzen, da ließ ihn ein Geräusch aufmerken. Er stutzte, horchte genauer und erkannte schwerfällige Schritte, die über einen Dielenboden stapften. Wer da drinnen herumging, rollte die Füße nicht ab, sondern setzte sie mit der kompletten Sohle auf, als stakste er durch einen Sumpf. So gingen Marionetten. Und so ging Merteuil, der an den Fäden der Schlangenkrieger tanzte.
Es war ungewöhnlich, dass sich der Alte um diese Zeit noch in der Kanzlei aufhielt, und hätte Leone ihn nicht rechtzeitig gehört, wäre ihm diese Abweichung von Merteuils Gewohnheiten zum Verhängnis geworden. Er zog den Dietrich aus dem Schloss und huschte die Wendeltreppe hinauf, bis zu dem Punkt, von wo aus er Merteuils Tür beobachten konnte, ohne sich selbst in dessen Blickfeld zu befinden. Kaum hatte er seinen Posten bezogen, schimmerte ein schwacher Lichtschein unter der Ritze zwischen Türblatt und Fußboden ins Stiegenhaus.
Merteuil mochte ein Krüppel sein, doch Ohren hatte er wie ein Luchs. So leise Leone auch gewesen war, er musste das Tasten mit dem Dietrich bemerkt haben, denn er öffnete die Tür und spähte misstrauisch nach beiden Seiten. Wie eine Schildkröte aus ihrem Panzer schob er den Kopf vor, erst nach links, dann nach rechts. Dass er nichts erkennen konnte, ließ ihm keine Ruhe, jetzt klemmte er sich sein Monokel vors Auge. Von hier oben konnte es Leone zwar nicht sehen, doch er war Merteuil oft genug von Angesicht zu Angesicht gegenübergesessen, um zu wissen, dass die Sehhilfe Merteuils wässrig braune Iris ins Gigantische vergrößerte.
Der Alte ging ihm nicht einmal bis zur Brust, und das trotz der mindestens fünf Zoll dicken Sohlen. Diese waren auch schuld an seinem eigenartigen Gang, mit dem er sich nun durch das ganze Stockwerk bewegte. Er presste das Ohr an jede Tür, inspizierte jede Nische und jeden Spalt, und als er nicht fündig wurde, setzte er einen Fuß auf die Treppe. Leone schlich ins fünfte Stockwerk, so weit würde Merteuil wohl kaum hinaufsteigen.
Merteuil schnaufte bis zur vierten Etage, es sah aus, als ob seine Knie an Fäden hingen und der Puppenspieler das Spielkreuz wechselseitig anhob. Für einen Moment verharrte der Zwerg, horchte, kehrte vor sich hin schimpfend wieder um, und die Kanzleitür schloss sich hinter ihm. Leone gab sich eine Viertelstunde, dann lief er die Treppe hinunter und verließ das Haus.
Er wartete schräg gegenüber, verborgen zwischen altem Holz und Unkraut. Mäuse guckten ihn aus ihren Knopfaugen misstrauisch an und flitzten davon, zum wiederholten Mal wischte er die Ranke zur Seite, die ihn an der Wange kitzelte. Seine Hand verfing sich in Spinnweben, und er wischte sie am Hosenbein ab. Außer einem Tausendfüßler und ein paar Asseln kroch nichts über das Pflaster. Fast wollte er die Hoffnung schon aufgeben und sich damit abfinden, dass Merteuil offenbar in der Kanzlei zu übernachten gedachte, da quietschte die Tür in den Angeln. Langsam stieg der Alte über die Schwelle und stakste in Richtung der Kathedrale davon.
Wenige Minuten später klickte oben das Schloss, und die Tür öffnete sich nach innen. Schnurstracks ging Leone in Merteuils Büro. Dort nahm ein wuchtiger Schreibtisch gut und gerne die Hälfte des Zimmers ein, auf ihm türmten sich Stapel an Briefen und Paketen in unterschiedlichen Größen und ließen nur ein kleines Rechteck frei. Auf dem wackligen Stuhl war er früher oft genug gesessen, während er darauf wartete, dass Merteuil ihm seinen Auftrag heraussuchte. Heute bediente er sich selbst, und mit Sicherheit stand auf keinem einzigen Paket sein Name.
Die schweren Vorhänge schluckten das wenige Licht, das von draußen noch hereinkam, und Leone förderte aus den Tiefen seiner Tasche einen Kerzenstummel zutage. Der Zwerg war einfach zu vorsichtig, und es hätte ihn nicht gewundert, wenn Merteuil die Höhe der vorhandenen Kerzen markierte, bevor er die Kanzlei verließ.
Sieben Pakete nahm Leone aufgrund der Adressen in die engere Wahl, alles, was nicht ins nördliche Frankreich oder zumindest in die Österreichischen Niederlande ging, schied er von vornherein aus. Nach und nach erbrach er die Siegel und blätterte in den Papieren. Zwei verwarf er sofort, zwei andere legte er zur Seite. Beim fünften schwankte er. Er müsste Anpassungen vornehmen, Teile davon verschwinden lassen. Es wäre nicht das erste Mal. Auf jeden Fall diese Miniatur verbrennen, dort den Namen des Schützlings ändern.
Eine Diele knarrte. Alarmiert hob er den Kopf, doch das Geräusch wiederholte sich nicht. Er zog den Dolch, postierte sich hinter der Tür und wagte kaum zu atmen. Nichts. Holz knackte, aber da war kein marionettenhaftes Schlurfen. Er warf sich um die Tür herum und in den Flur, doch auch der war leer, er riss die beiden anderen Türen auf, doch die führten in verwaiste Räume, in denen sich Dokumente bis unter die Decke stapelten. Nicht einmal Spinnen bevölkerten die Kammern.
Beruhigt ging er zurück. In jedem Haus arbeitete das Holz und dehnte sich nächtens aus. Die Schritte, die er jetzt hörte, kamen von oben. Er setzte sich wieder und machte sich erneut über die Aufträge her. Das sechste Paket war an Chrétien adressiert und im Vergleich zu den anderen relativ schmal, doch als Leone es las, wusste er sofort, dass dieses das richtige war. Das siebente ließ er ungeöffnet.
Er musste nicht einmal etwas ändern, es della Motta nur geschickt zuspielen. Mit einem Begleitbrief versehen, natürlich nicht von eigener Hand, doch für Geld fanden sich genügend Schreiber, die keine Fragen stellten. Er faltete sämtliche Briefe an den bereits vorhandenen Knicken zusammen, verstaute Skizzen und Dokumente, nur mehr versiegeln musste er die Pakete. In der Schublade befand sich eine Stange Siegelwachs, aber er wusste, dass Merteuil darin auch einen Bindfaden aufbewahrte, mit dem er jeden Abend das Wachs abmaß. Er fischte eine eigene Stange aus dem Rock und zog den letzten Gegenstand aus seiner Rocktasche. Das Siegel mit der vierfach gewundenen Schlange.
Ein altfranzösisches Volkslied vor sich hinpfeifend ging ein Mann hinunter zur Seine und hüpfte beinahe vor Glück. Gute Geschäfte, mutmaßte der Händler, der ihm entgegenkam und über seine Schulter einen letzten Blick auf den vergnügten Kerl warf. Toller Stich, dachte der junge Student, der um die Ecke bog und zu den Hörsälen der Sorbonne weitereilte. Glück im Spiel, vermutete der Bettler am Anfang der Brücke, als eine Münze in seine Mütze fiel. Falscher Auftrag, dachte Leone mitten auf der Brücke, als er Chrétien den Dolch seitlich in den Hals trieb, das Päckchen aus seinem Rock zog und den Schlangenkrieger in den Fluss stieß.
2
»Ma no! Aspetta, Tom, warte!« Giacomo hetzte die Stiegen herauf, aber der jüngere der beiden Bengel rannte della Motta schon vor die Füße. Um ein Haar wäre er über den Knirps gestolpert, der offenbar eine Antilope gab, während ihn sein Bruder als Löwe verfolgte.
»Herrgott noch mal, kann Sie die Bande nicht im Zaum halten!«
Eben hatte die Antilope noch vor Vergnügen gequietscht, jetzt schielte sie kleinlaut an ihm hoch. Am unteren Deck plärrte die Schwester der Jungen, mit einer Stimme, die einen aus der Haut fahren ließ, und erfahrungsgemäß hatte sie Tränen, die für einen ganzen Ozean reichten.
»Verzeiht, Marchese!« Endlich stürzte auch die Gouvernante herbei, packte den Knaben am Handgelenk und zog ihn hastig mit sich.
»Es sind Kinder«, versuchte Giacomo ihn zu beschwichtigen, kaum hatte das Pack den Rückzug angetreten.
»Ich kann Kinder nicht leiden.«
Della Motta ging die paar Schritte zur Reling, stützte die Unterarme auf und sah zu, wie die Häuser von Calais allmählich größer und deutlicher wurden. Die Pfiffe des Bootsmanns riefen die Matrosen an die Taue, und in eingespielten Handgriffen reffte die Mannschaft die Segel, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das Schiff machte eine Drehung, neigte sich leicht und tauchte ins nächste Wellental ab. Die Gischt sprühte herauf und ihm ins Gesicht, er ließ sie auf der Haut trocknen und atmete tief ein. Noch roch die Luft frisch, die steife Brise zerrte an seinen Haaren und den Manschetten.
»Ihr habt ihr wieder geschrieben«, überschrie Giacomo die knatternden Segel und ließ della Mottas Dreispitz nicht aus den Augen. Seine Hand zuckte mehrmals, als wolle er den Hut am Davonsegeln hindern.
»Gib die Briefe heute noch einem Kurier.«
»Sie kann Euch ja doch nicht antworten.«
Darauf kam es nicht an, denn es war das Einzige, das er tun konnte. Mit jedem Brief fragte er sich, wie es Sciarlotte in den letzten zweieinhalb Jahren ergangen war. Er stellte sich vor, sie in den Arm zu nehmen und ihr Zärtlichkeiten ins Ohr zu flüstern, hörte ihr zu, wenn sie über ihre Pläne für das Fürstentum sprach. Er hing an ihren vor Tatendrang sprühenden Augen, an ihrer ernsthaften Miene, bewunderte sie für ihre Visionen, wie sie das Leben der Bevölkerung erleichtern wollte. Wenn Sophie klug war, tat sie, was Sciarlotte vorschlug, dann blieb das Fürstentum zwar immer noch klein und spielte eine unbedeutende Rolle im europäischen Kräfteverhältnis, doch seine Bewohner konnten aufblühen. Sciarlotte dachte wie eine Hohepriesterin der Schlangen.
Hätte er an ihrer Seite zum Glauben an die Große Schlange gefunden? Wohl kaum. Ihn faszinierte ihre Würde, ihn beeindruckte ihre Überzeugung, aber er wusste zu viel, um ihren Idealismus zu teilen. Von jeher hatte er im Orden nicht die Religion, sondern die Macht gesehen, die Intrigen des Geheimbundes trieben ihn bis in die hintersten Winkel Europas und das letzte Jahr sogar über den Ozean. Er war froh, wieder zurückzukommen. Als Adeliger war er für die aufstrebende bürgerliche Nation nicht geschaffen, er hasste dieses Land und sehnte sich nach Kultur und nach der alten Gesellschaftsordnung. Und nicht zuletzt danach, nicht mehr auf seine Informanten angewiesen zu sein, sondern unmittelbar in die Ränkespiele innerhalb des Schlangenordens eingreifen zu können. Karriere machte man nicht in der Ferne.
Wie riesige Raffrollos zogen die Matrosen die Segel nun komplett hoch, unten näherten sich Boote und schleppten das Schiff ins Hafenbecken. Sehen konnte della Motta von seinem Standort aus nichts, er hörte nur den Bootsmann seine Kommandos pfeifen und Holz knirschen. Mit einem heftigen Stoß rumpelte das Schiff gegen die Kaimauer, und Giacomo torkelte gegen ihn.
»Du solltest dich um das Gepäck kümmern.«
»Certo!« Mit beiden Armen bahnte sich Giacomo einen Weg durch die Menge, die sich mittlerweile an Deck drängte. Die meisten kamen wie sie aus Boston, waren in Southampton sofort umgestiegen und wollten nach der wochenlangen Überfahrt feste Häuser statt endloser Wassermassen sehen. Anstatt sich von aufgeregten Menschen anrempeln zu lassen, überließ della Motta ihnen seinen Platz an der Reling. Lieber verfolgte er, wie hoch über ihm die Seeleute die letzten Segel bargen und die Wanten herunterkletterten.
Vier Uniformierte und ein Zivilist mit einer Schreibmappe in der Hand kamen an Bord. Der Kapitän überreichte dem Zivilisten die Schiffspapiere und ließ sich vom Zahlmeister ein Buch geben, vermutlich die Passagierliste. Der Hafenbeamte klemmte seine Mappe unter den Arm und blätterte in der Liste, fuhr mit dem Finger die Namen entlang und stellte eine Reihe von Fragen, dann stempelte er die Dokumente ab. Er nickte den Soldaten zu, und das Fallreep wurde freigegeben.
»Marquis de Môtà?!«
Schon vom Schiff aus war ihm der sommersprossige Junge aufgefallen, der die Ankömmlinge genau musterte und ausschließlich gut gekleidete Männer um die vierzig, schlank und hochgewachsen, ansprach.
»Oui, c’est moi.«
»J’ai une lettre pour vous.«
Er sah den Streuner nicht einmal an, sondern fertigte ihn mit einer Münze ab, während er das schmale Päckchen umdrehte. Sein Blick fiel auf das Siegel, sofort hob er den Kopf, doch der Junge machte sich bereits aus dem Staub.
»Attends! Un instant!«
Für einen Augenblick starrte der Junge ihn an, dann stürzte er davon.
»Attends!« Della Motta packte die Leute an den Schultern, riss Gesprächspartner auseinander, aber der Bengel war flink wie ein Wiesel und krabbelte bereits unter einem Fuhrwerk durch. Della Motta schlingerte noch darum herum, während der Junge schon in der nächsten Gasse verschwand. Ein Obstkarren fuhr vor und versperrte ihm den Weg, er kletterte darüber und riss einen Haufen Früchte mit sich, glitt auf dem zermatschten Fruchtfleisch aus, der Bursche flitzte unter den Ladentischen der Straßenhändler durch, er im Lauf darüber. Der letzte Tisch krachte unter seinen Tritten zusammen, aber der Junge war nur mehr ein paar Schritte entfernt. Ein, zwei gewaltige Sätze, nochmals ums Eck, und in der nächsten Gasse war Schluss. Er drängte den Bengel an die Hausmauer.
»Qui t’a donné la lettre?«
In den Augen des Jungen blitzte es auf, aber sein Ausbruchsversuch endete im Arm des Marchese.
»Qui t’a donné celle-ci? Wer hat dir diesen Brief gegeben?«
»Bitte, Monsieur! Lasst mich gehen!«
»Solche Briefe vertraut man keinem Botenjungen an!«
»Ich darf es nicht sagen!« Der Bengel strampelte, aber della Motta hielt ihn fest. Der Bursche begriff, dass ihm der Marchese im Moment gefährlicher werden konnte als derjenige, der ihn mit dem Brief losgeschickt hatte. »Er war nichts Besonder’s, der Mann, mein ich. Ich erkenn ihn nicht wieder.«
»Größe?«
»Kleiner als Ihr. Normal halt.«
»Statur?«
»Nicht dick, nicht dünn.«
»Wie ging er?«
»Hä?«
»Wie ging er? Aufrecht? Gebückt?«
»Normal halt.«
»Haare?«
»Wie eine Maus.«
»Augen?«
Der Junge überlegte krampfhaft. »Weiß nicht.«
»Das Gesicht: schmal oder rund?«
»Keine Ahnung. Wie jeder halt.«
»Kleidung?« Es war sein letzter Versuch. Kleidung konnte man wechseln und ein Dutzendgesicht nur anhand einer vagen Beschreibung zu finden, war unmöglich. Die Antwort hätte er sich auch selbst geben können.
»Normal halt.«
Er griff in die Tasche und steckte dem Jungen eine zweite Münze zu. »Verschwinde!«
Das ließ sich der Bursche nicht zweimal sagen, schlüpfte unter seinem Arm durch und sah zu, dass er das Weite gewann.
Della Motta ging die Gassen zurück zum Hafen, so gut kannte er sich in Calais nicht aus, dass er das Gasthaus über die Schleichwege gefunden hätte. Den Straßenhändlern warf er Münzen für die beschädigten Waren und Tische zu, der Obsttransporteur war bereits fort. Im Hafen spuckte das Schiff gerade die Meute aus, und er nahm die erstbeste Droschke, um dem Pöbel zu entgehen.
Giacomo war noch nicht hier, mit Sicherheit dirigierte er gerade Lastträger und Fuhrwerker und wachte darüber, dass das Gepäck vollständig und unbeschadet vom Schiff zum ›Goldenen Schlüssel‹ gebracht wurde. Normalerweise regelte er die Unterkunft, so aber musste della Motta selbst mit dem Wirt verhandeln und war überzeugt, einen zu hohen Preis für die Suite zu bezahlen, doch es kümmerte ihn nicht. Er erklomm die Stiegen zum ersten Stock und schloss die Tür auf.
Der Kapitän hatte ihm die Herberge empfohlen, doch der großspurige Name täuschte. Was sich Suite nannte, waren zwei stickige Zimmer und eine enge Garderobe, in der sich auch eine Pritsche für den Kammerdiener befand. Er warf den Hut auf die Pritsche und öffnete das Fenster im ersten Raum. Es war Mitte Mai, und entsprechend warm strömte die Luft herein, in ihr vermischte sich der Geruch des Meeres mit dem Gestank von Küchenabfällen und Pferdemist. Von der Straße kam Rumpeln herauf, er lehnte sich aus dem Fenster, um die Ursache auszumachen. Weinfässer wurden von einem Karren abgeladen und ins Haus gerollt.
Das hintere Zimmer wurde fast zur Gänze vom Bett eingenommen, er öffnete auch hier das Fenster und begab sich zurück in den sogenannten Wohnraum. Ein Sofa, ein Sessel, ein kleiner Tisch und eine Konsole. Ein schief hängendes Bild an der Wand, ein schlechter Kupferstich einer beliebigen Ruine vor einer noch beliebigeren Landschaft. Er wählte den durchgesessenen Sessel, weil hier das Licht besser war, und zog das Paket aus dem Frack.
Poltern auf dem Gang riss ihn aus der Lektüre. Aus der vierten oder fünften, immer wieder studierte er die Zeilen in der Hoffnung, er hätte falsch gelesen. Die Tür, die er für Giacomo unversperrt gelassen hatte, flog auf, und sein Diener wirbelte in die Suite, kam aber nur bis zur Schwelle des Wohnzimmers. Ein Blick in della Mottas Gesicht genügte, Giacomo drehte auf dem Absatz um und machte den Packträgern Beine. In unglaublicher Geschwindigkeit wurden Koffer und Schachteln, Taschen und Waffensäcke verstaut, dann entlohnte Giacomo die Träger und drehte hinter ihnen den Schlüssel im Schloss um.
»Post?« Er hatte den Dreispitz von der Pritsche aufgelesen und streifte imaginäre Stäubchen ab.
Della Motta nickte, hob den äußeren Umschlag hoch und ließ Giacomo einen Blick auf das Siegel werfen.
»Wenigstens spart Ihr Euch den Weg nach Paris.«
»Ich frage mich nur, wer den nach Calais gemacht hat.« Was war Merteuil nur eingefallen, solche Post in die Hände eines Straßenjungen geraten zu lassen! »Wir haben keinen Vertrauensmann in dieser Stadt. Zumindest hatten wir keinen, als ich nach Amerika aufbrach.«
»Und was heißt das?«
»Dass der Kurier den Brief eigenmächtig einem unbekannten Botenjungen ausgehändigt hat. Einem Bengel, der gerade einmal meinen Namen kannte und wusste, wie ich in etwa aussehe.«
»Ganz schön riskant.« Giacomo hatte aufgehört, Stäubchen zu entfernen, und drehte den Hut in den Händen.
»Der Befehl galt ursprünglich Chrétien.« Den Namen hatten sie ihm nach dem Dichter von Troyes gegeben, weil er ständig alte Lieder pfiff.
»Woher wisst Ihr, dass der Auftrag für ihn war?«
Della Motta hielt Giacomo den zweiten, eigentlichen Umschlag des Paketes hin. Darauf prangten in säuberlicher, ihm wohlbekannter Schrift der Namenszug Chrétien und eine Pariser Adresse. Und darunter in anmaßend großen Buchstaben: ›Chrétien stieß ein Unglück zu. Ihr haltet Euch Straßburg am nächsten auf und müsst übernehmen.‹ Er kannte die Handschrift nicht, aber sie stammte von derselben Person, die ›Marchese della Motta‹ auf den äußeren Umschlag geworfen hatte. Entgegen seiner Gewohnheit und entgegen den Regeln der Schlangenkrieger verbrannte er den Umschlag nicht, sondern faltete ihn zusammen und schob ihn in sein Portefeuille.
Della Motta drehte sich zum hundertsten Mal im Bett um. Leichter Wind blähte den Vorhang, ein Falter hatte sich ins Zimmer verirrt und stieß in unregelmäßigen Abständen gegen die Wand. Die Straße unten war jetzt wie ausgestorben, kein Geräusch kam durch das offene Fenster. Er hatte das Gefühl, dass sein Bett schaukelte, eine Nachwirkung der langen Seereise. Er überließ sich dem Schaukeln, ließ sich treiben, glitt vom Wellenkamm ins Tal, und die nächste Woge erfasste ihn.
Marconi. Er warf sich herum, schob den Arm unter das Kopfkissen und zerknüllte es. Warum ausgerechnet Marconi? Es wäre so einfach. Vorgeben, den Auftrag nie erhalten zu haben. Oder zu spät kommen, abwarten, dass die Franzosen Marconis Versteck fanden. Nur mehr Zeuge der Hinrichtung werden, bedauernd Meldung erstatten. Marconi. Mit seinem Tod würde sein Platz frei, und della Motta hatte die Triumphe von Boston in der Tasche. Die nächste Stufe zum Greifen nahe!
Gegen Morgen war er endlich in einen unruhigen Schlaf gefallen. Giftschlangen glitten über gekachelte Böden, schlängelten sich an siebenarmigen Leuchtern hoch und fädelten sich zwischen den Kerzen durch. Umwickelten mit ihren Leibern eine Thora-Rolle und schlüpften unter einen hebräischen Gebetsschal. Krochen weiter, erkundeten einen Dreispitz, umwanden einen Degen, ringelten sich an der Klinge hoch und flochten sich um das Stichblatt. Zogen ihre Körper über einen Saphirring, glitten weiter um das Wasserglas herum, züngelten über das Kopfkissen und schossen schlängelnd auf ihn zu. Er griff nach dem Degen, mitten hinein in die giftige Brut, die Zähne schlugen sich in seine Hand, das Gift strömte in seinen Arm. Eine Viper legte sich um seinen Hals, ihre Zunge zitterte über seine Halsschlagader, er verwandelte sich in eine Kobra, bäumte sich auf, aber das Gift lähmte bereits seinen Körper. Elf Schlangen flochten ihre Leiber um ihn, elf Giftmäuler aufgerissen, elf Paar spitze Zähne bissen noch einmal zu, und die Kobra sank zusammen. Jemand hämmerte auf ihn ein, und er fuhr hoch.
Das Hämmern stellte sich als dezentes Klopfen von Giacomo heraus, der bereits alles für die Morgentoilette vorbereitet hatte. Giacomo war auf dem Schiff nicht untätig gewesen, er hatte sich im Hafen von Boston mit den wichtigsten Journalen eingedeckt und zumindest sechs Fräcke nach der neuesten Mode umgearbeitet. Das stellte sich jetzt als Glückstreffer heraus, da für Neuanschaffungen die Zeit fehlte. Der Pariser Schneider musste warten, ohnehin war eingetreten, was sie beide vorhergesehen hatten: In der Mode gaben jetzt die Engländer den Ton an.
Giacomo knotete della Mottas Halsbinde zu einer Schleife, half ihm in den Frack und strich den Stoff über den Schultern glatt. Ging noch einmal um ihn herum und begutachtete ihn von allen Seiten, bevor er ihm den Spiegel vorhielt.
»Diese kurzen Westen sind für Eure Statur gemacht«, nickte er fachmännisch. »Aber Ihr hättet gestern den Vicomte d’Ambours mit seinem dicken Wanst darin sehen sollen!«
»Wer ist der Vicomte d’Ambours?«
»Er war so großzügig, uns seine Kutsche zu überlassen.«
»Freiwillig?«
»Mm.« Giacomo kniff seine Mundwinkel zusammen und wiegte den Kopf. »Wie man es nimmt. War beim Kartenspiel mit zwei anderen Herren nicht sehr glücklich, der Gute.«
»Und setzt seine Kutsche?«
»Gesetzt hat er einen Ring, seine Uhr und etwa fünfhundert Livres. Vor allem die Uhr brachte ihn in die Bredouille, der Gravur nach war sie nämlich ein Geschenk. Ihr kennt mich doch, Herr, ich kann unmöglich zulassen, dass seine Herzensdame von solch einer Dummheit erfährt.«
»Also hast du die Uhr ausgelöst.«
»Und dafür nicht nur den Wagen, sondern auch noch das Gespann bekommen.«
»Alles der Dame zuliebe, hm?« Della Motta klopfte ihm auf die Schulter. »Eine Mietkutsche hätte es nicht getan?«
»Ihr solltet den Wagen sehen, Marchese!«
3
Obwohl der Wagen bemerkenswert gut gefedert war, hüpften die Buchstaben auf den Buchseiten und das Mittagessen in della Mottas Magen. Sie rumpelten durch das nächste Schlagloch. Er legte das Buch neben sich auf die Bank und nahm den Vorhang beiseite. Die Kutsche rüttelte, er schlug mit der Schulter gegen den Fensterrahmen. Alles in allem hatte Giacomo jedoch recht, es war ein vorzüglicher Reisewagen. Wo sie auch hielten, sorgte der seltene Luxus von verglasten Fenstern für Aufsehen, die Sitze waren nicht nur komfortabel, sondern boten vier Leuten bequem Platz, und della Motta liebäugelte schon längst mit dem Gedanken, die Kutsche zu behalten und das Wappen am Verschlag durch sein eigenes übermalen zu lassen. Trotzdem bedauerte er es nicht, als sie nun langsamer fuhren und schließlich ganz hielten.
Die knappen Befehle bei der Einreise in eine Stadt klangen in jeder Sprache gleich. Giacomo führte das Gespräch mit der Wache, aber der Tonfall der Soldaten ließ darauf schließen, dass man ihn selbst behelligen würde. Er lehnte sich bequem in die Ecke seines Wagens, schlug das eine Bein über das andere und war nicht überrascht, als wenig später der Schlag aufgerissen wurde.
»Papiere!«, bellte der Soldat.
Angelegentlich betrachtete della Motta seine Fingernägel und schenkte der Zollwache nicht einmal einen Blick.
»Euren Pass!«
Er vertiefte sich in den Anblick des Saphirs an seinem Finger.
»Ohne Euren Namen lasse ich Euch nicht passieren!«
»Meinen Namen hat mein Diener Ihm zweifelsfrei mitgeteilt. Warum belästigt Er mich?«
Der Wachposten wechselte einen Blick mit seinem Kollegen. »Ich habe Anweisung, jeden persönlich zu kontrollieren. Befehl ist Befehl, Monsieur.«
»Dann führe Er seine Befehle höflich aus, wenn Er eine Antwort will.«
Der Soldat räusperte sich und begann widerwillig von vorne: »Monsieur, bitte um Euren Pass.«
Herablassend hielt della Motta ihm die Papiere entgegen, und der Soldat entfaltete sie umständlich.
»Riccardo Visconti Marchese della Motta. Italiener?«
»Worüber Ihn mein Diener gewiss in Kenntnis gesetzt hat.«
»Republik Venedig. Hm. Was wollt Ihr in Straßburg?«
»Durchreisen.«
»Wohin?«
»Wohin es mir beliebt. Ich wüsste nicht, was das die Behörden einer Stadt angeht, in der ich mich nicht lange aufzuhalten gedenke.«
Der Mann überlegte, ob er auf einer Antwort bestehen sollte, ein finsterer Blick des Marchese hielt ihn davon ab. Dafür beschäftigte den Wachposten nun das Gepäck: »Was führt Ihr mit Euch? Waren zu verzollen?«
»Wirke ich auf Ihn wie ein Krämer?«
»Sieh nach!«, forderte der Soldat seinen Kollegen auf. Schon wollte della Motta aufbrausen, als der Soldat die Hand hob und ihm gedämpft zuraunte: »Verzeiht, Marchese, aber ich muss ihn loswerden und Euch alleine sprechen. Vorausgesetzt, Ihr seid wirklich der, für den Ihr Euch ausgebt.«
Della Motta schnaubte ungeduldig. »Er hat meinen Pass, was will Er denn noch?«
»Zeigt mir Euren linken Unterarm!«
»Jetzt geht Er zu weit.«
»Ich muss sichergehen. Ich habe Instruktionen.«
»Seine Instruktionen interessieren mich nicht. Wenn Er mir etwas zu sagen hat, sage Er es jetzt, denn wenn Er in dieser Form weitermacht, kann er sich in spätestens einer Stunde beim Stadtkommandanten verantworten.«
»Die Schlangen haben eine Nachricht für Euch. Aber ich darf sie nur dem echten Marchese della Motta geben.«
»Ich kenne keine Schlangen, Er strapaziert meine Geduld.«
Der Soldat war sichtlich verwirrt, er sah sich schon auf seiner Nachricht sitzen bleiben. Della Motta hingegen fühlte keine Veranlassung, ihn aus der Zwickmühle zu befreien, und streckte fordernd die Hand aus. »Meinen Pass!«
»Und die Nachricht?«
»Hebe Er sie für den echten Marchese auf«, gab er sarkastisch zurück. »Und jetzt gebe Er den Weg frei oder hole seinen Vorgesetzten.« Er wunderte sich nicht, dass der Soldat sich für die erste Alternative entschied.
Sie fuhren die Ill entlang, und rechter Hand ragte eine imposante Barockfassade auf. Das musste das Palais Rohan sein, der Sitz des Fürstbischofs. Die Annehmlichkeiten eines Hofes waren zwar verlockend, nicht zuletzt dank sauberer Betten, aber das Palais hatte auch Nachteile. Vor allem den, sich nicht oder zumindest nur mit einigem Aufwand uneingeschränkt bewegen zu können. Es war della Motta noch nie schwergefallen, an Höfen gastfreundliche Aufnahme zu finden, doch im Gegenzug wurde von ihm erwartet, dass er sich in das Hofleben einfügte, die Gesellschaft mit seinem Esprit unterhielt und sich an Diners und Spielen, an mehr oder weniger geistvollen Gesprächen und dilettantischen Kunstdarbietungen erfreute. Genau das, was er im Moment nicht brauchen konnte. Er musste auf jeden Fall Herr seiner Zeit bleiben.
Hätte er einen längeren Aufenthalt geplant, hätte er Giacomo auf die Suche nach einem Privathaus geschickt und sich wenn schon nicht mit Luxus, dann doch zumindest mit der Behaglichkeit eines gehobenen Bürgerhaushaltes umgeben. Aber wie die Dinge lagen, musste er bald wieder aus der Stadt verschwinden, und so stieg er einmal mehr in einem Gasthof ab. Der Lage und seinem Preis nach war es das beste Haus am Platz, und er machte sich Hoffnungen auf ein Bett, das er nicht mit Wanzen und Flöhen teilen musste.
»Nicht auspacken.«
Giacomo klappte den Deckel des Koffers wieder zu.
»Vergiss nicht, offiziell sind wir auf der Durchreise.«
»Schon klar.«
»Und abgesehen davon musst du imstande sein, mitsamt dem Gepäck in einer halben Stunde zu verschwinden.«
»Verstanden. Und was habt Ihr nun vor?«
»Ich sehe mir das Münster an.«
Skeptisch legte Giacomo seinen Kopf schief. »Werden sich Juden im Münster tummeln?«
»Hast du einen anderen Vorschlag, warum ich mich in dieser Stadt aufhalte?«
»Aha«, zwinkerte Giacomo. »Wieder an Kunstschätzen interessiert.« Er öffnete einen anderen Koffer.
»Habe ich dir nicht gesagt, dass du nicht auspacken sollst?«
»Nur einen Frack. Und das hier.« Giacomo hielt ein Etui mit Nähzeug hoch. »Welchen wollt Ihr zuerst?«
»Den perlgrauen. Oder nein, den nachtblauen.«
»Mal sehen. Wenn es viele Kunstwerke sind, schaffe ich vielleicht beide.«
»Wollen wir hoffen, dass die Zeit nur für einen Frack reicht. Mir ist bei der ganzen Sache nicht wohl.«
Giacomo hatte sich bereits einen Stuhl ans Fenster gerückt und begonnen, die Borte herunterzutrennen. Jetzt sah er hoch und runzelte Augenbrauen und Stirn.
»Alle Welt scheint auf einmal zu wissen, wo ich bin«, erklärte della Motta. »Der Soldat am Stadttor hatte eine Nachricht für mich.«
»Und?« Giacomo schob den Stoff auf seinem Schoß ein Stück weiter. In Boston hatte della Motta keine Gelegenheit gehabt, die Kleidungsstücke abzunutzen, und wenn Giacomo mit den Umarbeitungen fertig war, würde er wie immer à la mode auftreten. Selbst ohne Pariser oder Londoner Schneider.
»Denke nach, Giacomo! Woher sollte der Posten wissen, dass ich komme? Und woher sollte man hier wissen, dass ich zu den Schlangen gehöre?«
»Na das ist doch nicht so schwer. Marconi hat schon einen Brief herausgeschmuggelt, warum nicht auch einen zweiten? Sie helfen Euch bei seiner Befreiung.«
»Irrtum, Giacomo! Marconi weiß nicht, dass ich komme. Niemand weiß es. Wenn die Schlangen hier mit Hilfe rechnen, dann ganz bestimmt nicht mit meiner.«
Giacomo legte die Schere zur Seite. »Und warum sollten Sie Euch dann Nachrichten schicken?«
»Der Kerl wollte meinen linken Arm sehen.«
»Ist er wahnsinnig? In aller Öffentlichkeit?«
»Meine Kutsche lässt sich wohl kaum als Öffentlichkeit bezeichnen. Was mich stutzig macht, ist, dass er von dem Zeichen wusste.«
Giacomo linste ihn immer noch begriffsstutzig an.
»Ach komm, es ist wirklich nicht schwer! Jemand muss es ihm gesagt haben. Meine Identität kennen viele in Europa, aber wie viele wissen, dass ich ein Schlangenkrieger bin?«
»Eben. Nur die Schlangen. Also warum seid Ihr dann so aus dem Häuschen?«
Ein Klopfen an der Tür unterbrach sie. »Was?«, blaffte della Motta und riss die Tür auf.
»Äh, ein Brief wurde … für Euch …« Der Knecht, der das Gepäck heraufgeschleppt hatte, knetete einen Umschlag zwischen den Fingern.
»Gebe Er ihn her!« Die Münze, die della Motta dem unfreiwilligen Boten zusteckte, machte seinen barschen Ton nur zur Hälfte wett. »Da hast du es!«, warf er die Tür zu und rannte durchs Zimmer, die Hand mit dem Brief hoch erhoben. »Du kannst dich gleich auf den Marktplatz stellen und lauthals verkünden, dass der Marchese della Motta in der Stadt ist. Die Schlangen werden aus allen Winkeln kriechen, vielleicht bringen sie Marconi ja gleich mit!«
»Was steht drin?« Aus Erfahrung wusste Giacomo, dass die beste Art mit della Mottas Wutanfällen umzugehen darin bestand, sie zu ignorieren, und blieb betont ruhig.
Della Motta drehte den seltsam schweren Umschlag um, auf dem nichts anderes vermerkt war als sein Name. Im Siegelwachs befand sich kein Abdruck, der Absender wollte anonym bleiben. Auch die Schrift sagte ihm nichts, was ihn auch nicht weiter wunderte, aber die Nachricht war von einer geübten Hand abgefasst. Er erbrach das Siegel und etwas Hartes, Handspannenlanges fiel scheppernd zu Boden. Er bückte sich danach und hielt einen Schlüssel in der Hand.
Der Text war französisch, was in dieser Stadt, die ungeachtet der politischen Verhältnisse dennoch dem deutschen Kulturkreis zugerechnet werden konnte, keineswegs selbstverständlich war. Mit bemüht gemäßigter Stimme las er vor:
»Euer Gnaden!
Wir haben Eure Ankunft sehnlichst erwartet, ist es uns doch ohne Eure Hilfe unmöglich, Monsieur Marconi aus der Stadt zu schaffen. Und dass er gerettet werden muss, steht außer Frage!
Die Juden, bei denen wir ihn vermuten, misstrauen der restlichen Bevölkerung und somit auch uns, sich ihnen als Christ zu nähern, ist mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden. Doch die Behörden bereiten schon für die heutige Nacht eine Durchsuchung aller mosaischen Haushalte vor. Ihr dürft keine Zeit verlieren!
Die Stadttore und sämtliche Herbergen werden kontrolliert, auf gewöhnlichem Weg kommt Ihr nicht aus der Stadt. Bringt Monsieur Marconi zu den Gedeckten Brücken, im zweiten Turm befindet sich eine Pforte, die der Schlüssel öffnet. Durch sie gelangt Ihr in einen Geheimgang, der Euch aus der Stadt führt. Folgt ihm bis zu seinem Ende, er mündet in einen kleinen Wald, wo wir Euch zwei Stunden nach Öffnung der Stadttore abholen.
Die Schlange möge Euch beschützen!«
»Gezeichnet?«, wollte Giacomo wissen.
»Von niemandem. Nur das hier.« Della Motta hielt ihm den Brief hin. Am unteren Rand ringelte sich eine Schlange.
»Shalom alechem!«
»Shalom!« Ohne aufzusehen, schrieb Simon Goldblum weiterhin in sein Geschäftsbuch. »Was suchst du?«
»Ich suche nichts, ich bringe etwas.«
Ein blauer Rock und eine blau und sandfarben gestreifte Weste landeten neben dem Geschäftsbuch auf dem Ladentisch. Ausgezeichneter, teurer Stoff, erstklassige Verarbeitung. Kaum getragen.
»Wie viel bekomme ich dafür?«
Simon bewegte anstatt der Augen den ganzen Kopf, und seine Schläfenlocken wackelten, während er den Rock durch die Finger wandern ließ. »Ah, ich weiß nicht recht. Schwer zu verkaufen.« Schön, sehr schön. Und wenn der Mann das Geld dringend brauchte, war ein enormer Abschlag drin. »Dreißig Sous.«
»Willst du mich für dumm verkaufen?«
»Brauchst du Geld oder nicht?«
»Willst du den Rock oder nicht?«
Jetzt sah Simon doch auf. Ei, war das ein vornehmer Herr! Der rosenholzfarbene Rock war mindestens genauso teuer wie der blaue auf dem Ladentisch, die Weste aus schwarzer Seide, die schwarzen Kniehosen aus gutem Tuch. Dazu eine Uhrkette aus purem Silber, ein Spazierstock aus Ebenholz mit einem silbernen Knauf, und die Strümpfe waren auf den Anzug abgestimmt, in denselben Farben wie Rock und Weste. Schnallenlose Schuhe, aber aus hervorragendem Leder.
Äh, Kleidung war das eine, Geld das andere. Und wenn der Mann in Geldschwierigkeiten steckte, war aus ihm noch weit mehr herauszuholen. »Ei, mit Kleidern laufen nicht so gut die Geschäfte. Aber drei Gassen weiter mein Bruder, der gibt Euch Kredit für Eure Uhr. Wenn nicht nur die Kette ist aus Silber.«
Der groß gewachsene Herr verzog die Mundwinkel zu einem seltsamen Lächeln, wandte sich ab und sah sich im Laden um. Schob mit dem Stock ein paar Kleidungsstücke auseinander und strich gelegentlich mit der Hand über einen Ärmel. »Ihr habt recht, ich hätte gleich zum Pfandleiher gehen sollen.« Er sah nicht aus wie ein Jude, aber er sprach ein ausgezeichnetes, sehr gehobenes Hebräisch. Wie der Rabbiner. Simon wurde aus ihm nicht schlau. Für jemanden mit finanziellen Problemen war der Mann zu selbstbewusst. Zu wenig verzweifelt.
»Ihr seid nicht aus Straßburg?«
»Nein, bin ich nicht.«
»Aber Ihr seid Jude?«
»Den Talmud kenne ich so gut wie Ihr.«
»Warum seid Ihr hier? Ihr wollt gar nicht verkaufen Euren Rock. Oder verpfänden Eure Uhr.«
»Eigentlich wollte ich zur Synagoge.«
»Mit Kleidern unterm Arm?«
»Vielleicht wollte ich sie dem Rabbiner für Bedürftige seiner Gemeinde geben.« Wieder dieses eigenartige, sehr feine Lächeln.
»Hier gibt es keine Synagoge. Und der Rabbiner wohnt nicht in Straßburg.«
Jetzt wirkte der elegante Herr überrascht. »Eine große Stadt ohne jüdische Gemeinde?«
»Ihr seid wirklich nicht von hier. Wir dürfen arbeiten in der Stadt, aber nicht wohnen in ihr.«
»Hm.« Die tiefblauen Augen des Fremden blickten auf einmal sehr nachdenklich, Simons Feststellung hatte ihn aus dem Konzept gebracht.
Simon sah unverblümt zurück, die Augen faszinierten ihn. Sehr dunkel, blau mit silbrigen Sprengseln darin, die wie das Feuer von Edelsteinen blitzten. Vielleicht waren es diese Augen, die ihn geschwätzig machten. »Um zehn Ihr werdet eine Glocke vom Münster hören. Da wir müssen Straßburg verlassen. Bis auf Cerf Berr und seine Familie.«
»Cerf Berr?«
»Der Armeelieferant. Mich wundert, dass Ihr nicht habt gehört von ihm.«
»Der darf hier bleiben?«
»Er, seine Familie, seine Dienstboten. Hat sich herausgeschunden die Erlaubnis vom König. Ei, hat auch genug getan für den König! Durchgefüttert die ganze Armee im Elsass während des Siebenjährigen Krieges!«
»Der Glückspilz.«
»Hat aber nicht vergessen Seinesgleichen! Vor vierzehn Jahren jeder Jude musste noch zahlen Leibzoll. Bis Cerf Berr wieder belagerte die Minister.«
»Wo finde ich diesen Cerf Berr?«
»Bei Altkleiderhändlern und Pfandleihern nicht. – Levy? Levy!«, rief Simon seinen Gehilfen. Der picklige Bursche schlurfte aus dem Nebenraum herbei. »Ei, Levy, bleibst im Geschäft. Muss ich gehen mit diesem Herrn hier. – Herr …«
»Mandelbaum.«
»Schön, sehr schön. Könnt Ihr natürlich auch allein gehen zu Cerf Berr, wird aber dauern, bis er Euch empfängt.«
»Und Ihr könnt die Wartezeit beschleunigen?«
»Gegen ein kleines … Honorar?«
»Und wenn ich hier die Kleider für den Rabbiner vergesse?«
»Äh, äh«, Simon Goldblum hob die Hände bis zu den Schultern, legte die Stirn in Falten und machte eine abwägende Geste.
»In der Rocktasche könnte auch ein Louisdor sein.«
»Oder zwei?«
»Oder zwei.«
»Oder zwei«, schlug Simon mit der flachen Hand auf den Ladentisch. »Keine Zeit zu verlieren, Herr Mandelbaum!«
Mandelbaum zog seine Börse und steckte demonstrativ zwei Goldmünzen in die Rocktasche, während Simon ihm mit übertriebener Geste die Tür öffnete.
Durch die Straßen gingen sie wortlos, erst als er mit ausgestrecktem Arm auf Cerf Berrs imposantes Haus wies, brach Mandelbaum das Schweigen: »Die gute Verbindung eines Armeeproviantiers und …«
»… eines Altkleiderhändlers?«
»Wie kommt sie?«
»Ei, ich nicht frage nach Eurem Geheimnis, Ihr nicht nach meinem.«
Mandelbaum zuckte mit den Achseln, aber seine Edelsteinaugen versuchten trotzdem, hinter Simons Fassade zu blicken. Sollten aber nichts finden.
Wenig später befand sich Goldblum im Empfangszimmer von Cerf Berr, und nach einem kurzen Gespräch winkten sie auch Mandelbaum herein, der gelangweilt im Vorraum auf und ab ging. Goldblum kam sich mit einem Mal sehr schäbig vor in seinem Kaftan und mit seiner Kippa. Cerf Berr war genauso vornehm gekleidet wie Mandelbaum, nur dass er eine weiße Perücke trug, während Mandelbaums Haar schwarz glänzte. Ei, Haare! Cerf Berr konnte Mandelbaums Vater sein! Auch an Leibesfülle war er Mandelbaum überlegen. Gute Geschäfte, gutes Essen.
»Shalom, Monsieur Mandelbaum!« Cerf Berr wies auf ein Sofa.
»Shalom!« Mandelbaum kam der Aufforderung nach, legte Hut und Spazierstock neben sich, schlug das rechte Bein über das linke und ließ die Hände entspannt im Schoß liegen.
»Goldblum hat mir Euren Vornamen verschwiegen.«
»Noah.«
»Noah Mandelbaum, ein jüdischer Name. Ihr seht nicht aus wie ein Jude.«
»Ihr auch nicht und Ihr sprecht französisch mit mir. Macht Euch das zum Franzosen?«
»Kommt Ihr zu mir als Sohn desselben Volkes oder als Geschäftsmann?«
»Ich bin kein Geschäftsmann.«
»Ich würde Euch ja zum Essen einladen, Monsieur Mandelbaum, aber ich speise nur mit anderen Juden. Mein Glaube und meine Tradition erfordern das.«
Simon riss die Augen auf, aber er hielt lieber den Mund.
»Ihr habt Goldblum mit Eurem Hebräisch schwer beeindruckt«, fuhr Cerf Berr fort. »Wo habt Ihr es gelernt?«
»In Bologna.«
»Auf der Universität, nehme ich an. Theologie?«
»Erst Jura, dann Philosophie.«
»Und Euer richtiger Name?«
»Für Monsieur Goldblum bliebe ich lieber Noah Mandelbaum.«
»Monsieur Goldblum muss ohnehin wieder zurück in sein Geschäft.«
Simon stand sofort auf, seine Ohren glühten. Er stammelte einen Gruß, stolperte eilig zur Tür und machte, dass er davonkam. Mandelbaum war nicht Mandelbaum? Und kein Jude? Warum war er dann nicht direkt zu Cerf Berr gegangen? Nicht Simons Problem. Ein teurer Rock und zwei Louisdor. Guter Profit.
Einladend hielt Cerf Berr eine Karaffe hoch.
»Bitte.«
»Warum habt Ihr Euch an Goldblum gewandt?« Cerf Berr ließ den Wein in ein geschliffenes Glas gluckern und streckte es Mandelbaum entgegen.
»Irgendwo musste ich anfangen. Von Euch hatte ich keine Ahnung, und die Zeit läuft mir davon.«
»Geschäfte unter Zeitdruck machen ist nie gut.«
»Ich sagte Euch bereits, dass ich kein Kaufmann bin.«
»Ja, das sagtet Ihr. Ihr seid kein Kaufmann und Ihr seid kein Jude und offenbar auch kein Regierungsvertreter. Ihr wolltet mir übrigens Euren richtigen Namen sagen.«
»Wollte ich das?« Mandelbaum ließ den Wein im Glas kreisen, aber Cerf Berr wartete. »Marchese della Motta.«
»Marquis, aha.« Der Jude zeigte sich wenig beeindruckt. »Und warum Jura?«
»Die Entscheidung meines Vaters.«
»Und die Philosophie Eure?«
»Die Rechte mögen nützlich sein für Karrieren bei Hofe, die Philosophie beschäftigt den Geist.«
»Wärt Ihr mein Sohn, hätte ich Euch auch Jura studieren lassen.«
Della Motta nahm einen Schluck vom Wein und ließ die Bemerkung im Raum stehen.
»Kennt Ihr wirklich den Talmud?«
»Goldblum war offenbar nicht nur von meinem Hebräisch überzeugt«, spöttelte er. »Ja, ich kenne ihn.«
»Das tun nicht viele Christen.«
»Ich bin nicht wie viele Christen.«
»Christen bedienen sich unser, aber sie stehen nie auf unserer Seite«, wandte Cerf Berr ein.
»Ich kümmere mich weder um die Seite der Juden noch um die der Christen.«
»Auf welcher steht Ihr dann?«, blieb der Jude auf der Hut. »Jeder Mann muss eine Seite haben.«
»Auf meiner eigenen.«
»Ihr wollt keine Geschäfte mit mir machen, Ihr tretet nicht für die Sache meines Volkes ein, Ihr seid offenkundig auch kein Bittsteller und auch kein Repräsentant des Staates. Warum sollte ich also dieses Gespräch fortsetzen?«
»Zu Eurer eigenen Sicherheit.«
»Droht Ihr mir?«
Drohen? Nein. Della Motta sah Cerf Berr ernst an. »Heute Nacht wollen die Behörden die Häuser aller Juden durchsuchen.«
»Warum?«
»Ich wusste nicht, dass nur wenige Juden in der Stadt leben«, überging er die Frage. »Umso schneller werden sie auch Euch behelligen.«
»Ich fragte warum?« Cerf Berr fixierte ihn mit stechendem Blick.
»Weil sie einen Mann suchen, der sich bei Juden versteckt.« Della Motta hatte keine Mühe, den Blick zu halten.
»Von einem solchen Mann wüsste ich.«
»Das denke ich auch.« Er sah Cerf Berr direkt in die Augen.
»Und darum kann ich Euch versichern, dass Ihr Euch irrt. Sie mögen ruhig kommen, sie werden niemanden finden.«
»Man findet Flüchtlinge nicht dadurch, dass man in Schränke sieht oder Dielenbretter anhebt. Man schüchtert die Bewohner ein, die ihnen Unterschlupf gewähren.«
Cerf Berrs linker Augenwinkel zuckte.
»Man verprügelt die Männer und bedroht vor ihren Augen die Frauen.«
Kaum merklich schluckte Cerf Berr.
»Wollt Ihr das wirklich riskieren?«
»Ihr wisst sehr gut über diese Methoden Bescheid.«
»Das heißt nicht, dass ich sie billige. Oder gar anwende.«
»Warum versucht Ihr dann, mir Angst zu machen?«
»Weil einer von Euch früher oder später reden wird. Vielleicht sogar Ihr selbst, wenn die Schergen Eure Frau oder Eure Töchter in die Mangel nehmen. Weil ich verstehen würde, wenn Eure Familie Euch näher steht als Giovanni Marconi.«
Die Augen des Juden zogen sich eine Spur zu schnell zusammen.
»Natürlich könnt Ihr nicht zugeben, dass er bei Euch ist, dennoch bin ich überzeugt davon. Seht!« Er zog Marconis Brief aus dem Rock. »›Ich halte mich bei den Juden Straßburgs versteckt.‹ Ich hielt das für eine sehr ungenaue Beschreibung, allgemein genug, die Häscher aufzuhalten, aber leider auch zu allgemein, um die Retter herbeizuholen. Bis ich durch Goldblum erfuhr, dass nur Eure Familie in der Stadt wohnt.«
»Keiner meiner Verwandten versteckt einen Marconi«, beharrte Cerf Berr. »Und ich auch nicht.«
»In einer Stunde wird es dunkel, und dann herrscht höchste Gefahr. Für Euch, für Eure Familie und für Marconi. Wir haben keine Zeit für Spiele!«
»Es tut mir leid, aber hier seid Ihr falsch.« Der Jude erhob sich.
Unter anderen Umständen hätte seine Standhaftigkeit della Motta beeindruckt, jetzt war er nahe daran, ihn dafür zu erwürgen. »Lasst mich einen letzten Vorschlag machen«, zwang er sich zur Ruhe. »Ich schreibe einen Brief, vor Euren Augen. Und vor Euren Augen versehe ich ihn mit meinem Siegel. Ihr verlasst mit diesem Brief den Raum und denkt nach. Wenn Marconi nicht hier ist, kommt Ihr zurück und verbrennt den Brief in meiner Gegenwart. Ist er doch da, soll er selbst entscheiden, ob er mir vertrauen will.«
Der Jude legte die Finger dachförmig aneinander, klopfte mit den Zeigefingern gegeneinander und starrte ins Leere. »Na schön«, gab er sich einen Ruck. »Verfasst diesen Brief. Ich lasse Schreibzeug bringen.«
Della Motta warf die Botschaft für Marconi aufs Papier: ›Wie gelange ich zu Euch? Ich bin hier, um Euch herauszuholen, aber Eure Beschützer halten Ihr Versprechen zu gut.‹
Cerf Berr zog ihm die Nachricht unter der Feder weg und überflog die Zeilen, aber er konnte trotz della Mottas eleganter Schrift kein Wort entziffern. »Was für eine Sprache ist das?«, gab er das Schreiben zurück.
»Eine sehr alte.«
»Und das Siegel?«
Della Motta fächelte mit dem Blatt, damit die Tinte trocknete, und holte das Siegel aus der Rocktasche. Er faltete das Schreiben, ließ Wachs darauf tropfen und presste die vierfach gewundene Schlange in die rote Masse.
Cerf Berr verschwand mit dem Brief, und della Motta blieb allein im Zimmer zurück. Ruhelos schritt er auf und ab, die Uhr auf dem Wandtisch tickte überlaut, und der Minutenzeiger rückte zum nächsten Strich vor. Es begann bereits zu dämmern, auf den Treppen waren Schritte zu hören, Dielen knarrten, und er fuhr er herum, aber niemand betrat das Zimmer. Er sog die Luft tief ein und fixierte wieder die Uhr. Am liebsten packte er diesen verfluchten Zeiger und hielte ihn an, weitere zehn Minuten sinnlos vergeudet!
Seit er die Botschaft der Schlangen erhalten hatte, hatte er die Dinge nicht mehr im Griff. Keine Zeit für Tarnung, und wenn Cerf Berr nicht bald redete, dann war auch der geheime Fluchtweg der Schlangen wertlos.
»Marchese?«
Er wirbelte herum, Cerf Berr schloss sorgfältig die Tür hinter sich.
»Euer Brief.« Der Jude hielt ihm den gefalteten Zettel hin. Atemlos drehte della Motta ihn um, das Siegel war erbrochen und mit seiner engen, altmodischen Schrift hatte Marconi eine andere Botschaft auf die Rückseite gekritzelt. In derselben alten Sprache, in die nur die höchsten Grade des Ordens eingeweiht waren: ›Wenn Ihr wirklich das seid, als was Ihr Euch ausgebt, wisst Ihr, was Ihr zu tun habt. Cerf Berr wird nicht reden.‹
4
Einem Nichteingeweihten gegenüber! Hättet Ihr das auch von Chrétien verlangt? Er hatte gute Lust, diesen Wahnsinnigen seinem Schicksal zu überlassen.
»Hört mir genau zu!«, bohrte er stattdessen seinen Blick in den von Cerf Berr. »Ich werde Euch jetzt etwas zeigen, das nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen, und Ihr müsst es sofort wieder vergessen.« Bevor er es sich noch anders überlegte, wartete er Cerf Berrs Reaktion gar nicht erst ab, sondern zog den Rock aus und legte ihn über die Sessellehne. »Seht, aber stellt keine Fragen!«
Er krempelte den linken Hemdsärmel hoch, und Cerf Berr tat, als sei das schlanke Messer in der Scheide ein alltäglicher Anblick. Er hatte ja auch keine Ahnung, wie viel Blut durch diese Klinge bereits geflossen war, und es war ohnehin nicht das, was er sehen sollte. Della Motta drehte die Handfläche nach oben und hielt dem Juden die Innenseite seines Unterarms unter die Augen. Vor fünfzehn Jahren war die Brandwunde dunkelrot und lange Zeit äußerst schmerzhaft gewesen, jetzt hatten sich die wulstigen Erhebungen aufgehellt und die Farbe seiner unversehrten Haut angenommen. Er spürte sie nur mehr, wenn er mit dem Finger darüberstrich. Die vierfach gewundene Schlange zeichnete ihn für sein ganzes Leben, das Maul aufgerissen, die Giftzähne zum Biss bereit.
»Und jetzt bringt mich zu Marconi!«
Fast hätte er Cerf Berr bei den Schultern gepackt und geschoben, so bedächtig schien ihm der Jude auszuschreiten. Es ging eine Treppe hinauf und eine weitere Stiege führte zur Mansarde, die sich in zwei Gänge verzweigte. Der hintere Teil war offenbar für die Dienstboten bestimmt, der vordere, zur Straße hin gelegene, teilte sich in mehrere Gästezimmer, von denen sie das letzte ansteuerten.
»Der hinterste Winkel im Haus?« Della Motta verdrehte die Augen. »An die Notwendigkeit einer Flucht dachtet Ihr wohl nie. Wer außer Euch weiß noch, dass Marconi hier ist?«
»Eine Magd, die ihm das Essen bringt und sein Zimmer richtet.«
»Ist sie verschwiegen?«
»Ich hoffe doch.«
»Bis jetzt scheint sie es gewesen zu sein. Betet, dass es so bleibt, wenn Ihr nicht am Galgen landen wollt. Diese Tür?«
»Lasst mich erst das Zeichen geben.«
Er trat zurück und wartete, bis Cerf Berr erst dreimal kurz klopfte, dann eine Pause machte und viermal mit etwas längeren Abständen sein primitives Zeichen vervollständigte. »Seid Ihr das, Cerf Berr?«, tönte Marconis Zeremonienstimme von innen.
»Ja.«
Ein Schlüssel wurde umgedreht und ein Riegel zurückgeschoben.
So wenig war nötig, um in das Zimmer zu gelangen? Hätte della Motta einen Beweis gebraucht, dass Marconi kein Schlangenkrieger war, hier hätte er ihn bekommen. »Dankt Eurem Gott, dass ich vor den Soldaten hier bin«, zischte er zu Cerf Berr und zog ihn ins Zimmer, bevor Marconi einen Fuß über die Schwelle setzen konnte. »Eure Vorsichtsmaßnahmen sind zum Haareraufen!« Mit langen Schritten war er sofort an einem der zwei Fenster.
»Della Motta«, deklamierte Marconi hinter ihm. »Ihr seid der Letzte, mit dem ich gerechnet hätte!«
Della Motta drehte sich nicht nach ihm um, sondern inspizierte das Dach. Steil abfallend, weit unten die Straße. Eine Tür führte in einen weiteren Raum. »Was ist dort?« Er riss sie auf und sah in einen kleinen Schlafraum, ebenso komfortabel eingerichtet wie das vordere Zimmer, aber die Details interessierten ihn nicht. Nur das Fenster, das auf derselben Seite lag, auch hier war das Dach steil. Er warf einen kurzen Blick zum gegenüberliegenden Haus: Viel zu weit für einen Sprung, sogar für ihn, geschweige denn für einen Mann um die sechzig.
»Cerf Berr, ruft die Magd! Das Zimmer muss vollkommen unbewohnt aussehen!«
»Aber …«
»Tut, was ich Euch sage! Ich bringe Signor Marconi hier fort, aber wenn man eine Spur von ihm bei Euch entdeckt, helfen Euch nicht einmal Eure Beziehungen zum König.«
Marconi nickte Cerf Berr würdevoll zu, und der betätigte einen Klingelzug. Fassungslos schüttelte della Motta den Kopf. »Ich nehme an, Euer gesamtes Personal kann die Glocke sehen, also erzählt mir nicht, dass nur eine einzige Magd Bescheid wusste. Helft mir!« Er zerrte das Leintuch von der Matratze und öffnete den Schrank. Der enthielt nur wenig: ein Paar Schuhe, einen Hut, drei Hemden, ein Paar Kniehosen und einen Rock. »In welchen Schuhen könnt Ihr besser laufen, Signor Marconi?«
Marconi deutete auf die, die er anhatte, und della Motta warf das andere Paar aufs Leintuch, die Kleidungsstücke hinterher. In einer einzigen Bewegung wischte er die Toilettegegenstände vom Waschtisch ebenfalls auf das Laken. »Perücke und Hut!« Er warf Marconi die Perücke zu, die der hastig über sein kurzes Haar stülpte. »Seht zu, dass sie ordentlich sitzt, so viel Zeit haben wir. Auf der Straße müsst Ihr aussehen wie ein normaler Bürger. Persönliche Sachen?«
»Keine.« Marconi rückte die Perücke gerade.
»Nichts, das auf die Schlangen hinweist?«
»Nein.«
»Was ist mit dem Buch hier?«
»Das gehört Cerf Berr.«
»Es muss verschwinden, der Raum muss leer sein.« Er knallte es Cerf Berr vor die Brust. In dem Moment klopfte jemand an die Tür. Della Motta scheuchte Marconi zurück ins Schlafzimmer und gab Cerf Berr einen Wink. »Nur Hebräisch!«, raunte er.
»Wer da?«
»Mirjam.«
»Die Magd?«, flüsterte della Motta, und Cerf Berr nickte. Della Motta schob den Riegel zurück und sperrte das Schloss auf, blieb aber neben der Tür stehen, sodass er den Hereinkommenden sofort hätte packen können. Unnötig, denn zum Glück war es wirklich nur die Dienstbotin. Cerf Berr erteilte ihr die nötigen Anweisungen, und wenig später kam sie wieder mit frischer Bettwäsche, Staubtuch und Besen. Auch beim zweiten Mal ließ della Motta sie nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen ins Zimmer.
Er hob die Matratzen, zog jede Schublade einzeln auf, überprüfte jedes Brett im Schrank, sah hinter die Bilder und unter den Teppich. Kurz, er benahm sich, wie jeder Scherge es getan hätte, der das Zimmer nach Marconis Spuren durchsuchte. Erst als er sich überzeugt hatte, dass wirklich nichts mehr hier war, knotete er das Leintuch zu einem Bündel zusammen. »Und jetzt weg hier!«
Unten hämmerte jemand an die Haustür.
»Sie sind da!« Mit ausgestreckter Hand stoppte er Marconi. »Nach unten können wir nicht.« Er eilte zurück ins Zimmer und ans Fenster. Unten wimmelte es von Soldaten, eine halbe Kompanie musste da unterwegs sein. Wieder zurück in den Gang. »Wie sieht es auf der anderen Seite mit Fenstern aus?«
»Genauso wie hier, im Dach.« Cerf Berr war kreidebleich, und seine Stimme kratzte.
»Und darunter? Eine Straße?«
»Seht selbst!«
Hier bot sich eine ähnlich verzwickte Lage wie auf der Straßenseite, das Dach war ebenfalls steil, doch links zog sich ein weiteres Gebäude im rechten Winkel zum Haus hin.
»Hintertreppen?«
»Das ist kein Palast.«
»Also bleibt uns nichts anderes übrig.« Er sah Cerf Berr für einen kurzen Moment in die Augen. »Wir werden Euch nicht vergessen, was Ihr für Signor Marconi getan habt! Die Soldaten werden Euer Haus von unterst zu oberst drehen, hindert sie nicht daran. Zeigt ihnen auch das Zimmer, Ihr habt nichts zu verbergen. Ihr habt nie von Signor Marconi gehört, und er war nie hier.« Ein kurzer Druck an Cerf Berrs Oberarm, dann öffnete er das Fenster, schob das Bündel hinaus und schwang sich über das Sims. Er brauchte nur kurz, bis er sicheren Halt hatte. »Jetzt Ihr, Signor Marconi!«
In Marconis Augen stand die blanke Panik. Aber drinnen brüllten bereits die Soldaten, Frauen kreischten, Männer in Stiefeln trampelten, und Dienstboten rannten aufgescheucht herum, das machte sogar einen Hasenfuß zum Helden. »Oh Gott!« Er klammerte sich an den Fensterrahmen.
Oh Gott? So schnell fiel man in alte Muster zurück. In der Linken hatte della Motta Bündel und Stock, den rechten Arm legte er um Marconi und hielt ihn zwischen seinem eigenen Körper und dem Dach. Marconi war viel zu sehr mit seiner Angst vor der Höhe beschäftigt, als dass er sich Gedanken über die körperliche Nähe hätte machen können.
»Seht nicht hinunter, immer nur aufs Dach. Wir müssen nur bis zum nächsten Fenster.« Und dann zum nächsten und zum nächsten, bis sie das niedrigere Gebäude erreichten, aber Marconi brauchte kleine Ziele. »Greift immer genau da hin, wo vorhin meine Hand war, die Füße setzt da hin, wo Ihr meine spürt.« Ganz so leicht ging es auch wieder nicht, denn Marconi war einen Kopf kleiner als er. »Die Schindel unterhalb meiner Hände«, korrigierte della Motta sich und war bereit, Marconi sofort am Kragen zu packen, falls er abrutschte. Der Angstschweiß des Weisen biss ihm in der Nase.
Es ging viel zu langsam, die Kletterei im Schneckentempo zehrte an den Kräften. Er erwog schon, das Bündel einfach fallen zu lassen, aber dann wäre es in Cerf Berrs Garten gelandet und hätte den Juden doch noch verraten. Marconi keuchte, und er ließ ihn kurz ausruhen. Drei Fenster hatten sie bereits geschafft und sie hielten über dem Anbau. Er wusste natürlich, dass er mit Schneckentempo maßlos übertrieb, genau genommen waren sie sogar sehr flott unterwegs, für einen alten Mann, der seine Tage nicht mit körperlicher Ertüchtigung zubrachte.
»Und jetzt hinunter auf das andere Dach. Könnt Ihr springen?«
Nein, konnte er nicht. Marconi krallte sich so fest am Dach an, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Einer der beiden anderen Weisen wäre della Motta lieber gewesen, einer der ehemaligen Schlangenkrieger, und es war ihm gleichgültig, ob Marconi seine Ungeduld spürte.
Der Anbau befand sich nicht ganz zwei Mannslängen unter ihnen, selbst wenn sie von hier abstürzten, musste nichts Ernsthaftes passieren. Das Dach war zwar schräg, aber keineswegs so steil wie das, auf dem sie gerade geklettert waren.
»Was tut Ihr da?!«, kreischte Marconi.
»Ich verringere die Distanz für Euch.« Er hatte sein rechtes Bein nach oben geschwungen, hakte den Rist um die Kante eines Rauchfangs und suchte etwas tiefer Halt für seinen linken Fuß, mit der rechten Hand hielt er sich an einer Schindel fest. Wie eine Spinne lag er auf dem Dach, kopfüber, und Marconi stand frei, ohne seinen Körper hinter sich. »Umfasst mein linkes Handgelenk, ich lasse Euch ein Stück hinunter.«
»Und wenn Ihr den Halt verliert?!«
»Ich verliere ihn nicht.« Hoffte er zumindest.
Marconi suchte hektisch nach seiner Hand, erhaschte aber nur das Bündel. Ratschend riss es ein, mit einem Aufschrei ließ er es los, erwischte den Stock und wollte den Knauf umklammern.
»Nein! Mein Handgelenk!«
Der scharfe Ton erschreckte Marconi, und um ein Haar wäre er tatsächlich abgestürzt. Blitzschnell streckte ihm della Motta die Hand entgegen, und Marconi krallte sich an seinen Ärmel, als ob der ihn vor allen Mächten der Hölle retten könnte.
»Und jetzt hinunter, nehmt die Füße vom Dach. Signor Marconi, nehmt die Füße fort, Ihr könnt nicht ewig hier bleiben! Nicht hinunter schauen! Seht mir in die Augen!«
Marconi heftete seinen Blick verzweifelt auf sein Gesicht, nahm zögerlich den rechten Fuß von den Schindeln und fischte panisch mit der zweiten Hand nach seinem Arm. Ganz langsam ließ er ihn hinunter, Zoll um Zoll, Handspanne um Handspanne.
»Den Rest müsst Ihr springen, das Dach ist nur eine Beinlänge unter Euch. Lasst Euch fallen.« Nun gut, die Länge seines Beins, nicht des Beins von Marconi, und gemessen von den ausgestreckten Zehenspitzen bis über den Beckenknochen, aber das musste Marconi nicht wissen. Auch so löste er seine Finger nur unendlich langsam von seinem Ärmel.
Marconi krachte auf das untere Dach, ruderte hektisch mit den Armen und tastete fieberhaft nach Halt. Federnd landete della Motta neben ihm und packte ihn am Kragen. Wie ein Häufchen Elend lag Marconi auf dem Dach, und della Motta saß neben ihm mit der Selbstverständlichkeit eines Dachdeckers. Die Schräge war lächerlich, wäre er alleine gewesen, wäre er in Windeseile dahingerannt.
»Steht auf, oder wollt Ihr den Franzosen in die Hände fallen?« Er streckte dem widerstrebenden Marconi die Hand hin und zog ihn hoch. »Wir laufen jetzt wie über einen umgestürzten Baumstamm.« Marconis Finger gruben sich in seine Hand. »Wie über die holprigen Straßen Roms«, suchte er einen Vergleich aus Marconis Erfahrungsschatz. »Seht nur auf mich!«
Marconi blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Er rannte so schnell, dass Marconi ihm gerade noch nachkam und kaum merkte, dass sie schon das dritte Haus überwunden hatten, bis sie nicht mehr weiter konnten. Unter ihnen befand sich eine Kreuzung. Mit Marconi im Schlepptau war Springen und auf der anderen Seite Fliehen undenkbar. »Wir gehen an der Dachrinne auf die Straße hinunter. Ich zuerst.«
Leise landete er auf dem Pflaster und vergewisserte sich, dass die Luft rein war.
»Jetzt Ihr!«
Marconi umschlang mit beiden Armen die Rinne und rutschte an ihr mehr herunter als er kletterte, doch kaum hatte er ebenen Boden unter den Füßen, straffte er den Rücken und hob würdevoll das Kinn. Della Motta unterdrückte ein abfälliges Lächeln. »Und nun normal weiter. Ruhig vor allem, wir sind zwei Bürger auf dem Weg zu einer Gesellschaft. Wir haben keine Ahnung, was bei den Juden los ist, und schon gar nicht, dass man einen hohen Würdenträger der Schlangen sucht.«
Trotz seiner merkbaren Anspannung gelang es Marconi zu schreiten. Er schritt immer, Schreiten lag ihm im Blut. Also schritt della Motta ebenfalls, und als sie an einer eingefriedeten Anlage vorbeikamen, schleuderte er das Bündel über die Mauer.
Sie kamen nur vier Gassen weiter, da stoppte sie ein lautes Krachen. Eine Tür flog aus den Angeln, Menschen schrien, und er wusste sofort, was die Lichtflecke zu bedeuten hatten, die über das Pflaster huschten.
»Wohnt in der Gasse dort rechts auch ein Jude?«
»Ja.«
»Dann weg hier!« Er packte Marconi am Arm und zog ihn mit sich zurück. Mussten sie eben die vorige Kreuzung nehmen und die Stelle in den Seitengassen umgehen.
»Halt! Wer seid Ihr?«
Verdammt! Unbescholtene Bürger liefen vor Soldaten nicht weg, zumal Marconi soeben zur Salzsäule erstarrt war.
Zu zweit kamen die Soldaten auf sie zu. »Was habt Ihr hier zu suchen?«, blaffte der eine und versuchte, im Halbdunkel ihre Gesichter zu erkennen.
»Das wissen wir auch nicht genau«, rätselte della Motta in einem Französisch, das nicht ans Elsässische denken ließ, dem man aber auch nicht die Hofsprache anmerken konnte. »Wir sind auf dem Heimweg von einem Klub, aber die Gassen hier sehen alle gleich aus.«
»Wer seid Ihr?«
»François Turpin, Kaufmann aus Marseille. Und mein Geschäftspartner, Fréderic Labouche.«
»Könnt Ihr Euch ausweisen?«
»Leider nicht.« Della Motta hob bedauernd die Achseln und fuchtelte mit seinem Spazierstock dabei eine ungeschickte Geste in die Luft. »Unsere Papiere liegen im Gasthof.«
»In welchem?«
Den, in dem er abgestiegen war, konnte er unmöglich nennen, ohne Giacomo in Gefahr zu bringen, und einen anderen kannte er nicht. Er warf einen raschen Blick zu Marconi, aber der war entweder nicht geistesgegenwärtig genug, oder er wusste selbst keinen. »Zur Post«, antwortete della Motta aufs Geratewohl, in jeder Stadt gab es einen Gasthof ›Zur Post‹.
In Straßburg offenbar nicht, so höhnisch, wie der Soldat grinste! »Ihr seid verhaftet!«
»Lauft!!!«
Er riss das Messer aus dem Ärmel und schleuderte es dem Soldaten in die Brust, zog die Klinge aus dem Stock und parierte den Säbel des zweiten. Mit einem Fußtritt schickte er den Kerl zu Boden, war schon über ihm.
»Hierher, hier sind …!«
Eine Sekunde zu spät zog er ihm die Klinge über die Kehle.
Mindestens zehn Soldaten stürmten auf sie zu, er wand dem Toten den Säbel aus der Hand, opferte den Hut und las nur die leere Stockhülle auf. »Rennt um Euer Leben!« Stock samt Degen warf er Marconi zu und zerrte sein Messer aus der anderen Leiche. Sie hetzten am Münster vorbei, nach Westen. »Nach rechts!« Er schlingerte um die Ecke, glitt aus, als er umdrehen musste, weil Marconi geradeaus weiterlief. Vor der nächsten Kreuzung holte er ihn ein, und nun packte er ihn am Arm, um ihn in die Seitengasse zu ziehen. Die nächste nahmen sie links, dann wieder geradeaus, schlugen unregelmäßige Haken. Doch die Soldaten waren in der Überzahl und sie waren nicht dumm, ihre Stiefel trampelten durch mehrere Gassen. Er gab auf, sie in die Irre zu führen, rannte nur mehr geradeaus, Marconi keuchte hinter ihm her.
»Wir müssen es zu den Gedeckten Brücken schaffen!«
»Wartet!« Marconi erstickte fast. Er hielt einfach an, stützte die Hände auf die Oberschenkel und ließ den Oberkörper hängen.
»Seid Ihr wahnsinnig? Sie können jeden Moment hier sein!«
»Ich kann nicht mehr!« Marconis Brustkorb hob und senkte sich heftig.
»Ihr müsst!«
»Ich bekomme keine Luft, meine Seite schmerzt!«
»Besser Seitenstechen als ein Strick um den Hals!« Er packte Marconi am Arm und schleifte ihn weiter.
Wasser glitzerte, es stank nach Urin, mit dem die Gerber die Felle behandelten, und nach Fisch.
»Habt ihr es aber eilig, zu mir zu kommen!«
»Lass uns durch!« Della Motta drängte das liederliche Frauenzimmer zur Seite und bahnte sich zwischen ihren Zunftgenossinnen einen Weg. Vorne tauchte endlich die Brücke auf. »Dort!« Der Anblick der Türme beflügelte Marconi, sie rannten am ersten vorbei, hin zum zweiten. Noch im Laufen zog della Motta den Schlüssel aus der Rocktasche und prallte gegen die Tür, Marconi stolperte gegen ihn. Hastig suchte er nach dem Schloss und drehte den Schlüssel um.
Er schloss die Tür von innen.
Im Turm war es stockdunkel und es roch nach altem Gemäuer.
»Was machen wir hier drinnen und wieso habt Ihr einen Schlüssel?«
»Die Schlangen haben ihn mir zugespielt.«
»In Straßburg gibt es keine Schlangen.«
»Dann raus hier, sofort!«
In dem Moment drosch ihm jemand eine Faust unter die Rippen. »Bis auf zwei«, hörte er noch, erkannte die Stimme und zückte den Säbel, aber jetzt blieb ihm die Luft weg. Erst in diesem Moment spürte er den stechenden Schmerz, mit dem sich seine Eingeweide zusammenzogen. Einen zweiten Hieb ersparte der Bastard ihm.
5
»Leone!«, presste della Motta hervor und krümmte sich auf dem Boden.
»Ihr könnt Licht machen, Caporal, nur keine Scheu! Nicht einmal della Motta kann nach einem Leberhaken kämpfen.«
Blendlaternen flammten auf, della Motta sah auf Stiefel. Jemand zog ihm die Hände auf den Rücken und legte ihm Eisen um die Handgelenke.
»Und so etwas wie Ihr ist ein Schlangenkrieger!« Eben hatte Marconi kaum noch atmen können, doch für Beleidigungen hatte er offenbar genug Luft.
»Bis der Orden beschloss, sich meiner zu entledigen«, giftete Leone zurück. »Steh auf, Riccardo!«
Wenn das so leicht wäre. Er rang immer noch nach Atem. Zwei Soldaten packten ihn an den Oberarmen und zerrten ihn hoch, zwei hielten Marconi, dem man ebenfalls die Hände in Eisen gelegt hatte, ein anderer sammelte den Säbel und den Stock mit der darin verborgenen Klinge ein. Im Turm wimmelte es von Uniformierten, doch ihm blieb keine Zeit, sie zu zählen, denn Leone gab das Kommando zum Aufbruch. »Wenn die hohen Herren mir nun folgen wollen!« Mit einer ausladenden Handbewegung forderte er sie auf, ins Freie zu treten.
Draußen warteten die Soldaten, die sie wie Vieh auf den Turm zugetrieben hatten, und nahmen sie in die Mitte. Niemanden kümmerte, ob Marconi Seitenstechen hatte oder dass della Motta vor Schmerzen kaum humpeln konnte. Man schleifte sie durch enge Gassen, sie marschierten darin wie durch Schluchten, die sogar bei Tageslicht beklemmend sein mussten. Bei ihrer rasenden Flucht war ihm die Enge nicht aufgefallen, jetzt wirkten die hohen Häuser mit ihren steilen Giebeln erdrückend, und er kam sich vor wie Theseus im Labyrinth. Er gab sich Mühe, die Qualen zu ignorieren, und konzentrierte sich darauf, die Orientierung zu behalten. Einmal mehr verfluchte er seine mangelnde Ortskenntnis und dass Leone ihn zu dieser überhasteten Aktion gezwungen hatte.
Ihr Marsch endete bei einem schmucklosen Gebäude. Die Soldaten stießen ihn weiter in ein Büro, dessen Einrichtung vorwiegend aus einem imposanten Schreibtisch und bunten Regimentsfahnen bestand. Ein untersetzter Mann mit den Abzeichen eines Capitaine kam hinter dem Schreibtisch hervor und pflanzte sich vor ihnen auf.
»Welcher von beiden ist Monsieur Marconi?«
Leone wies mit einer Kopfbewegung auf den Weisen und setzte sich auf die Tischplatte.
»Wo habt Ihr Euch versteckt, Monsieur?«
»Das werde ich einem französischen Offizier bestimmt nicht verraten.«
»Doch, das werdet Ihr. Unter der Folter gesteht jeder.«
»Die Folter wurde abgeschafft.«
»Offiziell.« Der Capitaine grinste verschlagen, und Marconi wich das Blut aus dem Gesicht. »Und für Hochverräter wie Euch gelten sowieso keine Gesetze.«
»Dann ermordet uns doch gleich hier, ohne Prozess.«
»Und das hier ist der Spion?« Der Capitaine baute sich vor della Motta auf. »Euer Name?«
»Der geht Euch nichts an.«
»Der eine will einen Prozess, der andere keine Formalitäten. Eure Horde ist ein chaotischer Haufen.«
»Wenn Ihr meint.«
Der Capitaine sah della Motta direkt in die Augen. Mit einigem Aufwand, er war einen Kopf kleiner und musste sich dazu auf die Zehen stellen. Offenbar wurde ihm selbst bewusst, dass seine autoritäre Geste eher das Gegenteil bewirkte, er wippte kurz auf den Ballen, drehte sich brüsk weg und marschierte wieder zu Marconi. Dem Weisen fühlte er sich überlegen, der hatte nicht nur dieselbe Größe wie er, sondern auch eine zierliche Statur.
»Wie heißt Euer Spion?«
»Marchese.«
»Das ist kein Name.«
»Wir nennen ihn so. So wie der Verräter dort drüben auch nur Leone heißt.«
Leone verbeugte sich theatralisch, ohne dabei seine Position zu verändern.
»Ein Deckname also?«
»Eher ein Künstlername«, stellte Leone richtig.
»Seid Ihr ein echter Marchese?« Der Capitaine wanderte zu della Motta zurück.
»Wollt Ihr mir den Prozess etwa wegen Hochstapelei machen?«, spottete della Motta und verzog den Mundwinkel zu einem provokanten Lächeln.
»Muss Euch gewaltig ärgern, dass Ihr für einen Bürger hingerichtet werdet«, erwiderte der Capitaine seinen Hohn. »Wieso habt Ihr ihm überhaupt geholfen?«
»Weil es meine Pflicht ist. Ein Wort, das Euch als Offizier eigentlich geläufig sein müsste.«
»Oho, ein Hochverräter mit Ehre, doch wir werden noch sehen. Schafft die beiden in eine Zelle!«
»Ich würde sie vorher nach Waffen filzen.« Leone empfahl es beiläufig, er hatte sich den Brieföffner des Capitaine geschnappt und kratzte damit das Schwarze unter seinen Fingernägeln hervor.
»Los, durchsuchen!«
Ein Soldat beeilte sich, dem Befehl seines Vorgesetzten nachzukommen, und tastete erst Marconi, dann della Motta ab.
»Vergesst nicht, unter seinem linken Ärmel nachzusehen«, riet Leone und musterte della Motta von oben bis unten. Der Soldat zog das Messer aus der Scheide und reichte es dem Capitaine.
»Deine Schuhe, Riccardo!«
Della Motta schlüpfte aus den Schuhen, und der Soldat schüttelte sie vergeblich. Leone winkte ihn damit zu sich und drehte den linken Absatz zur Seite. »Immer noch die alten Verstecke?« Er hielt den Dietrich hoch und legte ihn auf den Schreibtisch.
»Abführen!«, bellte nun der Capitaine, um klarzustellen, wer im Raum das Sagen hatte.
Immerhin erlaubte man della Motta, wieder in seine Schuhe zu steigen, dann wurden sie durch einen finsteren Gang geführt, vorbei an schweren Türen mit einem kleinen vergitterten Fenster darin.
»Da hinein!« Die Soldaten stießen ihn in eine Zelle und Marconi ihm hinterher. Die Tür fiel ins Schloss, ein Riegel wurde vorgeschoben und ein Schlüssel umgedreht.
»Und die Eisen nehmt ihr uns nicht ab?«, brüllte Marconi.
»Offensichtlich nicht.« Della Motta schritt die Wände ab. Sie rochen feucht und strahlten Kälte ab, obwohl draußen Frühling war.
»Und wenn wir unsere Notdurft verrichten müssen?«
»Denkt besser nicht daran, sonst habt Ihr bald nichts anderes mehr im Sinn. Es hätte noch schlimmer kommen können, doch wir sind nicht in einem Kerker und man hat uns nicht getrennt.«
»Ich könnte mir keinen angenehmeren Zellengenossen vorstellen als Euch.«
»Das beruht auf Gegenseitigkeit.« Er hatte hoch oben eine kleine Luke erspäht, durch die das fahle Mondlicht hereinfiel. Doch die Wand war zu glatt zum Klettern, und die Luke war selbst für einen schlanken Mann viel zu eng. Außerdem ging sie gewiss auf den Innenhof und nicht auf die Straße.
»Mich wundert, dass sie Euch geschickt haben.«
»Das haben sie auch nicht. Der Auftrag war für Chrétien bestimmt.«
»Wo ist er?«
»Ich habe keine Ahnung.«
Marconi setzte sich auf den Boden und lehnte den Rücken an die Mauer. »Wie ist Amerika?«
»Grauenhaft.«
»Keine Adelsprivilegien?«
»Der Adel, der dort regiert, heißt Profit. Puritanischer Ehrgeiz, puritanische Raffsucht, puritanische Verklemmtheit und puritanische Verlogenheit. Und kein Funken Kultur.«
»Muss für Euch die Hölle gewesen sein«, stellte Marconi ohne Bedauern fest.
»Wie kam es, dass man Euch entlarvte?«
Marconi schoss einen hasserfüllten Blick auf ihn ab und kniff die Lippen zusammen.
Della Motta zuckte mit den Achseln und setzte sich an die Wand ihm gegenüber. »Woher kennt Ihr Cerf Berr so gut, dass er für Euch sein Leben riskiert?«
»Ihr werdet damit leben müssen, es nicht zu erfahren. Allzu lange dürftet Ihr dieser Qual ohnehin nicht ausgesetzt sein.«
»Gebt Ihr immer so schnell auf?«
»Hat der meisterhafte Marchese denn einen Plan?«
»Immer. Solange ich atme, habe ich einen Plan.« Und zu dem gehörte nicht, sich für einen Weisen hinrichten zu lassen, dem er die Pest an den Hals wünschte.
Sein Instinkt riet ihm, dass es klüger war zu warten. Noch war es zeitig am Abend, die Wachen würden jedoch umso unaufmerksamer werden, je weiter die Zeit voranschritt. Seine Leber tat immer noch weh, und erfahrungsgemäß würde sie das auch morgen noch tun, doch bei allen Nachteilen, die solch ein Treffer mit sich brachte, blieben wenigstens keine Schäden zurück. Bereits jetzt konnte er wieder normal atmen, und in ein paar Stunden wäre es ihm möglich, sich zwar unter Schmerzen, aber doch einigermaßen geschmeidig zu bewegen. Auch Marconi musste ruhen, wenn ihnen später ihre Flucht gelingen sollte, deshalb war es ihm nur recht, dass der Weise nun die Beine zum Schneidersitz kreuzte, die Augen schloss und schwieg. Langsam und tief sog Marconi die Luft durch die Nase und stieß sie durch den Mund wieder aus, sein Brustkorb hob und senkte sich, er atmete tief in den Bauch hinein. Sciarlotte hatte sich auf dieselbe Weise in Trance versetzt, und auch sie hatte in der Meditation ihre Kräfte gesammelt. Etwas, wofür della Motta sich nie die Zeit nahm. Er war Schlangenkrieger, nicht Priester.
Geräuschvoll wurde der Riegel zurückgeschoben, Marconi fuhr aus seiner Versenkung hoch und sah furchtsam zur Tür. Ein Schlüsselbund rasselte, und die Tür wurde geöffnet.
»Ihr! Mitkommen!« Ein Soldat zeigte auf della Motta.
Er stand auf, ohne Marconi einen Blick zuzuwerfen. Vier Soldaten eskortierten ihn ins Büro des Capitaine.
»Hinsetzen!« Die beiden Männer, die ihn an den Armen gepackt hielten, drückten ihn auf den Stuhl nieder, der jetzt in der Mitte des Zimmers stand. Gewiss nicht, damit er es bequemer hatte, sondern weil der Capitaine diesmal nicht zu ihm aufschauen wollte.
Zur Überlegenheitsdemonstration gehörte auch, ihn schmoren zu lassen. Zwei Soldaten postierten sich stocksteif zu beiden Seiten der Tür und starrten die gegenüberliegende Wand mit solch reglosen Mienen an, als wären sie aus Zinn. Er tat ihnen nicht den Gefallen, sich zu ärgern, sondern ließ den Kopf auf die Brust sinken und nutzte die Zeit, um seine Kräfte zu sammeln. Er rechnete nicht damit, dass das Verhör angenehm würde.
»Marchese della Motta!«
Der Capitaine bellte so laut und unvermutet, dass della Motta zusammenzuckte. Im ersten Moment wusste er nicht, wo er war, dann erkannte er Leone, der wieder auf dem Schreibtisch saß, die beiden menschlichen Zinnsoldaten und vor sich den Capitaine. Wie viel Zeit war vergangen?
»Gratuliere.« Er schüttelte den Schlaf von sich ab. »Ihr habt meinen Namen auch ohne meine Hilfe herausbekommen.«
»Ihr gebt also zu, dass Euer Name Riccardo Visconti Marchese della Motta lautet?«
»Wenn es Euch glücklich macht.«
Eine Feder kratzte über Papier, er drehte den Kopf halb nach links und bemerkte einen weiteren Soldaten. Der saß hinter dem Schreibtisch, tauchte eben die Feder ins Tintenfass und sah aufmerksam auf seinen Vorgesetzten, um das Verhör genau zu protokollieren.
»Und dass Ihr ein Spion in den Diensten des Schlangenordens seid?«, forschte der Capitaine weiter.
»Das könnt Ihr nicht beweisen.«
»Wir müssen uns nur Euren linken Unterarm ansehen.«
»Tut Euch keinen Zwang an.«
»Das Brandmal überführt Euch.«
»Ein Brandmal besagt gar nichts. Viele Leute tragen ein Brandmal.« Er schoss einen bezeichnenden Blick auf Leone ab.
»Ihr habt zwei Soldaten Ihrer Majestät getötet.«
»Weil sie mich angegriffen haben.«
»Und seid mit Monsieur Marconi geflohen.«
»Hättet Ihr Euch an meiner Stelle von einer Übermacht niedermetzeln lassen?«
»Ihr hättet Euch der Justiz freiwillig überantworten können.«
»Verzeiht, dass ich einer Staatsmacht nicht vertraue, die unbescholtene Männer willkürlich verhaftet.«
»Ihr wisst genauso gut wie ich, dass Monsieur Marconi nicht unbescholten ist.«
»Nein, das weiß ich nicht.«
Der Capitaine wechselte einen Blick mit Leone, der zuckte die Achseln, was so viel bedeuten mochte wie ›Ich habe es Euch gesagt‹. Della Motta verzog spöttisch den Mundwinkel. »Ich verstehe, Capitaine. Ihr habt Signor Marconi, aber Ihr habt nichts gegen ihn in der Hand.«
Der Capitaine presste die Kiefer aufeinander. »Monsieur Marconi wird unter der Folter gestehen.«
»Darauf würde ich nicht wetten.«
»Doch, das wird er«, mischte sich Leone ein. »Und dabei wird er weit mehr sagen, als die Franzosen wissen wollen.«
Unwillkürlich kniff della Motta den rechten Augenwinkel zusammen.
»Du musst nur einen Weisen opfern, Riccardo, um alle anderen Schlangen zu schützen.«
»Ihr gehört aufs Schafott, Marchese.« Der Capitaine packte della Motta am Kragen und funkelte ihn an. Sein Atem roch nach Zwiebeln. »Aber Monsieur Leone hat uns davon überzeugt, unter gewissen Bedingungen Gnade vor Recht walten zu lassen.«
»Welche Bedingungen?«
»Ihr schneidet Monsieur Marconi die Kehle durch und dafür lassen wir Euch laufen.« Angewidert versetzte ihm der Capitaine einen Stoß und ließ ihn wieder los.
»Für dieses Angebot sollte ich Euch vermutlich dankbar sein.«
»Keine weiteren Verhöre, keine weiteren Fragen.«
»Das ist alles?« Della Motta sah erst zu Leone, dann zum Capitaine hoch. Und dann fing er schallend an zu lachen. Er hörte nicht einmal auf zu lachen, als ihm der Capitaine eine Ohrfeige verpasste, auch nicht nach der zweiten und dritten.
»Nach zwei Tagen ohne Wasser und Brot werdet Ihr anders darüber denken.«
»Ich beneide Euch um Euren Optimismus.«
»Wir lassen Euch gefesselt in der Zelle verrotten.«
»Das wird die Ratten freuen.«
»Wir werden Euch foltern.«
»Nur zu.«
»Monsieur Marconi auch.«
»Schert Euch zum Teufel.«
»Überlegt es Euch.«
»Das brauche ich nicht.«
»Ihr tut das Richtige, Marchese.«
Auf einmal war es totenstill im Raum, nur die Feder kratzte noch, aber der Protokollführer setzte den Punkt. »Ich denke, das reicht«, nickte der Capitaine, und der Soldat packte sein Schreibzeug zusammen. Der Capitaine knallte etwas auf den Schreibtisch, maß della Motta noch einmal von oben herab und marschierte mit den anderen Soldaten aus dem Raum.
Leone blieb sitzen, sah ihnen nach, bis sie die Türe schlossen, und rutschte vom Tisch. »Du hattest immer schon ein Faible für feine Waffen.« Er ergriff das Messer, das der Capitaine so effektvoll auf dem Tisch deponiert hatte, und strich mit dem Finger über die Klinge.
»Ich nehme an, es ist meines.«
»Scharfsinnig wie immer.«
»Und ich habe den Auftrag, Marconi herauszuholen, dir zu verdanken.«
»Er war ideal.«
»Und Chrétien?«
»Treibt in der Seine.«
»Mein Gegner und sein Protegé, wie praktisch.«
»Nicht wahr?« Leone setzte ihm in einer sinnlosen Drohgebärde die Messerspitze an die Kehle. »Alles spricht gegen dich, Riccardo. Dazu das Verhör, bei dem du so wunderbar mitgespielt hast.«
»Wie viel diesmal?«
»Achttausend.«
»Für Marconi hättest du zehn verlangen können. Du lässt nach.«
»Achttausend und die Zusage, dich auf meine Weise zu erledigen.«
»Du hast dabei nur eines vergessen: Du bist der Verräter, nicht ich.«
»Es ist dein Messer.« Leone legte es auf den Schreibtisch zurück und öffnete die Tür.
Als man della Motta zurück in die Zelle brachte, kauerte Marconi auf demselben Fleck wie zuvor und murmelte in einer uralten Sprache. Obwohl er weder auf Latein noch auf Hebräisch deklamierte, hörte es sich an wie ein Psalm. Er sah kurz auf, als della Motta sich an die andere Wand setzte.
»Schließt Euch meinem Gebet an, della Motta!«
»Gebete werden uns kaum retten.«
»Und Euer Plan?«
»Der nimmt sofort Gestalt an, wenn Ihr Euren Befehlston nicht ändert«, zischte della Motta wütend.
»Ihr werdet mit mir beten und mir nachher berichten.«
Ich sollte das Angebot des Franzosen annehmen, dann wird Euch das Kommandieren sehr schnell vergehen.
Marconis Blick war wie Eis, seine wasserblauen Augen fixierten della Motta zwingend und kalt. Die Falten zwischen Marconis Augenbrauen furchten sich tief und zogen sich steil von der Nasenwurzel bis zur Stirn.
Della Motta machte auch seinen Blick hart. »Lasst diese Spiele, Ihr vergesst, dass auch ich in die höchsten Grade eingeweiht bin.«
»Ich verlange von Euch Gehorsam, wie von jeder Schlange.«
»Und ich verweigere ihn, wenn er uns ins Verderben führt.«
»Ich bin Weiser und Priester!«
»Und ich Schlangenkrieger!«
»Ich dulde keine Insubordination! Auch nicht von Euch!«
Della Motta starrte Marconi direkt auf die Nasenwurzel, und der Weise wurde unruhig.
»Die Franzosen haben mir einen Handel angeboten.«
»Den Ihr doch abgelehnt habt?«
»Der Capitaine legt das anders aus.«
»Welchen Handel?«
»Meine Freiheit gegen Euer Leben.«
Marconi atmete geräuschvoll aus und hielt sich krampfhaft aufrecht. »Da musstet Ihr nicht lange überlegen.«
»Nein, das musste ich nicht.«
»Ihr geht über Leichen, um Eure Ziele zu erreichen.«
»Sonst wäre ich keiner der Zwölf.«
»Falsch, della Motta. Ich habe keinen getötet, um so weit zu kommen.«
»Nein«, höhnte della Motta. »Nicht mit eigenen Händen.«
»Wie sollt Ihr es tun?«
»Euch die Kehle durchschneiden.«
»Schnell und schmerzlos. Ich sollte wohl froh sein, denn Ihr versteht wenigstens, zu töten.«
Della Motta warf einen Blick zur Tür und vergewisserte sich, dass das vergitterte Fenster geschlossen war. Trotzdem stand er auf und schritt scheinbar unruhig in der Zelle auf und ab.
»Setzt Euch, Ihr macht mich nervös!«
»Das freut mich. Betet weiter.«
»Marchese!«
»Es ist mein Ernst. Betet weiter, macht Euren Frieden mit der Großen Schlange.« Er presste sein Ohr an die Tür, aber er konnte nicht feststellen, ob draußen jemand stand und lauschte. Als er sich diesmal hinsetzte – wohlweislich im toten Winkel eines etwaigen Beobachters –, zog er die Beine so an, dass er mit den Händen das Knieband seiner Hose erreichen konnte.
»Was tut …«
»Betet, Signor Marconi!«
Mit dem Eisen an den Handgelenken war es nicht einfach, die Knöpfe aufzunesteln. Marconi deklamierte den Hymnus der Großen Schlange, aber er ließ della Motta dabei nicht aus den Augen. Endlich war auch der dritte Knopf offen, und della Motta schob den Hosensaum übers Knie nach oben. Er lüpfte den Strumpf, und mit einem leisen Klirren fiel der Dietrich nicht in seine Hand, sondern auf den Boden. Hastig rezitierte Marconi weiter.
Della Motta legte sich auf den Rücken und tastete den Boden nach dem Dietrich ab. Jetzt spürte er das dünne Metall, nahm es sicher zwischen Zeige-, Mittelfinger und Daumen und versuchte, es ins Schloss seiner Handschellen zu stecken. Dummerweise waren sie nicht mit einer Kette verbunden, sondern ein starres Konstrukt, und der Abstand war zu groß.
»Kommt herüber zu mir, Signor Marconi.«
Marconi wollte protestieren, aber della Motta wies mit dem Kinn hinauf zum Fenster in der Tür. Marconi verstand und rutschte näher. Rücken an Rücken mit ihm suchte della Motta Marconis Handschellen. Er führte den Dietrich ins Schloss und bewegte ihn vorsichtig, bis er den Widerstand fühlte. Behutsam löste er ihn und knackte auch das zweite Schloss von Marconis Eisen. »Jetzt meine.«
»Damit Ihr mir die Kehle durchschneiden könnt?«
»Vertrauen ist wohl nicht Eure Stärke.«
»Nicht in Euch.«
»Ihr setzt lieber auf Leone?«
»Gebt her!« Marconi stocherte mit dem Dietrich herum.
»Gefühlvoll! Es ist genauso wie eine Tür mit der Haarnadel einer Dame aufzuschließen.«
»Als ob ich so viele Haarnadeln in den Händen gehabt hätte.«
»Dann stellt Euch eben vor, Ihr öffnet einen Tabernakel.«
»Ihr wisst genau, dass ich nur Mönch und nie ein katholischer Priester war. Ich fühle den Widerstand!«
»Jetzt sachte!«
Das Eisen ging auf, und della Motta nahm den Dietrich an sich. Seine zweite Hand hatte er in Windeseile befreit. Er verstaute das kleine Werkzeug wieder in seinem Strumpf, zog das Hosenbein übers Knie und knöpfte es zu.
»Und jetzt?«
»Warten wir, bis Euer Mörder kommt.«
Der ließ sich allerdings Zeit. Marconi hockte wieder auf dem Boden im hintersten Winkel der Zelle. Wer zu ihm wollte, musste erst an della Motta vorbei, und der lehnte an der Wand, da, wo ihn weder das Mondlicht noch die Laterne eines Wächters sofort erfassen konnten. Stroh raschelte, und panisch warf Marconi den Kopf herum.
»Nur eine Ratte. Eine vierbeinige.«
»Das Warten kann einen verrückt machen.«
»Das ist der Sinn der Sache. Ihr könnt ja schon einmal die Zeremonie für die Sonnwendfeier planen.«
»Ihr habt Nerven!«
»Als ich Leone das letzte Mal begegnete, brachte er bei einer Neumondfeier die Halle zum Einsturz.«
»Auf wen hat er es wirklich abgesehen? Auf den Orden oder auf Euch?«
»Auf beide. Er will, dass ich im Dienst für den Orden versage.«
»Wir hätten ihn nicht …«
Aber della Motta hörte nicht mehr zu. Er hatte das Geräusch bemerkt, mit dem der Riegel zurückgeschoben wurde und die Tür aufging.
»… nicht viel besser«, schwatzte Marconi gerade, doch della Motta hatte nur Sinne für den Soldaten, der Marconis Stimme folgte. Drei Schritte, und er hätte Marconi erreicht, das Messer blitzte im Mondlicht.
Della Motta war sofort hinter ihm, legte ihm einen Arm quer über die Brust, packte ihn an der Schulter und riss mit der Rechten seinen Kopf scharf ins Genick. Es knackte laut, und leblos sackte der Mann in seinen Armen zusammen. Mit einem Schrei sprang Marconi auf, doch della Motta war bereits herumgewirbelt und trat den zweiten Soldaten hart unter die Kinnlade. Der Mann flog gegen die Wand, und kurz darauf tat auch er seinen letzten Atemzug.
»Ihr tötet mit bloßer Hand!«, stammelte Marconi voll Grauen.
»Ich wurde nicht gefragt, ob ich es lernen wollte. Kommt!« Er hob sein Messer auf, das dem Mörder entfallen war, und nahm dem anderen Soldaten den Schlüsselbund ab. Von außen sperrte er die Zelle zu, schob den Riegel vor und lauschte.
Nichts rührte sich. Der Gang war wie ausgestorben, und auch aus den anderen Zellen kamen keine Geräusche. Entweder waren sie leer oder ihre Insassen schliefen. Kurz erwog er, sich einen Säbel zu besorgen, doch einen zu suchen, hätte Zeit gekostet, und er hatte sein Messer.
Es ging ihm zu glatt. Irgendwo mussten sich Soldaten verbergen oder zumindest ein Spitzel, der ihm folgen sollte. Beim besten Willen konnte er sich nicht vorstellen, dass die Franzosen ihn laufen ließen, ohne ihn zu beschatten, denn auch wenn Leone auf die Rache der Schlangen setzte, der Capitaine ließ gewiss keinen Spion tatenlos durch die Maschen seines Netzes schlüpfen.
In einer Wachstube klapperte etwas, und vorsichtig lugte della Motta durch die offene Tür. Zwei Soldaten lümmelten an einem Tisch, das Kinn in die Handfläche gestützt, und schüttelten abwechselnd einen Würfelbecher. Er verzog den Mund zu einem Grinsen. Entweder hatte man sie über die Vorgänge im Dunkeln gelassen, oder sie hatten grenzenloses Vertrauen in die mörderischen Fähigkeiten ihrer Kameraden. Er nahm Marconi am Arm und schlich mit ihm rasch an der Türe vorbei, als die Würfel ein weiteres Mal über die Tischplatte rollten. Er bedeutete Marconi im Torbogen stehen zu bleiben, duckte sich und schnellte in die Mitte der Straße. Das Messer in der Hand wirbelte er herum, aber er ließ es wieder sinken. Niemand hatte seitlich des Eingangs auf ihn gewartet. Er richtete sich auf und winkte Marconi.
Und trotzdem musste hier irgendwo ein Spitzel lauern. Er musterte die gegenüberliegende Häuserzeile. Ein Vorhang im Erdgeschoss bewegte sich leicht.
»Nach links um die Ecke, dort wartet auf mich.« Er selbst huschte auf die andere Seite der Gasse und drückte sich in einen Torbogen. Im nächsten Moment musste der Spitzel auf die Straße treten. Das Problem war nicht, ihn abzuhängen, das Problem war, dass der Mann sie zu zweit herauskommen gesehen hatte. Natürlich würde man Marconis Flucht entdecken, doch dafür war es noch viel zu früh.
Schnelle Schritte auf dem Pflaster verrieten ihren Verfolger. Der Mann trug keine Uniform, sondern einen dunklen Bürgerrock, und er hielt nach jemandem Ausschau.
»Sucht Ihr mich?« Della Motta sprang aus seinem Versteck und rammte ihm die Klinge ins Herz. Ein Spitzel, der das Pech hatte, auf der falschen Seite zu stehen. »Tut mir leid, Monsieur, aber Ihr habt zu viel gesehen.«
»Fünf Tote an einem einzigen Abend«, resümierte Marconi. »Ihr seid ein Tier!«
»Ich habe mir dieses Leben nicht ausgesucht.«
»Was nichts daran ändert, dass es Euch gefällt.«
6
Della Motta betrat das Spielzimmer im Gasthof mit einem gefärbten Glas in der Hand, und ein rascher Blick setzte ihn ins Bild. Ein Paar stand am Fenster, steckte vertraulich die Köpfe zusammen und unterhielt sich leise. Ein beleibter Herr, dessen Doppelkinn über die Halsbinde quoll, unterbrach sein Gespräch mit zwei Bürgern jedes Mal, sobald sich ein Lakai näherte. Oder waren die Franzosen so raffiniert, die beiden Schach spielenden Damen auf ihn anzusetzen? Wer auch immer ihn bespitzelte, er war unauffällig und gut.
Dass er beobachtet wurde, davon war er felsenfest überzeugt, man würde dem Capitaine jeden seiner Schritte berichten. Die Schritte eines frustrierten Spions, der an seinem Auftrag gescheitert war, weil man seinen Schützling vor seinen Augen ermordet hatte, und der seine Zukunft im Orden nun begraben konnte. Jedenfalls glaubten die Franzosen das so lange, bis sie die Zelle öffneten.
Am Kartentisch spielte man Pharo, zwei Pointeure gegen den Bankier, der Stapel fast heruntergespielt, und den Münzen nach, die sich vor dem Bankier türmten, waren hohe Einsätze kein Problem. Er stellte das Glas auf einen der beiden leeren Plätze und zog den Stuhl heraus.
»Ihr habt doch nichts dagegen?«
Der Bankhalter, ein untersetzter Baron mit vom Schnupfen gelblichen Nasenrändern, schüttelte den Kopf und deutete mit nach oben gerichteter Handfläche einladend auf den Platz. Vier Coups, dann war die Taille zu Ende. Der Baron zückte seine Tabaksdose und bot sie den anderen Herren an. Der Hagere zu della Mottas Rechten entnahm mit den Fingerspitzen eine Prise, tat sie auf seinen Handrücken und zog sie langsam in seine Nase. Vor ihm lag ein Satz Herz, der andere Mann setzte seine Münzen auf Karo.
»Ein Point, ein Louisdor.« Der Bankier schob della Motta die dreizehn Pik-Karten als Livret zu, und della Motta breitete sie mit der zügigen Handbewegung eines Gewohnheitsspielers vor sich aus. Die ersten Coups spielte er moderat, die Einsätze nicht zu hoch, aber auch nicht knauserig.
Er gewann und er verlor, er setzte und er trank. Sein Glas war schnell leer und er deutete dem Lakaien. Der brachte den Wein in einem Krug aus ebenfalls gefärbtem Glas, niemandem fiel auf, wie hell die Flüssigkeit war. Das Mischungsverhältnis war erprobt, ein Teil Wein, fünf Teile Wasser und ein großzügiges Schweigegeld für die Dienstleute.
»Paroli.« Della Motta bog die Ecke der Zehn um, Zeit, das Risiko zu erhöhen.
Der Bankier nickte und zog den nächsten Coup. Die erste Karte war eine Sechs, die zweite eine Zehn.
»Sept et le va!« Noch einmal die Zehn, zwei Chancen noch im Spiel. Della Mottas Zunge war schon etwas schwer. Wieder gewann er, und wieder ließ er den Gewinn liegen. »Quinze et le va!« Die letzte Zehn wurde für ihn gezogen, seine Mitspieler sahen sich ungläubig an, und er streifte den fünfzehnfachen Einsatz ein. Leerte das Glas auf einen Zug und ließ sich nachschenken.
Je mehr er trank, desto höher setzte er. Nicht nur einen Louisdor, gleich drei, vier oder fünf lagen auf einer Karte. Er machte Fehler, setzte immer mehr, um das Glück zu zwingen. Und merkte sich jede einzelne Karte, die der Bankier zog.
Er stapelte zehn Louisdor auf seine Sieben und nahm drei Anläufe, bis er einen einigermaßen stabilen Turm zustande brachte. Das Gebilde aus Goldmünzen hatte verdächtige Ähnlichkeit mit dem Campanile von Pisa, es stand schräg, aber es stand. Vier Karten waren noch im Talon, abgesehen vom Kreuz As, das en bas lag, die Herz Dame und zwei Sieben. Der Bankier deckte die beiden Karten auf.
»Plié.« Auf dem Tisch lagen die Karo und die Kreuz Sieben. »Sie gestatten?« Der Baron entnahm dem schiefen Turm fünf Münzen und schob die verbleibenden zu einem exakten, aufrechten Stapel zusammen. Della Motta schnupfte ärgerlich über sein Pech und setzte zwanzig Louisdor auf seine Dame. Diesmal wollte ihm überhaupt kein Turm gelingen, die zwanzig Münzen bildeten einen losen Haufen, die fünf auf der Sieben vergaß er. Seine Mitspieler warfen sich ungläubige Blicke zu und setzten der Form halber kleinere Einsätze. Irgendwohin, nur nicht auf ihre Damen.
Keiner war überrascht, dass die vorletzte Karte die Herz Dame war, am allerwenigsten della Motta selbst. Der Baron strich seine zwanzig Louisdor ein und della Motta tröstete sich mit einem weiteren Glas Wein.
»Wollt Ihr ernsthaft weiterspielen?«
»Und ob ich das will!« Jetzt lallte er schon ziemlich. »Ich werde, ich werde Euch …« Er hatte Mühe, das Wort zu bilden, und stieß das W überdeutlich von seiner Lippe. »Werde Euch alles wieder abknöp…, …knöpfen. Jeden einzelnen Louis…dor.«
»Wie Ihr meint.« Der Baron mischte den Talon durch und schob ihn della Motta zum Abheben hin. »Kreuz Drei en bas.«
Die anderen Personen standen jetzt hinter ihnen, es war ihnen schnell aufgefallen, dass der Italiener ruinös spielte. Erst tuschelten die Zuschauer nur, dann verloren sie ihre Zurückhaltung und kommentierten jeden Einsatz laut. Parteien bildeten sich, die einen wollten ein System hinter della Mottas Spiel erkennen, die anderen schüttelten die Köpfe über das Risiko, das er einging. Und mit ausdruckslosem Gesicht brachte der Lakai den nächsten Weinkrug.
Die Taille war fast zu Ende, die Chancen standen eins zu eins für die Bank, als della Motta sich in einem plötzlichen Entschluss vorbeugte. Er zählte die Münzen vor sich, mit einer gewissen Anstrengung, von links nach rechts, dann wieder zurück. Dann die des Barons, die konnte er zwar nicht anfassen, aber für jeden Turm tippte er mit dem Zeigefinger einmal in die Luft.
»Va … Va … Va banque!« Sein Finger landete auf der Pik Neun. Ein Raunen ging durch die Zuschauer, er hatte eben in der gesamten Höhe der Bank gesetzt.
Der Baron tat gelassener, als er war, aber ein Muskel in seiner linken Wange zuckte. Der Hagere führte sein Glas Portwein an den Mund, doch er vergaß zu trinken. Die eine Dame umklammerte die Hand ihrer Freundin und ihr Herr Gemahl die Lehne des leeren Stuhls.
Della Motta war nicht weniger angespannt. Sein Zeigefinger schmerzte fast, so fest presste er die Kuppe immer noch auf die Pik Neun. Der Baron sog die Luft durch die Zähne, hielt sie an und zog die Karte.
»Herz Neun.«
Della Motta atmete gleichzeitig mit dem Baron aus, seine Hände zitterten. Eine enorme Anzahl an Goldmünzen wanderte hinüber zum Baron. »Noch einmal. Va banque!«
Diesmal atmeten alle scharf ein.
»Marchese.« Der Baron legte seine Stirn skeptisch in Falten, aber die Gier leuchtete in seinen Augen. »Ist Euch bewusst, wie viel hier liegt?«
»Ssso unge… ungeffffähr.«
»Bedeutend weniger als Ihr vor Euch habt.«
»Ssssweifeld Ihr etwa an meiner … meiner Ssssahlungsfähigkeit?!«
»Nun ja …«
»Seht her!« Er griff in den Frack und beförderte eine zweite Börse auf den Tisch. »Ist das genug?« Die Münzen rollten zwischen die Karten.
»Worauf setzt Ihr?« Die Stimme des Barons bebte. Da stand ein halbes Vermögen auf dem Spiel, das von della Motta und seines, mit einem Schlag konnte sein Gewinn weg sein.
»Die Dame nnnnatürlich. Was wwwäre die W…Welt ohne Damen?«, lallte della Motta.
Jetzt hielt der Baron die Spannung selbst nicht aus und zog hastig den Coup. Er deckte die erste Karte auf. Die Karo Dame.
»Verflucht!« Della Motta schob den Einsatz über den Tisch, mitsamt seinen Karten. Goldene Münzen ergaben auf dem schwarzen Pik ein reizvolles Bild. Er sprang auf und stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch, während sein Stuhl krachend umfiel. Der Hagere zu seiner Rechten griff ihm rasch unter die Achsel. »Ich bitte die Herren, mich sssu entssssschuldigen.«
Er drückte den Rücken durch und wankte zur Tür. Schritt erhobenen Hauptes, immer noch die Eleganz in Person und ein würdevoller Verlierer. Nur die Schlangenlinien, die er ging, wollten nicht so recht dazu passen.
Er hielt die Komödie aufrecht, hinauf über die Treppen, den Gang entlang, bis er seine Suite erreichte. Giacomo schloss die Tür hinter ihm ab und verfrachtete ihn aufs Bett, das Ächzen und Stöhnen, die Geräusche von den Füßen gezogener Schuhe, das Ausziehen von Frack und Weste, das schwere Zurücksinken in die Kissen, alles war bis ins Kleinste durchdacht. Jeder Spitzel, selbst der misstrauischste Lauscher musste überzeugt sein, dass der Marchese della Motta im Vollrausch ein kleines Vermögen verspielt hatte.
Giacomo war vor dem Marchese wach, was nichts Besonderes war. Besonders war daran nur, dass er das Haus verlassen hatte, bevor der Marchese aufstand. Zur Beichte sollte er gehen, er wusste schon gar nicht mehr, was man dort tat. Was sollte er dem Pfaffen überhaupt erzählen? Vielleicht von Deidra, der hübschen Gouvernante auf dem Schiff, oder – wie hieß die Kleine in der Schenke von Boston noch mal? Priester standen doch auf Frauengeschichten. Aber was daran war eigentlich eine Sünde? Jeder tat das, also warum nicht auch er?
Und was war mit all den Lügenmärchen? Das wäre doch ein gefundenes Fressen für den Kerl im Beichtstuhl. Da konnte der endlich mal was erleben. Nicht immer die kleinen Sündchen der Bürgerstöchter. Ja, die Täuschungsmanöver für den Marchese, die wären schon was. So wie gestern, wo sie die ganze Welt glauben machten … Giacomo kicherte in sich hinein. In all den Jahren, in denen er in den Diensten des Marchese stand, hatte er den noch kein einziges Mal betrunken gesehen. Nicht einmal nachdem ihm die Gräfin den Laufpass gegeben hatte. Lebensmüde ja, aber niemals betrunken.
Er stemmte die Kirchentür auf und sah sich in der riesigen Kathedrale um. Die Beichtstühle waren dort drüben, und er schlenderte auf sie zu. Bà, lauter alte Weiber davor, und was da an jungem Gemüse unterwegs war, hatte die Haare unter Hauben versteckt und die Augen züchtig niedergeschlagen. Resche Mägde gingen nicht zur Beichte, die hatten Besseres zu tun. Wie Kammerdiener, wenn sie nicht gerade ein Kleiderbündel abliefern sollten.
Der Bursche zwei Plätze vor ihm in der Schlange sah auch einigermaßen verhärmt aus, was konnte der denn dem Pfaffen wohl erzählen? Außer ihnen war nur noch ein Mann in der Kirche, ein ganz schön selbstgefälliger Kerl. Der Rosenkranz hing ihm aus der Rocktasche, das war ja ein ganz ein Frommer. War wahrscheinlich jeden Tag hier, Stammgast sozusagen. Feist, mit rosigen Wangen und finsterem Blick. Diese Sünden konnte Giacomo sich lebhaft vorstellen: Abends völlern, im Bett die Hände … Wieder kicherte er. Aber vor der Madonna schön anständig sein, der Beichtstuhl als tägliche Zwischenstation auf der Fahrt ins Himmelreich.
Die Schlange bewegte sich ein paar Schritte vorwärts. Eine dicke Bürgerin hatte eben den Beichtstuhl verlassen und leierte ihre drei Vaterunser herunter oder was man da sonst beten musste. Kam wohl auf die Sünden an, die er dem Pfaffen aufschwatzte. Doch lieber was Kleines, damit er schnell wegkam, mehr als drei Vaterunser wollte er nicht … Hoffentlich keinen Rosenkranz, das Ave Maria bekam er ja noch so recht und schlecht zusammen, aber den Rest?
Die Alte hinter ihm tippte ihm auf die Schulter. Che cosa? Sì, certo! Er schlüpfte in den Kasten, auf der Seite war ein Fenster mit kleinen Löchern, dahinter der Priester. Hatte irgendwas Buntes um den Hals, na egal. Giacomo ruckte umständlich herum. Blöde Kniebank, der Pfaffe auf der anderen Seite saß sicher bequem. Der Spalt zwischen Kniebank und Boden war nicht groß, er zwängte das Bündel mit Gewalt hinein.
»In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti!«
»Amen.« Das war ja noch einigermaßen klar. »Äh …«
»Wann warst du das letzte Mal bei der Beichte, mein Sohn?«
Mein Sohn? Na von mir aus. »Ich, äh, ich weiß nicht mehr.«
»Und wodurch hast du dich gegen unseren Herrn Jesus Christus versündigt?«
Gegen …? Allora. Na vielleicht doch nicht über Deidra … »Ich habe … geklaut.«
»Gestohlen? Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut!«
»Aber es war ja nur ein Apfel«, protestierte Giacomo. Durch die Löcher konnte er das Lächeln des Priesters sehen, aber der erklärte trotzdem mit strenger Stimme:
»Ein Apfel hat Adam und Eva das Leben im Paradies gekostet. Auch ein Apfel …«
»Aber ich hatte Hunger!«, kam Giacomo nun in Fahrt. »Ich weiß ja, aber ich hatte eben kein Geld.«
»Und da hast du nur den Apfel gestohlen?«
»Was hätte ich denn … Geld? Nein, also wirklich! Ich … Du sollst nicht stehlen, das hat meine mamma mir eingetrichtert, da war ich noch so klein!« Er deutete seine Größe an, obwohl der Pfaffe sie durch die Löcher wahrscheinlich nicht sehen konnte. »Aber jetzt ist meine mamma krank, und ich …«
»… du hältst die Krankheit für die Strafe des Herrn, weil du den Apfel geklaut hast.«
Interessante Logik. »Nun ja, es war ja nicht nur der Apfel. Auch mal ein Wecken Brot. Oder ein Laib Käse.«
»Wie oft?«
»Kommt drauf an. Immer wenn ich …« Giacomo tat zerknirscht. »Immer wenn ich verloren habe.«
»Wobei?«
»Beim Würfeln.«
»Du spielst Glücksspiele?«, rief der Pfaffe entrüstet. Chiaro, hohe Herren durften ein Vermögen am Kartentisch verlieren, aber die Dienerschaft hatte ihre Groschen beisammenzuhalten.
»Aber nur, wenn ich beim Hütchenspiel nicht genug verdiene«, provozierte Giacomo den Priester.
»Beim Hütchenspiel?«
»Sie wissen schon, Vater. Drei Hütchen, unter einem eine Münze. Schnell durcheinanderwirbeln und der … äh, der …«
»Dummkopf?«
»Ah, sì, der Dummkopf, der wettet, tippt auf eines.«
»Und wenn du nicht schnell genug bist, verlierst du.«
»So in etwa.«
»Und dann würfelst du.«
»Ich muss ja von irgendwas leben«, entschuldigte Giacomo sich.
»An ehrliche Arbeit hast du nicht gedacht?«
»Naturalmente, aber die muss man mal finden! Und ich muss essen. Auch meine mamma muss essen.«
»Und wenn du beim Würfeln verlierst, stiehlst du.«
»Aber nur, was wir unbedingt brauchen.«
Der Priester erhob drohend den Finger. »Lass die Hände vom Spiel, auch von den Hütchen, wenn du nicht im Fegefeuer landen willst. Der Herr erlegt uns nur die Lasten auf, die wir auch tragen können. Zur Buße bete fünf Ave Maria!«
Giacomo nickte eifrig, und der Priester schlug das Kreuzzeichen.
»Ego te absolvo …«
Er hörte schon nicht mehr zu, antwortete automatisch mit »Amen!« und floh aus dem Beichtstuhl, kaum dass der Pfaffe fertig war. Fast wäre er aus der Kirche marschiert, da fiel ihm im letzten Moment ein … Er kehrte zurück und leierte vor der Muttergottesstatue sein erstes ›Gegrüßet seist du Maria‹ herunter. Das zweite sprach er schneller, das dritte ließ er bleiben. Für einen Apfel und einen Wecken Brot war das angemessen, den Käselaib hatte er nie gestohlen.
Als er die Kirche verließ, schlug die Glocke halb sechs, und er beeilte sich zurück in den Gasthof, um den Marchese zu wecken. Für einen Adligen war es zwar reichlich früh, insbesondere nach einer durchzechten Nacht, doch der Marchese wollte zeitig aufbrechen. Offiziell, weil er eine lange Fahrt vor sich hatte, sich aber einen Besuch des berühmten Münsters nicht entgehen lassen wollte. Eine plausible Ausrede, fand Giacomo, wer forderte schon ein Zusammentreffen mit Wegelagerern unnötig heraus? Jeder Reisende mit einem Funken Verstand versuchte, sein Ziel vor Einbruch der Dunkelheit zu erreichen. Der wahre Grund lag freilich im Wachwechsel. Der Marchese musste Marconi aus seinem Versteck holen, bevor die Soldaten die Zellentür öffneten.
Während sein Herr sich den Schlaf aus dem Gesicht wusch, zog Giacomo die Rasiermesser ab, breitete sie auf einem Tuch aus und rührte den Schaum an.
»Heute nicht, Giacomo. Meine Haut ist zu spröde.«
Auch das war Teil des Plans, nur für etwaige Lauscher bestimmt. »Das kommt vom Wein«, murrte Giacomo und packte seine Utensilien wieder weg. »Den eisblauen Frack? Der verzeiht am ehesten Fehler im Teint.« Zwinkern konnte er, das blieb einem Lauscher verborgen.
Die Unverschämtheit allerdings weniger, und prompt konterte der Marchese. »Pass auf, was du sagst!« Und dann, mit absichtlich verschlafener Stimme: »Von mir aus, den eisblauen. Und eine graue Perücke. Mein Haar ist heute irgendwie … stumpf.« Er stand vor dem Spiegel und fuhr sich mit der Hand durch den Schopf. Giacomo grinste. Mit dem Haar des Marchese war alles in Ordnung, es glänzte, noch bevor er es frisierte.
Der Pudermantel blähte sich wie ein Segel, als Giacomo ihn schwungvoll über den Marchese breitete, und senkte sich sanft. Sie sparten sich die Rasur, weil auch Marconi keine Gelegenheit zum Rasieren hatte, und er griff sofort nach der Bürste. Verstohlen teilte und durchsuchte er die dichten Strähnen, aber immer noch schummelten sich keine grauen Fäden zwischen das Schwarz. Die dreiundvierzig Jahre schienen an seinem Herrn spurlos vorüberzugehen. Ganz im Gegensatz zu ihm selbst, seine Schläfen durchzog bereits Grau, und als er an seinem Hinterkopf eine sich lichtende Stelle ertastet hatte, war ihm die gute Laune für eine ganze Woche vergangen.
Mit gleichmäßigen Strichen bürstete er das Haar des Marchese zurück, fasste es mit einem Stirnband zusammen und drehte die Längen hoch. Jetzt das Gesicht. Er entschied sich für Talkum statt für Zinn, zwar deckte es nicht so gut, aber er brauchte ja auch nur ganz wenig Weiß, gerade genug, um aristokratische Blässe über die immer noch von der Seeluft gebräunte Haut zu legen.
Die Augen durften nicht so strahlen wie sonst. Er setzte ein wenig Kohle aufs untere Lid und verwischte sie nach unten, den Wangen zu. Er trat einen Schritt zurück, musterte kritisch erst das linke, dann das rechte Auge und nickte zufrieden. Die Schatten sahen aus, als habe er die Spuren der exzessiven Nacht nicht überschminken können. Nun kam der unangenehme Teil. Er zog das Lid ein wenig herunter und stäubte einen Hauch von Puder ins Auge, sofort begann es zu tränen. Das Gleiche mit dem rechten Auge. Wieder begutachtete er sein Werk, beide Augen des Marchese waren gerötet und umschattet. Giacomo, du bist ein Künstler.
Eine Strähne lugte widerspenstig hervor, er schob sie zurück unter das Stirnband und fixierte sie erneut. Dann stülpte er die Perücke über das Haar des Marchese, lockerte mit dem Kamm zerdrückte Stellen auf und rückte den Haarbeutel gerade. Der Marchese schirmte sein Gesicht mit der Pudermaske ab und Giacomo stäubte die Perücke mit einer Mischung aus Kohle und Stärke nochmals ein. Vielleicht sah nach einer ausschweifenden Nacht der Teint seines Herrn nicht optimal aus, aber seine Frisur war tadellos.
Ein letztes Mal richtete er die Halsbinde und half seinem Herrn in den Frack. Einmal noch ging er um ihn herum und zupfte den linken Schoß zurecht. Alles in Ordnung, der Marchese war für den neuen Tag bereit. Etwas verkatert vielleicht, aber elegant wie immer.
7
Della Motta legte den Kopf in den Nacken, bewunderte die astronomische Uhr und schritt weiter. Die zahlreichen Bleiglasfenster warfen bunte Muster auf den Boden, und in der Höhe tosten Orgelklänge, obwohl kein Gottesdienst im Gange war. Einen Moment lang überließ er sich den gewaltigen Tönen, ließ sich emportragen und von einem Triller beschwingen, glitt mit der Wucht der tieferen Pfeifen in die Dunkelheit zurück und spürte sie in seinem Körper vibrieren. Seine Brust weitete sich, sein Atem glich sich dem Takt der Musik an. Er blies die Luft im Einklang mit den Akkorden von sich und hätte um ein Haar vergessen, warum er hier war.
Wie im Traum verweilte er vor einem riesigen Wandteppich, der die Hochzeit zu Kana darstellte. Folgte den Faltenwürfen der Kleider, verglich das Grün in der Draperie mit dem in der Kleidung des halb nackten Sklaven, mit der Tunika eines Gastes oder dem Kranz des Bräutigams. Und riss sich schlussendlich auch von diesem Kunstwerk los. Etwaige Spitzel hatte er von seinen musischen Absichten überzeugt.
Den Weltgerichtspfeiler im südlichen Querhaus hatte er bis zuletzt aufgehoben. Er betrachtete ihn flüchtig, ging ein paar Schritte weiter und kehrte zögerlich zurück, wie gebannt von der Aussicht auf ein jüngstes Gericht. Tat unentschlossen, als ob der Pfeiler einen tiefen Eindruck auf ihn machte, warf unwillig den Kopf zur Seite wie in einer unliebsamen, plötzlichen Eingebung und sah sich nach den Beichtstühlen um, von denen fast alle besetzt waren. Die letzten Schritte legte er erst zurück, als der linke frei wurde.
»In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.«
»Amen«, vollendete er gleichzeitig mit dem Priester das Kreuzzeichen. »Vergebt mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Ich habe einen Menschen getötet.«
Das Geräusch, das der Priester verursachte, als er aus seiner Lethargie hochfuhr, nützte della Motta, um das Kleiderbündel unbemerkt unter der Kniebank hervorzuzerren.
»Sprich weiter, mein Sohn!«
Das hatte er sich gedacht, dass der Vater jenseits der Wand auf einmal ganz bei der Sache sein würde. Nach all den langweiligen Fehltritten, die er sich Tag für Tag anhören musste, kam ihm diese Beichte wahrscheinlich wie ein Geschenk Gottes vor. Oder wie das des Teufels, wenn er das Beichtgeheimnis ernst nahm.
Er hätte dem Priester unzählige Morde beichten können, geplante oder in Notwehr begangene, an gefährlichen Gegnern oder einfachen Soldaten, die das Pech hatten, seinen Weg und vor allem seine Pläne zu kreuzen. Belastet fühlte er sich durch sie alle nicht. Nur ein Tod lag ihm auf dem Gemüt, und den hatte er längst gebeichtet, aber keinem katholischen Priester, sondern den zwei Menschen, die ihm etwas bedeuteten. Mehr als zwei Jahre war es her, dass er in der kleinen Kammer Giacomo und Sciarlotte von Chiara erzählte, dem Bürgermädchen, das er einst verführt und in den Selbstmord getrieben hatte. Er, der dreiundzwanzigjährige Libertin, der noch von nichts eine Ahnung hatte. Nicht von den Schlangen, nicht von der Liebe und kaum etwas von Ehre.
Ehre war ein gutes Motiv für einen Mord. Ein Motiv, das ein Priester einem Adeligen nachsehen würde, überhaupt wenn der Mord auf einem anderen Kontinent verübt worden war, weit weg von der hiesigen Gerichtsbarkeit. »Es geschah in Boston, es war ein Duell«, begann er, und als er zu Ende war, schwieg der Priester lange. »Vater?«
»Du hast also die Ehre der Frau verteidigt, mein Sohn?«
Wie man es nahm. Vor allem wohl seine eigene.
»Du hast sie nicht fleischlich erkannt?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Du bist demnach der Sünde Adams verfallen und hast dich von einem Weib verführen lassen.«
Ganz so konnte man es nicht nennen.
»Warst mit ihr unkeusch.«
Nun ja, nach den Regeln der Kirche und denen der Bürger.
»Das ist es, was du bereuen solltest, mein Sohn. Nicht, dass du den Mann erschossen hast, um dein Leben zu retten.«
So ein Unsinn.
»Zur Buße wirst du zehn Vaterunser beten, sieben Messen für den Getöteten lesen lassen und …«
Jetzt würde er gierig werden.
»… und unserer heiligen Frau einhundert Livres spenden.«
Na gewiss doch.
»Und halte dich …«
Nun kam die Ermahnung zur Keuschheit.
»… von den Frauen fern. Keine Mätressen, keine Bürgerinnen, keine Mägde. Nur im heiligen Stand der Ehe.«
Della Motta nickte ernst. Nicht einmal der Priester glaubte wohl, dass er sich an diesen Teil der Auflage halten würde, trotzdem schlug er das Kreuzzeichen.
»Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.«
»Amen.«
Mit deutlich befreitem Gesicht verließ della Motta den Beichtstuhl und kniete in einer der Bänke vor dem Altar nieder, der dem Abgang zur Krypta am nächsten lag. Unauffällig ließ er das Kleiderbündel neben seine Knie gleiten, stützte die Ellbogen auf und legte die Stirn in tiefer Andacht an die gefalteten Hände. Er bot das Paradebild eines reuigen Christen. »Pater noster, qui es in caelis …«, betete er und fügte freiwillig noch drei Ave Maria hinzu, um Spitzel, die immer noch nicht müde geworden waren, endgültig einzuschläfern. »… qui pro nobis sanguinem sudavit. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus …«
Als er schließlich das Kreuzzeichen schlug und sich erhob, war er sicher, dass ihn keiner mehr beobachtete. Flink huschte er die Treppen zur Krypta hinunter und vertauschte den Rosenkranz mit dem Dietrich.
»Endlich!« Marconi kam ihm sofort entgegen.
»Ich sagte doch, dass es dauern wird.« Della Motta sperrte den Zugang zur Krypta hinter sich wieder ab. »Ihr hättet hinter dem Altar bleiben sollen, kommt mit!« Er lotste Marconi zurück zum Altar und nahm eine Kerze aus einem Leuchter. Marconi zuckte zusammen, als er sie am ewigen Licht entzündete, das vor dem Tabernakel brannte.
»Euch ist nichts heilig.«
»Das ist nicht richtig, ich achte alle Riten.«
»Dann hättet Ihr das jetzt nicht getan.«
»Ich hätte … Lassen wir das. Es war die schnellste Möglichkeit, oder seht Ihr hier irgendwo einen Feuerstein? Und wir brauchen Licht.«
»Und wenn man uns entdeckt?«
»Von oben kann man die Krypta nicht einsehen.« Er entzündete eine zweite Kerze, nahm allerdings diesmal auf Marconis Gefühle Rücksicht und hielt sie an die bereits brennende.
Marconi beachtete es gar nicht. Er sah hinauf zur Decke, marschierte nervös durch die Kapelle und prüfte jeden Blickwinkel. »Für Euch ist es vielleicht eine Kleinigkeit, Ihr seid ja auch …«
»… ein Schlangenkrieger. Gerade deshalb weiß ich, was Gefahr bedeutet.«
Marconi kam zum Altar zurück, sein Kiefermuskel war angespannt und seine Miene verschlossen. Verlegenes, unangenehmes Schweigen lastete auf ihnen. Della Motta brach es, indem er den Frack auszog und begann, die Weste aufzuknöpfen. »Legt Eure Kleider ab, Signor Marconi. Ihr werdet eine Zeit lang einen Aristokraten mimen müssen.« Er sprach das Wort Aristokrat absichtlich verächtlich aus.
Marconi schlüpfte ebenfalls aus dem Rock. »Euer Stand war es nie.«
Della Motta löste die Halsbinde und legte sie auf den Altar, zog das Hemd erst aus dem Hosenbund und dann über den Kopf. Er registrierte, dass Marconi seinen muskulösen Körper betrachtete, aber den Kopf sofort wegdrehte, als er sich ertappt fühlte. »Zieht mein Hemd an.« Er knöpfte die Kniehosen auf und bückte sich nach dem Kleiderbündel. Wieder spürte er Marconis Blick auf sich, während er die mitgebrachten Hosen über seine Hüften zog. »Was ist?«
»Nichts. Ihr … Nichts.« Marconi schüttelte missbilligend den Kopf und entledigte sich seines eigenen Hemdes. Er hatte eine magere Brust und sein Bauch war schlaff. Della Motta schlüpfte in das grobe Hemd, das er in der nächsten Zeit tragen würde, und steckte es in den Hosenbund, während Marconi sein feines Leinen und die seidenen Kniehosen anzog. »Es war nie Euer Titel. Es ist Eure Eitelkeit.«
Della Motta blickte auf.
»Eure Selbstverliebtheit.«
»Ich bin nicht wie Chrétien. Nicht so fröhlich, nicht so unbeschwert und nicht so einfach.« Herausfordernd funkelte er Marconi an. »Sollte ich Euch das vormachen, nur damit Ihr mich protegiert? Ich werde nicht verleugnen, was ich bin.«
»Nein, dazu seid Ihr viel zu stolz darauf. Auf Euer Aussehen«, wieder betrachtete Marconi ihn von oben bis unten, »auf Euren Titel, auf Eure Bildung.«
»Nicht nur und nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Und warum sollte ich es auch nicht sein? Es hat dem Orden nicht geschadet.«
»Die Verlockung muss groß gewesen sein. Einer der Weisen, noch dazu der, der Euch nicht wohlgesinnt ist. Es wäre doch einfach gewesen, mich zu opfern.«
»Die Versuchung war da«, gab della Motta zu.
»Aber das Risiko zu groß? Der Plan zu durchschaubar?«
»Wenn Ihr so von mir denkt, Signor Marconi, solltet Ihr mir Euer Leben lieber nicht anvertrauen.«
»Habe ich jetzt den Ehrenmann in Euch beleidigt?«, spottete Marconi. »Ihr müsst noch viel lernen, um ein Weiser zu werden.«
»Um zu sein wie Ihr?« Ihre Blicke bohrten sich ineinander.
»Eure Arroganz ist unerträglich.«
»Dass sie Euch nicht zusagt, ist bedauerlich, Ihr müsst sie aber trotzdem nachahmen, denn in der nächsten Zeit werdet Ihr der Marchese della Motta sein. Der ist übrigens auch besser gekleidet, lasst mich Euch helfen.« Er knotete die Halsbinde neu. »Meine Hosen sind Euch zu lang, die Frackschöße auch. Hoffen wir, dass die Spitzel der Franzosen keinen Sinn für Eleganz haben.« Bei einem Mann, der einen Kopf kleiner war als er selbst, ging es eben nicht besser. Am ehesten saß noch die Weste. »Jetzt Perücke, Strümpfe und Schnallenschuhe.«
Man hätte meinen mögen, dass ein Mann seine exquisite Garderobe zu schätzen wusste. Die kühle Glätte von Seide, den festen Charakter von teurem Brokat und die kostbaren Spitzenmanschetten. Den Schnitt nach der letzten Mode. Aber Marconi zupfte missmutig an den Frackärmeln und schnippte ärgerlich die Manschetten zur Seite. Der Ausdruck, mit dem er die Kniehosen glatt strich, konnte nur als widerwillig bezeichnet werden. Er war alles andere als arm, aber die Kleider des Adels trug er als Bürger trotzdem nicht, und sie waren für ihn offenbar der Inbegriff der Dekadenz. Dabei war das nicht einmal Parure.
»Versucht, meinen Gang zu imitieren. Bis zur Kutsche müsst Ihr es schaffen, ohne Beobachter misstrauisch zu machen.« Er fuhr in den Ärmel des letzten mitgebrachten Stücks, eines einfachen Rockes, und beobachtete Marconis Bewegungen. Der stolzierte steif auf und ab. »Nein, nein, nein!« Della Motta schüttelte den Kopf. »Nicht wie ein Priester, der einen Marchese spielt. Natürlich.«
»Seit wann ist Arroganz natürlich?«
Della Motta verdrehte die Augen zur Decke. »Signor Marconi, Ihr seid Mitglied des Hochadels. Habt die Gerichtsbarkeit über zweihundert Dörfer, und dass das so sein würde, wusstet Ihr bereits, seit Ihr denken konntet, weil Euer Vater es Euch Tag für Tag vorgebetet hat. Ihr erhieltet Eure Erziehung durch Jesuiten, habt das Studentenleben unter ebenso klugen wie reichen Bürgersöhnen genossen, dann machten die Schlangen aus Euch einen Spion, aber nach außen hin wart Ihr immer noch Riccardo Visconti, der zukünftige Marchese della Motta. Ihr bewegt Euch vorwiegend bei Hof und habt mit unzähligen Menschen zu tun, die Euch in jeder Hinsicht unterlegen sind. Und jetzt zeigt mir, wie Ihr auftretet!« Seine Worte hallten in der Krypta nach.
Marconis Augen glühten, er biss die Kiefer zusammen, dass sie knirschten. Die Lässigkeit brachte er nicht zustande, doch die Selbstverständlichkeit, mit der er ausschritt, war schon wesentlich überzeugender.
»Bei der Kutsche wird Euch mein Diener den Schlag aufhalten und Euch hineinhelfen«, fuhr della Motta in gemäßigtem Ton fort. »Ihr habt die halbe Nacht getrunken und gespielt, seid also müde und verkatert. Heute habt Ihr der Kunst gefrönt und die Kathedrale besichtigt. Ein plötzlicher Impuls zu beichten überkam Euch, doch jetzt habt Ihr es eilig, Euren Weg fortzusetzen. Wohin Ihr reist, geht niemanden etwas an, Ihr habt die Auskunft auch beim Betreten der Stadt verweigert. Alles, was Ihr wollt, ist Respekt und Eure Ruhe. Lehnt Euch in die linke Ecke des Wagens, dort sieht man Euch nicht so gut. Tut, als ob Ihr schlaft, seid ungehalten, dass man Euch weckt und belästigt. Verweist auf Euren Diener, der vorne auf dem Kutschbock sitzt. Die Papiere präsentiert entsprechend verärgert, aber ohne sie aus der Hand zu geben.«
»Und wo werdet Ihr sein?«
Della Motta zog das Haarband herunter, schüttelte die Strähnen aus und band sie lose mit einer Lederschnur im Nacken zusammen. Mit Marconis abgelegtem Hemd wischte er sich die Schminke aus dem Gesicht, dann schnürte er es zusammen mit den übrigen Kleidern zu einem Bündel. Zuletzt blies er die Kerzen aus. »Ich bin der Kutscher.«
»Und Ihr seid ganz sicher, dass wir ihn nicht verhaften sollen?«
»Bin ich.« Leone schlürfte den heißen Kaffee.
»Aber er ist ein Spion.«
»Könnt Ihr beweisen, dass er gegen Frankreich spioniert hat?«
»Unter der Folter …«
»… wird della Motta euch höchstens auslachen, Capitaine. Was glaubt Ihr, mit wem Ihr es zu tun habt? Mit einem Chorknaben?«
»Er hat zwei Soldaten und einen meiner besten Agenten getötet, und ich soll ihn ungestraft davonkommen lassen?«
»Wer redet von ungestraft! Die Schlangen erfahren, dass er Marconi ins Jenseits befördert hat, um seine eigene Haut zu retten, dann beseitigen sie ihren Spion selbst.« Und damit rächte sich Leone an beiden, an diesem machtgeilen Haufen und an Visconti, auf den sie so große Stücke hielten. »Ihr schuldet mir noch viertausend. Wenn ich bitten darf!«
Der Capitaine zog eine Schublade auf, entnahm ihr vier Beutel und warf sie vor Leone auf den Tisch. Die Verachtung des Franzosen ließ Leone kalt, er schob seine Kaffeetasse zur Seite, leerte die Münzen auf den Tisch und zählte nach.
»Wollt Ihr wissen, von wem della Motta seine Aufträge bekommt?«
»Hm«, machte der Capitaine ein unbestimmtes Geräusch.
»Zweitausend.«
»Ich hatte den Befehl, Monsieur Marconi aus dem Verkehr zu ziehen, nicht das Informationsnetz einer Geheimgesellschaft aufzudecken.«
Leone sah kurz von den Münzen hoch. »Ihr wollt also nicht Karriere machen?«
»Nicht für zweitausend.«
Geizhals, elendiger! »Es war mir ein Vergnügen, mit Euch Geschäfte zu machen.« Er schaufelte die Goldmünzen zurück in die Beutel und stand auf.
»Was mich viel mehr interessiert: Warum tötete der Marchese den Spitzel, wenn wir ihn doch sowieso laufen lassen?«
»Vermutlich, weil er schon mit Verfolgungswahn auf die Welt gekommen ist. Übrigens geht der Tod dieses Spitzels auf Euer Konto. Wozu Visconti nachlaufen? Ich wette, dass er in einer Nebengasse herumlungert und sich an meine Fersen heftet, sobald ich die Kommandantur verlasse.«
»Und Ihr habt keine Angst, dass er Euch umbringt?«
»Als ob er das jemals fertigbrächte. Obwohl er es versuchen muss, er muss mich unbedingt daran hindern, die Schlangen zu informieren. Pech für ihn, dass ich ihnen schon gestern geschrieben habe.«
»Ihr und Euer Katz-und-Maus-Spiel dürften ihm ziemlich egal sein. Er streunt nämlich nicht hier herum, sondern ging ins Münster.«
»Was macht er im Münster?« Leone hielt vor der Schwelle inne. Vielleicht waren die Spitzel des Franzosen doch nicht so überflüssig.
»Kunstschätze anschauen. Gestern Abend ersäufte er seine Niederlage im Wein …«
»Niemals!«, fuhr Leone herum.
»… und konnte nicht mehr gerade gehen. Die halbe Nacht saß er am Kartentisch und verspielte im Suff ein Vermögen. Er konnte nicht mehr zwei und zwei zusammenzählen.«
»Im Suff? Ihr habt ja nicht mehr alle Tassen im Schrank!« Mit zwei Schritten war Leone beim Capitaine und packte ihn am Uniformrock. »Der war stocknüchtern, der macht Euch zwölfstellige Multiplikationen im Kopf! Wo ist Marconis Leiche?!«
»Noch in der Zelle, wir dachten, dass …«
»Ich muss sie sehen, sofort! Betrunken, Visconti! Nehmt Euch die Lakaien ordentlich vor und Ihr erfahrt das Mischungsverhältnis des Weins! Wie groß war das Vermögen, das er verlor?« Er stürmte aus dem Zimmer. »Hundert Louisdor? Zweihundert? Das ist für ihn Trinkgeld, damit hat er sich ein Alibi gekauft!«
»Er war betrunken«, marschierte der Kommandant hinter ihm her. »Das beschwören mehr als zwanzig Herrschaften mit der besten Reputation.«
»Na klar doch.«
»Er verließ den Gasthof verkatert.«
»Schon mal was von Schminke gehört? Und damit meine ich keine Schönheitspflaster!«
»Und unrasiert.«
»Unrasiert? Der eitle Geck ist niemals unrasiert. Wenn Riccardo Visconti unrasiert ist, führt er unter Garantie etwas im Schilde! Aufsperren!«, blaffte er einen Soldaten an.
»Ich habe keine Schlüssel.«
»Dann hol sie! Ach was, das dauert zu lange!« Leone knackte das Schloss kurzerhand mit dem Dietrich und riss die Tür auf. Auf dem Boden lag ein Körper, weiter hinten ein zweiter, und beide trugen Uniformen. »Merda!« Er trat ins Stroh, dass es aufwirbelte. »Dieser Hurensohn! Los, zum Münster, Ihr und ein Dutzend Soldaten! Und informiert die Wachen an den Stadttoren, dass Marconi aus der Stadt flieht!«
8
Giacomo schmiss ein paar Münzen für sein Frühstück auf den Tresen, trank den Kaffee im Stehen aus und verließ das Wirtshaus. Die Kutsche stand schon vor der Tür, und er musste zweimal hinsehen, obwohl er selbst die Verkleidung zusammengestellt hatte. Aber wenn sein Herr nicht auffallen wollte, dann fiel er auch nicht auf. Jetzt richtete er irgendwas am Geschirr, schwang sich auf den Kutschbock und nahm die Zügel auf.
Giacomo kletterte neben ihn. Der Marchese saß breitbeinig da, die Unterarme auf den Knien aufgestützt, und hantierte sehr sparsam mit den Zügeln, als ob das Fahren so eines großen Gefährts zu seinen täglichen Beschäftigungen gehörte. Sie fuhren am Münster entlang, bogen zur Westfassade ab und hielten vielleicht zehn Schritte vor dem Hauptportal. Drei Weiber mussten deshalb um den Wagen herumgehen, irgendwelche Waschfrauen oder Köchinnen oder so.
»Park deinen dämlichen Karren dort drüben, wie jeder andere auch«, keifte die eine.
»Verzieh dich, ich steh, wo ich will.«
Sie stemmte beide Hände in die Hüften, die anderen versuchten sie weiterzuziehen und schwatzten irgendwas, was Giacomo nicht verstand, aber da kam die Alte erst so richtig in Fahrt. »Verlauster Kerl«, zog sie vom Leder. »Glaubst, die Straß’ gehört dir! Kannst dir alles erlauben, weil du so einen riesigen Wagen fahrst! Mit deiner vornehmen Ekipasch. Tut grad so, als wenn’s ihm selber gehört, das Ding!«
Ein lauter Knall schnitt ihr das Wort ab, sie machte einen plumpen Satz nach hinten und glotzte belämmert die Peitsche an, die über ihren Kopf gesaust war.
»Schieb deinen fetten Arsch in die Kirche oder sonst wohin! Abmarsch!« Die Peitsche knallte ein zweites Mal.
Jetzt zog das Weib ab, meckernd und keifend, ein Bild gerechter Entrüstung. Den herrschaftlichen Kutscher konnte sie kreuzweise, und Giacomo wäre vor Lachen fast erstickt. Madonna mia, er liebte es, wenn der Marchese den Rüpel spielte. Das war ganz sein Verdienst, Giacomo, il grande impresario, hatte seinem Herrn das Benehmen der Gosse beigebracht und ihm die feinen Manieren ausgetrieben. Was war das damals schwer gewesen in den Kaschemmen von Venedig, bis der Marchese endlich essen konnte wie der Pöbel! Aber er war richtig gut geworden, schade, dass die Alte weg war.
Doch jetzt ging es ohnehin los, aus der Kirche trat der falsche Marchese und blinzelte im Sonnenlicht. Mamma mia, das ging doch nie gut mit diesem Frack! Viel zu lange Ärmel und Schöße, die Kniebünde schon fast bei den Waden! Hurtig kletterte Giacomo vom Kutschbock, riss den Schlag auf und klappte die Stufen in Windeseile herunter. Nur schnell hinein mit diesem unmöglichen Marchese-Verschnitt, bevor noch irgendwer Lunte roch!
Zügig legte Marconi die paar Schritte zurück und bemühte sich, dabei nicht zum Kutschbock zu sehen.
»Waren die Kunstwerke schön?«
Entrüstet zog Marconi die Augen zusammen. Madre mia, der war nicht gewohnt, dass ein Diener seinen Herrn ansprach.
»Verzeihung, Signore. Wollt Ihr bitte schnell Platz nehmen?« Giacomo blieb nahe am Wagen, auch als Marconi bereits eingestiegen war. »Der Marchese meint, Ihr sollt die Vorhänge genauso lassen, wie sie sind. Vielleicht drückt Ihr Euch lieber … ja, genau, in die Ecke. Den rechten Fuß ein wenig vor, lässiger. Und der Marchese würde in diesem Fall das linke Bein überschlagen, ja, genau so! Die Papiere hat er Euch gegeben? Bene. Wenn wir Glück haben, lassen sie Euch am Stadttor in Ruhe, dann muss nur ich reden. Wenn nicht, dann … na, Ihr kennt ihn ja. In dem Fall zeigt ihnen den Aristokraten. Ihr werdet hungrig und durstig sein, unter der Bank steht ein Korb. Aber Ihr sollt ihn erst anrühren, wenn wir eine Weile auf der Landstraße sind.«
Giacomo schloss den Wagenschlag, ging um die Kutsche herum und kletterte auf der rechten Seite auf den Bock. »Er ist drin. Könnte auf den ersten Blick als Ihr durchgehen.«
Der Marchese sah ihn nicht an, sondern schnalzte leicht mit der Zunge. Ein Trupp Soldaten bog ums Eck und marschierte auf die Kathedrale zu, quer über den Platz. »Verdammt!«, zischte der Herr und hielt die Pferde zurück. Niederfahren hätte er die Kerle sollen, fand Giacomo und beherrschte sich, nicht an den Nägeln zu kauen.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739380575
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (März)
- Schlagworte
- Geheimbund ehrensache verschwörungsthriller historienthriller Verschwörung Verrat mantel und degen 18. Jahrhundert machtspiele historische romane Krimi Thriller Spannung