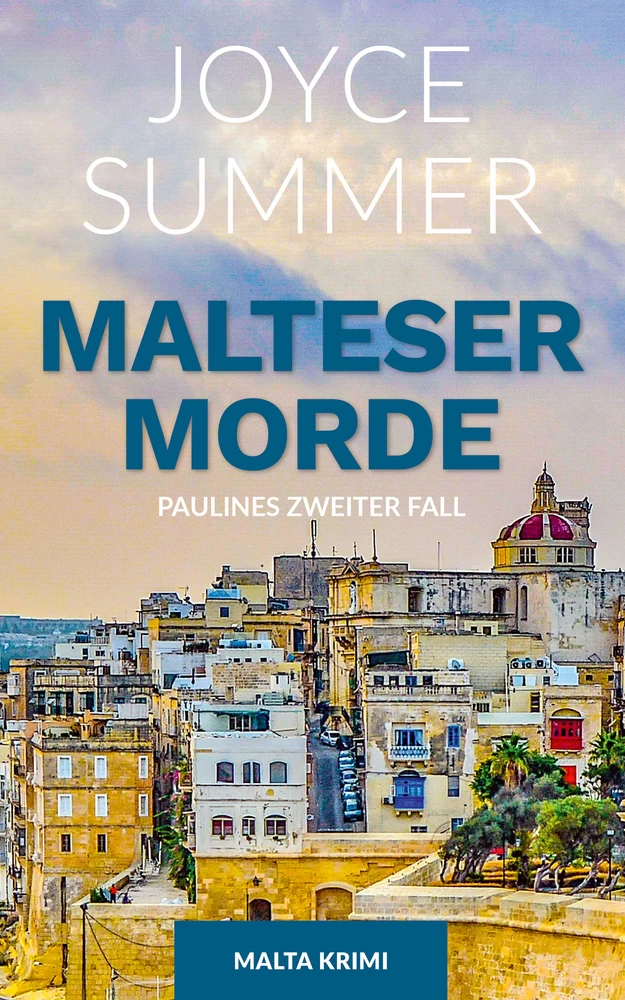Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Zu diesem Buch:
Die Cafébesitzerin Pauline ist wieder auf Reisen, diesmal mit ihrer Mutter. Aber schon am zweiten Tag stößt sie mitten auf der Promenade auf einen abgetrennten Kopf, aufgespießt auf einen Pfahl. Hat der grausame Fund etwas mit Maltas blutiger Vergangenheit zu Zeiten der Kreuzfahrer zu tun? Pauline ermittelt auf eigene Faust, denn die einheimische Inspektorin Lucchese nimmt die Sache nicht ernst und flirtet lieber mit Paulines Urlaubsbekanntschaften.
Zum Glück bekommt Pauline Unterstützung von dem Profiler Nick Aquilina.
Dennoch können sie nicht verhindern, dass weitere Morde die Insel erschüttern. Pauline und Nick müssen sich beeilen, den Serienmörder zu stoppen, denn die Wahl seiner Opfer ist nicht so zufällig wie es zunächst scheint.
Über die Autorin:
Joyce Summer lebt ihren Traum mit Krimis, die in sonnigen Urlaubsorten spielen. Politik und Intrigen kennt sie nach jahrelanger Arbeit als Projektmanagerin in verschiedenen Banken und Großkonzernen zur Genüge: Da fiel es Joyce Summer nicht schwer, dieses Leben hinter sich zu lassen und mit Papier und Feder auf Mörderjagd zu gehen.
Die Fälle der Hamburger Autorin spielen dabei nicht im kühlen Norden, sondern in warmen und speziell ausgesuchten Urlaubsregionen, die die Autorin durch lange Aufenthalte gut kennt. Die Nähe zu Wasser hat es Joyce Summer angetan. Sei es in ihren Büchern, die immer Schauplätze am Wasser haben, oder im echten Leben beim Kajakfahren auf Alster und Elbe.
Prolog
Der Bussard stieg von unterhalb der Klippe empor und landete auf einem längst verdorrten Olivenbaum, dessen trockene Überreste sich einem weißlichen Gespenst gleich an den kargen Felsen klammerten. Mit leicht schräg gelegtem Kopf betrachtete er die Szenerie vor sich. Zwei Wesen, von denen der Bussard wusste, dass sie Gefahr für ihn bedeuten konnten, standen auf dem Kliff.
Etwas seltsam kam sich Danil schon vor. Hier stand er nun direkt auf dem Dingli Cliff und posierte in einem wallenden weißen Gewand. Für ihn sah es fast wie ein Nachthemd aus, aber es sollte wohl ein historisches Kostüm darstellen. Und diese furchtbaren Pumphosen. Was sollte das nur? Selbst diesem großen Vogel, der da auf dem vertrockneten Baum saß, schien seine Aufmachung seltsam vorzukommen. Warum sonst musterte er ihn so genau?
Hinter sich hörte er wie die Wellen mit einem nassen Rauschen an der Klippe brachen. Die Sonne ging gerade unter und tauchte den kargen ausgedörrten Boden um ihn herum in ein rötliches Licht. Die Abend- und Morgenstunden waren die Zeiten, in denen Malta seine wahre Schönheit zeigte. Vergessen war die öde Dürre der steinigen Insel. Morgen und Abend verwandelten den Stein des Mittelmeeres zu Gold.
Das Dingli Cliff war ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Touristen, da es der höchste Punkt der Maltesischen Küste war. Von hier ging es über zweihundertfünfzig Meter steil hinunter. Der Blick über die Kante war wirklich spektakulär. Aber heute waren sie die einzigen, die sich hier oben aufhielten. Das mochte auch mit dem kalten kräftigen Wind zusammen hängen, der heute, völlig untypisch für diese Jahreszeit, vom Meer her über die Klippen wehte.
Danil fing an zu frösteln. Wieso dauerte das so lange? Das hatte er sich anders vorgestellt.
Sein Gegenüber ließ sich Zeit. Langsam fragte sich Danil, ob es eine gute Idee gewesen war, heute den Abend mit Myah sausen zu lassen und stattdessen hier herumzustehen. Würde ihn das wirklich weiter bringen? Er dachte an Myahs weichen warmen Körper und spürte, wie es ihn erregte. Nein, er sollte das hier jetzt beenden und nach St. Julians zu ihr fahren. Wenn er sich beeilte, konnte er noch vor zehn bei ihr sein.
»Ich denke, wir sollten das jetzt abbrechen. Ich habe meiner Freundin gesagt, dass ich noch heute Abend zu ihr gehe. Sie wird sicher langsam ungeduldig. Und glaub mir, wenn sie erst schlechte Laune hat, bekomme ich heute Nacht bestimmt nicht mehr das, was ich von ihr möchte. Du weißt was ich meine, oder?« Er grinste.
Der andere schien ihn gar nicht gehört zu haben, zumindest zeigte er keinerlei Reaktion.
Wieder fragte sich Danil, was der Typ da wohl machte. Die Ausrüstung sah wirklich beeindruckend aus. Aber Danil kannte sich mit so etwas auch nicht aus und konnte es daher nicht wirklich beurteilen. Er schaute hinüber zu dem anderen. Durch das schwarze Tuch und den großen Kasten konnte Danil nur die Beine sehen. Vielleicht hatte er ihn wegen des Tuches nicht gehört?
Er versuchte es noch einmal, diesmal lauter:
»Hallo, hast du gehört? Ich möchte das hier jetzt abbrechen. Lass es uns ein anderes Mal probieren. Ich bin jetzt nicht in der Stimmung. Mein Magen knurrt und die Sonne blendet mich.«
»Hast du deiner Freundin gesagt, was du heute Abend machst? Ich dachte, du hattest sie überraschen wollen?«, klang es dumpf unter dem Tuch hervor.
»Nein, ich habe ihr nichts gesagt. Nur, dass ich heute Abend einen geschäftlichen Termin habe. Und da ich ihr nie Einzelheiten vom Geschäft erzähle, weil es sie langweilt, hat sie auch nicht nachgefragt.«
»Also weiß sie nicht, dass du hier an den Dingli Klippen bist?«
»Nein, wie gesagt, wenn alles fertig ist, überrasche ich sie.« Was wollte der Typ, warum ritt er so auf dieser Tatsache herum. Danil spürte, wie ihm ein Unbehagen, einem kalten Schauer gleich, den Rücken hinauf kroch. Er hätte zu Hause bleiben sollen.
»Sehr gut. Ich denke, dann können wir jetzt weiter machen.« Kaum hörbar erklang die Stimme des anderen.
»Wieso weiter machen, ich habe dir doch gesagt, ich möchte jetzt gehen.« Danil merkte, wie das Unbehagen langsam der Hitze einer aufsteigenden Wut wich. Was sollte das Ganze?
»Ich denke nicht, dass du jetzt gehst.« Klar und kalt klang die Stimme.
Danil schaute ihn verdutzt an, was hatte er da gesagt? Er musste sich verhört haben.
»Ja, genau das ist es, gut so. Genau diesen Gesichtsausdruck möchte ich haben. Halt still.«
Vorne aus dem Kasten schoss etwas heraus. Es gab einen Knall, und Danil fiel hinten über. Kurz schlug der Bussard mit den Flügeln, blieb aber auf seinem Ast sitzen. Das hatte nicht ihm gegolten. Ausgestreckt lag Danil in dem weißen Gewand auf dem Rücken. Ganz kurz blitzte noch ein Gedanke in ihm auf. Ein Bedauern, dass er sich darauf eingelassen hatte. Aber dann verflog auch dieser flüchtige Gedanke, und es überkam ihn eine völlige Ruhe. Alles um ihn herum färbte sich grau, und selbst das Meer hörte auf zu rauschen. Mit dem Blick auf den Vogel, der ihn immer noch prüfend betrachtete, entglitt er ins Dunkel.
Beinahe nichts störte die Makellosigkeit seiner klaren Gesichtszüge. Außer dem kleinen roten Rinnsal von Blut, das jetzt aus dem Loch auf seiner Stirn quoll und sich langsam in Richtung seiner im Tod noch vor Erstaunen weit aufgerissenen braunen Augen bewegte.
»Da habe ich die Entfernung doch gut eingeschätzt«, brummte der andere und kam unter dem Tuch hervor. »Jetzt kann ich es vollenden. Du wirst stolz auf mich sein.«
Von seinem Baum schaute der Bussard auf das Wesen, das mit ausgestreckten Armen auf dem Boden lag herab. Nicht wertend, ohne Trost, blickte er einfach nur hinunter. Dann reckte er seine Flügel und mit einem kurzen Schlag schwebte er über das offene Meer davon.
Der Junge 1
Heute war ein besonderer Tag: sein 10. Geburtstag. Es fing schon damit an, dass sein Vater ihn heute Morgen in den Arm genommen und ihm eine Überraschung versprochen hatte.
Das tat er sonst nie.
»Willst du heute ein Spiel mit mir spielen, mein Sohn? Dann habe ich eine Überraschung für dich.« Geradezu feierlich übergab er ihm einen Briefumschlag.
»Was ist das, Papa?«, fragte der Junge erstaunt.
»Deine erste Aufgabe. Lies sie und überrasche mich. Wenn es mir gefällt, fahren wir heute Abend in die Stadt und feiern deinen Geburtstag. Wenn nicht, versuchst du es nächstes Jahr wieder.«
Gespannt nahm der Junge den Umschlag entgegen. Mit etwas zittrigen Fingern riss er ihn auf und sah auf die Karte.
»Und, hast du aufgepasst? Weißt du, was ich möchte? Spiel es mir heute Nachmittag vor. Du wirst sehen, das wird ein großer Spaß.«
Der Junge lief in sein Zimmer und holte seine Puppen heraus. Er würde seinen Vater nicht enttäuschen, nein, nicht dieses Mal.
03.06.1565 – Früh morgens St. Elmo
Die Sonne zeigte sich gerade erst am Himmel, als der hohe, klagende Schlachtruf der Janitscharen über die Zinnen von St. Elmo wehte. Der Kommandant, De Guerras, blickte hinunter und sah, wie sich eine wogende Menge aus weiß gewandeten Kriegern auf der Vorschanze des Forts ausbreitete. Seit drei Tagen setzte Mustafa Pascha, einer der beiden Kommandanten des osmanischen Heeres, diese Elitetruppe ein. Seitdem schien St. Elmo in Feuer und Blut getaucht zu sein. De Guerras kannte diese Truppen aus früheren Schlachten, die er gegen die Osmanen geschlagen hatte. Er wusste, dass ihre Kampfkraft und Erbarmungslosigkeit kein Mythos, sondern erschreckende Realität war. Ursprünglich waren sie die Söhne von christlichen Kriegsgefangenen, die der Sultan den Eltern weggenommen hatte. Auch jetzt noch stellten die christlichen Untertanen diese Armee aus ihren Söhnen. Alle fünf Jahre wurden Jungen, die das siebte Lebensjahr noch nicht erreicht hatten, gemustert. Die Vielversprechendsten von ihnen wurden dann nach Konstantinopel gebracht. De Guerras hatte gehört, dass sie dann unter härtestem Drill zu Enthaltsamkeit und striktem Gehorsam erzogen wurden. Diese Bedingungslosigkeit, ohne die geringste Furcht um ihr eigenes Leben, musste der Kommandant insgeheim bewundern. Sie brannten eindeutig darauf, für ihren Sultan in die Schlacht zu ziehen. De Guerras fragte sich, ob er noch für seinen Großmeister und seinen Glauben nach diesen Schlachten brannte. Hatte er nicht schon längst genug gesehen? Seine Männer bewunderten ihn, das spürte er Tag für Tag. Merkten sie, dass er langsam des Krieges müde wurde? Er sich immer öfter fragte, ob sie dieser Übermacht wirklich Stand halten konnten? Diese Janitscharen, ihre Menge schien endlos zu sein. Ironischerweise waren sie in ihrer kriegerischen Ausbildung und der gelebten Enthaltsamkeit ohne Familie ihm und den anderen Johannitern nicht unähnlich. Dennoch wirkten sie durch ihre wallenden Gewänder und ihren furchtbaren Kriegsruf wie eine Armee von Geistern. Der Kommandant wusste, dass viele der jüngeren Ritter sich insgeheim vor diesen scheinbar Unbesiegbaren fürchteten. Sie erstarrten fast, wenn sie deren Rufe hörten.
Er kehrte aus seinen Gedanken zurück in die Schlacht: Die Janitscharen mussten die Verteidiger im Schlaf überrascht haben. Er wandte sich an den groß gewachsenen Colonel Mas, der schweigend neben ihm gestanden hatte und wie er angespannt in die Richtung starrte, aus der die Schlachtrufe kamen: »Wissen wir etwas über unsere Männer außerhalb der Mauer?«
Der schweigsame Ritter der provenzalischen Zunge schüttelte nur den Kopf.
»Wir dürfen keine Zeit verlieren. Jetzt müssen wir das Fort verteidigen, koste es, was es wolle!«
Mas zeigte hinunter auf die Bohlenbrücke, auf der die ersten Janitscharen mit Leitern in Richtung Fort stürmten. Mit Schrecken sah De Guerras, dass das Fallgitter, welches das Fort von der den Graben überspannenden Bohlenbrücke trennte, noch nicht geschlossen war.
»An die Kanonen, sofort, und schließt das verdammte Fallgitter!«, schrie De Guerras. Es durfte nicht sein, dass sie das Fort durch einen so dummen Fehler verlieren würden.
Er nahm sein Schwert und stürzte mit Mas und einigen anderen Rittern in Richtung Gitter. Von oben setzte das Donnern der Kanonen ein. Ob sie die Invasion würden aufhalten können?
Die Menge der Janitscharen schien unerschöpflich. Die Bohlenbrücke war übersät mit Kriegern. Ein Derwisch feuerte sie mit dem Ruf an: »Löwen des Islam! Kämpft!« Unbeeindruckt von den toten Körpern ihrer Kameraden, die sie beiseite stießen, um über die Brücke zu gelangen, kamen die Janitscharen immer näher.
»Bereitet die Griechischen Feuer vor! Aber wartet auf mein Kommando, sie müssen nah genug sein!« De Guerras Stimme hallte wie ein dunkles Grollen über das Fort.
Ein großer Teil der Janitscharen hatte es mittlerweile, trotz des heftigen Abwehrfeuers, vor das jetzt geschlossene Fallgitter geschafft.
Der Derwisch schrie: »Lasst das Schwert des Herrn ihre Seelen von ihren Leibern, ihre Köpfe von ihren Rümpfen trennen!« Sie schossen durch das Gitter und De Guerras sah, wie sie auch im Inneren des Forts ihre Opfer fanden.
»Sind die Feuer bereit?« Der Kommandant blickte zu den Zinnen der Mauer, auf der sich mittlerweile maltesische Soldaten mit Töpfen voller Griechischer Feuer positioniert hatten. Der Geruch von Salpeter und Terpentin breitete sich aus. Die Mischung, zusammen mit dem enthaltenen Ammoniak und Pech, würde riesengroße Flammen entwickeln, sobald sie entzündet war. De Guerras gab das Zeichen, die Dochte in den Töpfen anzuzünden und auf die Janitscharen zu schleudern.
Die Wirkung war verheerend. Die wallenden weißen Gewänder fingen Feuer. Die Janitscharen rannten, menschlichen Fackeln gleich, schreiend und fast besinnungslos vor Schmerz umher. Viele von ihnen fielen in den Wallgraben. Andere entzündeten beim kopflosen Zurückweichen vor dem Feind ihre nachstürmenden Kameraden.
Es war ein furchtbares Inferno. Der süßliche Geruch des verbrannten Fleisches erfüllte die Luft, gepaart mit dem beißenden Geruch des Ammoniaks. Einige der jungen Soldaten mussten sich beim Anblick der verkohlten Leichen übergeben. De Guerras erinnerte sich, dass es ihm in seiner ersten Schlacht vor vielen Jahrzehnten ähnlich ergangen war. Sie waren noch so jung. War es wirklich fair von so alten Männern wie dem Großmeister und ihm, diese jungen Männer in den fast sicheren Tod zu führen?
Bis zum Mittag ließ Mustafa seine Männer gegen das feuerspeiende St. Elmo anlaufen. Er kannte keine Gnade, auch nicht für die Seinen.
Erst als sich am Nachmittag der Rauch der Feuer verzog, konnte De Guerras das wahre Ausmaß dieses Tages sehen. Die Brustwehren waren übersät von Gedärmen und Gliedmaßen der im Geschützfeuer in Stücke gerissenen Männer. Sie würden die ganze Nacht brauchen, um ihre Toten zu verbrennen. Wie in all den Nächten zuvor durfte er wieder keine christlichen Begräbnisse erlauben. Die Seuchengefahr war zu groß. Die Verluste der Türken waren noch schrecklicher. Sie hatten fast dreitausend Mann verloren. De Guerras fragte sich, wieviele solcher Tage seine geschwächten Männer noch durchstehen konnten. Zum Glück waren die Johanniter auch in der Krankenpflege ausgebildet und konnten die Verletzten zumindest notdürftig versorgen. Bei vielen von ihnen zweifelte er jedoch, dass sie den nächsten Tag überleben würden. Die Zahl seiner kampffähigen Männer wurde von Tag zu Tag geringer.
Mit Blick auf das Banner des Sultans, welcher über dem Ravelin wehte, rief De Guerras:
»Die Bohlenbrücke muss abgebrannt werden. Über diesen Weg darf niemand mehr ins Fort gelangen.«
Dass damit auch für die Besatzung einer der Fluchtwege aus dem Fort verloren war, war allen nur zu bewusst.
02.08.2012 – 01:42 Malta
Er sah zu, wie die Flammen das weiße Gewand entzündeten. War es, wie er es sich vorgestellt hatte? Er hatte eine riesige Fackel sehen wollen, aber es brannte nicht so, wie er es erwartet hatte.
Wahrscheinlich hätte er in die Flüssigkeit zum Tränken des Gewandes mehr Schwefel mischen müssen. Dies entsprach in keiner Weise dem Bild in seinem Kopf. Er war unzufrieden mit sich. Warum hatte er nicht besser geplant? Der Beginn auf der Klippe war so perfekt gewesen. Die Flammen knisterten leise, als sie die Haare erreichten. Immerhin breitete sich jetzt auch ein Gemisch von unterschiedlichen Düften aus. Er atmete tief ein. Dieses vielschichtige Bukett wollte er in seinem Gedächtnis halten. Er roch das Süßliche des verbrannten Fleisches, durchsetzt mit dem scharfen Gestank verkohlter Haare und dem holzigen Geruch versengter Nägeln.
Ob er so dem Erlebnis der Überlebenden von damals nahe kam?
Er fühlte in sich hinein. Er hoffte Befriedigung zu finden. Aber dort war nur Leere. Auf einmal wusste er, was er falsch gemacht hatte. Der Tod war viel zu schnell gekommen. Es war von menschlichen Fackeln die Rede gewesen. Fürchterliche Todesschreie, die Stunden andauerten. Dies hier war nur noch totes Gewebe, das brannte. So hatte er den Übergang vom Leben zum Tod nicht spüren können. Die Inszenierung allein reichte nicht aus, beim nächsten Mal musste es mehr sein. Es war zu schnell gegangen, er musste geduldiger werden.
Ruhig drehte er sich um und ließ sein brennendes Opfer hinter sich. In der Ferne hörte er die Sirenen. In seinem Kopf formte sich ein Bild. Ja, er würde lernen und es besser machen.
23.08.2012 – 11:12 Flughafen Luqa, Malta
Pauline schaute hinunter auf die Insel. Das war so ganz anders als Madeira. Der Boden war fast durchgehend sandfarben, es gab viele Häuser und kaum Grün. Es erinnerte sie an Ägypten, dort war es ähnlich karg. In ihrem Reiseführer hatte sie gelesen, dass die Insel weniger Grundwasser hatte als der arabische Staat, was den Eindruck aus der Luft erklärte.
Als sie aus dem Flugzeug stiegen und Richtung Flughafengebäude gingen, wehte ein warmer, fast heißer Wind. An der Temperaturanzeige konnte Pauline sehen, dass sie am späten Vormittag schon fast 28 Grad im Schatten hatten. Besorgt drehte sie sich zu ihrer Mutter um. War die Wahl des Urlaubsortes die richtige gewesen? Pauline konnte Hitze gut vertragen, aber ihre Mutter? Paulines Mutter Frauke hielt ihren Sonnenhut fest und strahlte Pauline glücklich an. Sie genoss es, mit ihrer großen Tochter in den Urlaub zu fliegen. Auch wenn ihr insgeheim tatsächlich etwas vor der maltesischen Hitze graute.
Die Koffer kamen, wie immer bei Pauline, als letztes aufs Band. Aber sie hatte beschlossen, sich keinen Stress zu machen. Dieser Urlaub sollte nun wirklich der Entspannung dienen und nicht wie beim letzten Mal mit Ben in einer mörderischen Verfolgungsjagd enden. Gut, sie musste zugeben, das war nicht Bens Schuld gewesen. Eigentlich hatte es viel mehr mit ihrer Neugier zu tun. Und vielleicht auch ein klein wenig damit, dass sie beim letzten Urlaub über eine Leiche gestolpert war. Aber mit ihrer Mutter würde sie sich ohnehin nicht in abgelegenen Gegenden herumtreiben, sondern sich an das Standard-Tourismus-Programm halten. Wahrscheinlich würden sie sich noch nicht einmal ein Auto mieten, da das Bussystem auf Malta gut ausgebaut war – behauptete zumindest der Reiseführer. Außerdem hatte sie Ben versprochen, sich kein Auto auszuleihen. Zum einen sorgte er sich wegen des Linksverkehrs auf Malta, zum anderen wusste er, wie es aussah, wenn Pauline mit ihrer Mutter Auto fuhr. Meistens redeten die beiden Frauen soviel, dass sie sich verfuhren, weil sich keine auf den Weg, geschweige denn auf den Verkehr konzentrierte. So hatte eine einfache Fahrt vom Flughafen Hamburg schon einmal im Nachbarort Norderstedt geendet, statt in der Hamburger Innenstadt. Pauline musste selber zugeben – auch wenn sie zunächst bei Bens Argumenten etwas sauer gewesen war – dass sie keine große Lust hatte, auf Malta mit dem Auto zu fahren. Sie würde die Insel kaum genießen können, wenn sie ständig auf die anderen Autos und den Verkehr achten musste.
Mittlerweile standen Pauline und ihre Mutter vor dem Flughafen von Luqa. Dieser lag im Süden der Insel, unterhalb von Valletta und Pauline rechnete damit, dass sie einige Zeit bis zum Hotel in St. Julians, im Norden von Valletta, benötigen würden. Sie winkte einem Taxi, das sie zum Hotel bringen sollte.
Der Taxifahrer freute sich sichtlich, zwei Frauen in seinem Taxi zu chauffieren und verwickelte Pauline und ihre Mutter schnell in ein Gespräch.
»Waren Sie schon einmal auf Malta? Oder ist es Ihr erstes Mal bei uns?«
»Ich war schon vor längerer Zeit einmal hier. Damals hat es mir schon gut gefallen. Und was ich an Malta wirklich mag, ist der arabische Einfluss, den man überall spürt: beim Essen, in der Sprache«, entgegnete Pauline.
Der Taxifahrer schaute Pauline strafend im Rückspiegel an und hob die Stimme.
»Was, wie kommen Sie denn darauf? Wir sind keine Araber, wir sind Christen.« Er deutete auf ein Kreuz, das gut sichtbar am Rückspiegel baumelte.
Pauline guckte erstaunt, eigentlich hatte sie dem Taxifahrer ein Kompliment machen wollen, aber das schien er gründlich missverstanden zu haben. Egal, sie wollte nicht mit ihm diskutieren. Stattdessen freute sie sich lieber darauf, heute Abend mit ihrer Mutter in einem netten Restaurant im alten Teil von St. Julians zu sitzen und Fenek Stuffat, Maltas berühmten Kaninchenauflauf, zu essen.
Schweigend genossen sie und ihre Mutter den Rest der Fahrt, vorbei an alten sandsteinfarbenen Palästen und modernen, zum Glück ebenfalls sandsteinfarben gehaltenen Neubauten. Es ging zunächst entlang der Küstenstraße durch das alte Valletta, der Stadt, die nach ihrem Erbauer, dem Großmeister De la Valette, benannt worden war. Ohne merklichen Übergang kamen sie danach nach Sliema. Diese Stadt galt – wie Pauline gelesen hatte – als die Hochburg für die IT- und Spieleindustrie. Dass hier mehr das neuere Geld lebte, meinte Pauline auch gleich am Straßenbild zu erkennen. Schicke moderne Bars wechselten sich mit edlen Restaurants ab. Der morbide Charme, den Valletta mit seinen kleinen geschlossenen Balkonen, die sich in den unterschiedlichsten Farben an die Häuser schmiegten, ausgestrahlt hatten, war verflogen. Jetzt machte die Uferstraße eine scharfe Rechtskurve und stieg danach steil an. Sie umrundeten eine kleine Bucht, in der wieder alte Häuser erschienen. In der Bucht dümpelten einige kleine bunte Fischerboote zwischen Bergen von Plastikmüll. Wie schade, dachte Pauline. Es war sonst so malerisch, aber dieser Müll zerstörte den Anblick.
»Das ist die Spinola Bay. Wenn Sie abends gut essen gehen wollen, sollten Sie hierhingehen.«, ließ sich der Taxifahrer vernehmen. Scheinbar hatte er Pauline den Fauxpas von vorhin verziehen.
»In dem Restaurant dort drüben sind früher Sophia Loren und Gina Lollobrigida ein und aus gegangen. Sie müssen den alten Besitzer nur fragen, er kann ihnen viele Geschichten aus den Fünfzigern und Sechzigern erzählen.« Pauline rechnete sich im Stillen aus, dass der alte Besitzer wirklich sehr alt sein musste, wenn er das Restaurant schon vor fast 60 Jahren geführt hatte. Aber vielleicht war damals auch sein Vater der Geschäftsführer gewesen. Im Geiste notierte sie sich den Namen, um zu prüfen, ob es sich wirklich lohnte, dort mit ihrer Mutter vorbeizugehen. Vielleicht bekam der Taxifahrer auch Provision, wenn man dort einkehrte.
Sein nächster Satz bestätigte ihren Verdacht: »Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen dort für heute Abend gleich einen Tisch reservieren lassen. Es gibt ausgezeichneten Oktopus und Lampuki in jeder Form.«
»Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, aber wir wollen heute erst einmal ankommen und werden den Abend ruhig angehen.« Pauline schaute ihre Mutter an. Diese nickte kaum merklich. Auch sie hatte verstanden, worum es dem Taxifahrer eigentlich ging.
Dieser schien nicht besonders glücklich, dass er mit seiner Masche bei den beiden Frauen nicht gelandet war. Auch das großzügige Trinkgeld, welches Frauke ihm bei der Ankunft in ihrem Hotel in die Hand drückte, schien seine Laune nicht zu bessern. Ohne ein Dankeschön und eine Verabschiedung fuhr er davon.
Pauline und Frauke schauten sich um. Das Hotel – an der Spitze einer kleinen Landzunge gelegen – war sehr viel größer als die Hotels, in denen Pauline normalerweise mit Ben abstieg. Sie hatte es wegen des direkten Zugangs zum Meer und der etwas ruhigeren Lage ausgewählt. Das Gebäude selbst war ein großer brauner Klotz und ziemlich hässlich von außen. Aber die Zimmer hatten fast alle Meerblick, da das Hotel sich in einem geschwungenen ‚U‘ in Richtung Mittelmeer öffnete. Außerdem verriet Pauline ihr Blick aufs Meer, dass man wahrscheinlich wunderbar schnorcheln konnte. Durch das klare Wasser konnte sie bereits von der Straße aus Steine und Fische erkennen. Vielleicht konnten sie nachher schon einen kleinen Ausflug ins Meer unternehmen, gleich nachdem sie die Koffer ausgepackt hatten.
04.06.1565 – Mittags Hafen von Birgu, Malta
Ein kleines Boot lief in den großen Hafen ein. In der Nacht war es unbemerkt an den osmanischen Kriegsschiffen vorbeigeschlichen. Hauptmann Andres de Miranda stand an Deck und blickte auf das umkämpfte Malta.
Die beiden Halbinseln Birgu und Senglea bildeten fingerartige Einschnitte in den großen Hafen vor ihnen. Vom Boot aus konnte Miranda einen Teil der Galeeren sehen, mit deren Hilfe die Ritter das Mittelmeer beherrschten. Diese Galeeren waren es, die auch den Vizekönig von Sizilien interessierten. Ihre Schnelligkeit und Wendigkeit war fast einzigartig in dieser Zeit. Sie hatte den Rittern geholfen, eine starke Seemacht im Mittelmeer zu werden.
Miranda war zum ersten Mal auf Malta, hatte aber schon viele Geschichten über den Fels aus Sandstein gehört. Der Johanniterorden war erst seit etwa 40 Jahren hier. Davor war er durch Soliman von Rhodos vertrieben worden. Malta war den Rittern damals als schlechter Tausch gegen Rhodos erschienen, war die Insel in ihren Augen doch für den Anbau von Weizen und Getreide völlig ungeeignet. Auch gab es nicht viel Holz, sodass zum Heizen auf Kuhdung und Disteln zurückgegriffen werden musste.
Salvago rieb sich den Schweiß von der Stirn. Er kam aus einer Bergregion im Norden von Spanien, und Miranda merkte ihm an, dass er die Hitze nicht gut vertrug. Aber auch Miranda spürte die glühende Sonne: Schon jetzt am späten Vormittag war es auch für ihn in seiner Rüstung fast unerträglich heiß.
»Wenn der Orden noch auf Rhodos seinen Sitz hätte, wäre es sicher angenehmer. Was meint Ihr, Chevalier Miranda?«, fragte ihn der jüngere.
»Da habt Ihr recht. Aber wenn es nach dem Willen des Sultans geht, wird er die Johanniter auch von diesem Flecken vertreiben. Dabei hörte ich, dass die Liebe zu Malta beim Orden noch nicht sonderlich tief sein soll. Es ist doch sehr karg. Wenn sie kein Getreide von Sizilien erhalten würden, wäre es kaum bewohnbar. Aber seid Euch sicher Chevalier, der Großmeister wird diesen Ort bis auf den letzten Mann verteidigen. Er ist sich bewusst, dass Malta für den Rest Europas schicksalsentscheidend ist. Er muss den Osmanen standhalten.« Miranda blickte vor sich über den Hafen. Diese Häfen waren wirklich der große Vorteil von Malta und lebensnotwendig für einen Orden, der mittlerweile ein Orden von Seefahrern war.
Miranda wusste, dass der jetzige Großmeister De la Valette in den letzten Jahren diese Häfen erweitert hatte und in weiser Voraussicht die Befestigungen im Großen Hafen ausgebaut hatte. Birgu, die Stadt, in der der Großmeister sein Lager aufgeschlagen hatte, war von einem durchgehenden Ring von Verteidigungswerken umgeben. Von der Landseite her war es zudem durch eine hohe Festungsmauer mit zwei Bastionen geschützt.
Der weitsichtige alte Mann, De la Valette war siebzig Jahre alt, hatte sich und Malta lange auf diesen Angriff vorbereitet. Er hatte zusätzlich zu den Verteidigungsanlagen in Birgu ein starkes neues Fort auf der Halbinsel Senglea, das Fort St. Michael, errichten lassen. Außerdem hatte er den Bau eines zweiten, kleineren Forts, St. Elmo, befohlen. Dieses lag direkt zwischen den Einfahrten zum Großen Hafen auf der oberen Begrenzung zum Mittelmeer. Dennoch bezweifelte Miranda, dass Malta gegen das Übermaß des osmanischen Heeres zu halten war.
Als hätte Salvago seine Gedanken gelesen, meinte dieser: »Was wird der Großmeister sagen, wenn wir ihm die Nachrichten meines Vizekönigs bringen? Geben wir ihnen damit nicht den Todesstoß?«
»Wir haben heute Morgen gesehen, wie diese Männer kämpfen können. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Chevalier. Auch wenn die Lage in St. Elmo furchtbar ist.« Salvago und er hatten kurz zuvor in St. Elmo halt gemacht. In der vergangenen Nacht hatten die Männer um De Guerras fünf Stunden gegen die einfallenden Osmanen gekämpft. Furchtbar war dafür ein viel zu schwaches Wort, das wusste Miranda. Aber der junge Salvago wirkte durch die Erlebnisse der letzten Stunden schon eingeschüchtert und unsicher genug, warum sollte er das jetzt noch verstärken?
Miranda sah vor seinem inneren Auge den Dampf des verschossenen Pulvers, der über dem Fort geschwebt hatte. Und er meinte immer noch die Überreste des Griechischen Feuers mit seinem fauligen Gestank von Schwefel und dem harzigen Geruch von Terpentin zu riechen. Am schlimmsten aber war auch für ihn der beißende Geruch von verbrannten Haaren und Fleisch gewesen, der alles andere überlagerte. Viele Männer der Besatzung hatten sich kaum noch rühren können.
Wieder wurden seine Gedanken von Salvago unterbrochen.
»Wie lange wollen die Männer in Fort St. Elmo noch ausharren? Diese unbarmherzige Hitze am Tage. Einer von den Soldaten hat mir erzählt, dass es Nachts schrecklich kalt wird, wenn vom Meer der kalte Dunst aufzieht. Ich fühle mich irgendwie schuldig, dass wir keine guten Nachrichten haben.« Salvagos junges Gesicht verdüsterte sich.
Der Junge hatte recht, dachte Miranda. Die Überlebenden waren gezeichnet. Die Gliedmaßen verstümmelt oder gebrochen und die Gesichter durch die vielen Wunden entstellt. Ob der Kommandant seine Kämpfer so überhaupt noch erkennen konnte? Ahnte der Großmeister, wie es um die Kampfmoral der Männer im Fort wirklich bestellt war? Nach dieser grauenvollen Nacht wären so manche entmutigt, hatte ihm der alte Kommandant sein Leid geklagt. In vielen Gesichtern hatte Miranda Angst und Verzweiflung gesehen. Sie hatten dem Feind den Ravelin, die Vorschanze des Forts, überlassen müssen. Hier ragte jetzt, für die Männer im Fort gut sichtbar, das Banner des Sultans empor. Miranda konnte sehen, dass die nächtliche Schlacht auch schlimme Verluste bei den Türken gefordert hatte. Berge von Leichnamen lagen vor dem Fort. Es mussten mehrere tausend Mann sein, die Mustafa Pascha verloren hatte.
Das kleine Boot bahnte sich seinen Weg zwischen zwei großen Kriegsgaleeren und legte an. Salvago und er betraten Birgu. Die Konventskirche des Ordens ragte weit sichtbar empor, sie bildete den Mittelpunkt der Garnison. Weiter oben erhob sich die Ordensfestung, St. Angelo, die durch Gräben und eine Zugbrücke vom restlichen Birgu getrennt war. Dies würde sicher eine der letzten Bastionen sein, die an die Türken fallen, sinnierte Miranda mit Blick auf die Festungsmauern mit ihren Geschützen, die über die Bucht zielten.
Zwischen den kleinen flachen Häusern der Bewohner von Birgu waren überall Waffenarsenale und Magazine errichtet worden, und es gab einen großen Getreidespeicher. Der Kommandant in St. Elmo hatte Miranda erzählt, dass De la Valette als Vorbereitung auf die Belagerung mehrere dieser großen Kornspeicher hatte bauen lassen. Riesige Mengen von sizilianischem Getreide waren dort für die Kriegszeit eingelagert. Aber wie lange würden diese Vorräte halten? Auch das Wasser würde irgendwann knapp werden. Zwar hatte auch hier der Großmeister vorgesorgt und tausende von Wasserkrügen füllen lassen. Um aber den Belagerern keine Möglichkeiten der Wasserbeschaffung auf Malta zu bieten, hatte De la Valette anschließend die Brunnen der Insel vergiften lassen. Es war also nicht mehr möglich, Wassernachschub zu organisieren.
Die Häuser der acht Zungen, in die sich die Johanniter aufteilten, wirkten in ihrer Pracht und Mächtigkeit seltsam fehl am Platz in diesem ehemaligen Fischerdorf, das nun für den Krieg gerüstet war. Mit dem Blick auf ein Kind, welches zwischen den Häusern spielte, fragte sich Miranda, ob es noch so etwas wie Normalität für die Bevölkerung hier gab? Was empfanden sie, wenn sie die Salven der Kanonen hörten, die vom umkämpften St. Elmo her tönten?
Die Vorbereitung auf diesen Krieg hatte die letzten Jahrzehnte beherrscht. Dieses spielende Kind kannte sicher nichts anderes. Und auch der Großteil des Lebens seiner Eltern war durch die Zeit vor dem großen Krieg, in dem sie jetzt waren, geprägt. Ritter, die in voller Rüstung, trotz der Hitze, mit schepperndem Gang durch die Gassen patrouillierten, waren der Alltag.
Die schwere Kette an dem Öffnungsmechanismus des Tores wurde mit einem lauten Rasseln in Gang gesetzt. Vor ihnen öffneten sich langsam die Pforten der Festung. Ihre Ankunft war nicht unbemerkt geblieben. Miranda wusste, dass viele in ihnen die letzte Hoffnung auf Rettung sahen. Eine herbeieilende Wache geleitete sie in Richtung Kapitelsaal im Herzen der Festung. Dort wartete der Großmeister mit seinem Obersten Rat auf sie. Im Inneren der Festung war es im Gegensatz zu draußen fast schon kalt. Die dicken Sandsteinblöcke der Mauern kühlten die Umgebung auf ein erträgliches Maß.
Miranda stieg mit Salvago die breiten Stufen zum Saal empor. Hier standen weitere Wachen in voller Rüstung. Die Eichentüren des Saales wurden mit einem lauten Knarzen geöffnet. Die beiden traten ein.
Miranda schlug ein Geruch von Staub, Moder und Waffenöl entgegen. Dieser Saal war nicht vergleichbar mit den prächtigen und glänzenden Sälen, die er an den europäischen Höfen schon betreten hatte. Dieser Saal strahlte aus jedem Winkel die Geschichte von vergangenen Kämpfen aus. Von der Decke hingen zerrissene Banner. Miranda meinte, auf ihnen Spuren von Blut und Schwertschlägen zu erkennen. Zeugen der vielen Schlachten, die die Ritter im Namen von Christus geschlagen hatten. Und des Blutes, das dabei vergossen worden war. An den Wänden hingen Schilder und Schwerter. Auch diese waren teilweise zerfurcht und schartig von den Schwertern ihrer Gegner. Der alte Kämpfer in ihm war fasziniert: Dies war sie also, die Zentrale der Tempelritter, die die wichtigste Schlacht für das Abendland schlugen.
Vor ihnen an der großen Tafel konnte Miranda nur schwer die Mitglieder des Rates erkennen. Durch die schmalen, wie Schießscharten geformten Fenster fiel nur ein spärliches Licht. Er wusste, dass sich der Rat aus den Vorständen der acht Zungen, dem Prior der Konventskirche und weiteren hohen Würdenträgern des Ordens zusammensetzte. Alles Männer, die kampferprobt waren und ihr Leben dem Orden geweiht hatten. Sie lebten wie Mönche, jede weltliche Freude war ihnen untersagt. Die Ritter waren für den Kampf ausgebildet worden, Entbehrungen waren ihr Leben. Ob sie empfinden konnten, was es bedeutete einen geliebten Menschen zu verlieren? Was es hieß, wenn Frauen ihre toten Männer und Söhne betrauerten? Miranda dachte an die verzweifelte Besatzung im Fort St. Elmo und an die Leichenberge der türkischen Gefallenen.
Aus dem Dunklen erklang eine klare dunkle Stimme: »Tretet näher Chevaliers, welche Nachricht bringt Ihr mir von Don García? Wie ich sehe, hat er mir noch keine Verstärkung geschickt.«
Miranda sah zum Kopf des Tisches, von wo er die Stimme vernommen hatte. Dort saß der Großmeister des Ordens, Jean Parisot de la Valette.
Salvago räusperte sich nervös. Er war wirklich noch sehr jung und Miranda sah ihm an, dass er nicht glücklich war über die Aufgabe, mit der ihn der Vizekönig betraut hatte.
»Zunächst möchte ich Eurer Eminenz die Grüße von Don García, dem Vizekönig von Sizilien überbringen. Er hofft, dass Ihr bei guter Gesundheit seid.« Miranda zuckte zusammen, diese Wortwahl war in Angesicht der derzeitigen Umstände mehr als unpassend. Salvago schien das auch bemerkt zu haben. Trotz der Kühle in diesen Räumen konnte man sehen, dass wieder kleine Schweißtropfen anfingen ihm von der Stirn zu perlen und über sein jugendliches, noch leicht pausbäckiges Gesicht liefen.
»Ihr müsst der Gesandte Chevalier de Salvago sein, richtig?« Salvago nickte als Antwort nur mit dem Kopf.
Der Großmeister wandte sich an Miranda: »Und Ihr müsst dann der Chevalier Andres de Miranda sein, nehme ich an?«
Miranda bejahte, ebenfalls mit einem kurzen Nicken.
»Was sagt Don García, warum er mir zu diesem Zeitpunkt keine Verstärkung schickt?« Miranda sah, dass der Großmeister mit ihm reden wollte und Salvago links liegen ließ. Mit Blick auf die vor Nervosität und Anspannung geweiteten Augen des jungen Spaniers beschloss er, diesen von der Aufgabe zu erlösen und De La Valette die Botschaft des Vizekönigs zu überbringen.
»Sir, der Vizekönig wird Euch so schnell wie möglich Verstärkung schicken. Aber im Vorwege möchte er zum Austausch und als Zeichen der Anerkennung seines guten Willens acht der Galeeren haben, die in Eurem Hafen liegen.« Miranda hörte, wie mehrere Mitglieder des hohen Rates hörbar die Luft einzogen. Der Großmeister schien äußerlich völlig unbeeindruckt.
»Ach ja, ist das so?« Die Stimme war ruhig und ohne Emotionen.
Miranda sah ihn an. Die wachen dunklen Augen musterten ihn kritisch. Das schmale Gesicht war braun gebrannt und von Falten durchzogen. Seine Haare waren grau und das asketische Antlitz zum Teil mit einem gelockten Spitzbart bedeckt, an dem man noch erahnen konnte, dass De La Valette in seiner Jugend dunkelbraune Haare gehabt haben musste. Trotz Falten und grauer Haare sah man ihm sein Alter kaum an. Miranda konnte kaum glauben, dass sein Gegenüber 70 Jahre alt sein sollte. Kerzengerade saß der Großmeister auf dem hochlehnigen Eichenstuhl mit der verschlissenen Lederbespannung und strahlte Kraft und eine erstaunliche Lebendigkeit aus. Was ging wohl in ihm vor? Miranda hatte gehört, dass er stur und kompromisslos sein sollte. Hart gegen andere, aber auch gegen sich selbst. Ein Mann, der es als einer der wenigen geschafft hatte, ein Jahr als Galeerensklave zu überleben. Miranda hatte Männer gesehen, die nur einen Monat als Sklave hatten ausharren müssen, bevor ihre Familien Lösegeld an die Türken gezahlt hatten. Es waren gebrochene Männer gewesen, um Jahrzehnte gealtert. Nicht aber De la Valette. Ihn schienen diese Ereignisse gestählt zu haben. Die Kleidung des Großmeisters war die eines schlichten Ritters und spiegelte in keiner Weise seine Position wider. Auf solche Insignien legte der alte Mann scheinbar keinen Wert. Musste er auch nicht, denn jeder, der diesen Saal betrat, spürte sofort die Macht, die von dem Alten am Kopfende der Tafel ausging. Miranda fragte sich, was mit Menschen passierte, die sich nicht seinem Willen beugten. Die Augenbrauen des Großmeisters gingen in die Höhe, er hatte bemerkt, dass der Spanier ihn taxierte.
»Und, Chevalier? Habt Ihr mir noch etwas zu sagen?« Ein lauernder Unterton war jetzt in der Stimme zu hören.
»Nein, Eure Eminenz. Oder doch. Wir haben kurz Station in St. Elmo gemacht und haben den Kommandanten und seine Mannschaft zwar lebend, aber in einer schlechten Verfassung aufgefunden. Sie benötigen dringend Unterstützung.«
»Ist das nicht eine Ironie, dass derjenige, der mir die Nachricht überbringt, dass es keine Hilfe aus Sizilien gibt, mich um Unterstützung für meine Männer in St. Elmo bittet?« Wieder dieser kritische Blick aus den dunklen Augen.
Miranda schluckte.
»Lasst Euch versichern, ich bin mir der Lage in St. Elmo bewusst. Wir sollten über die Hilfe aus Sizilien sprechen. Wir beide wissen, dass ich, wenn ich die acht Galeeren nach Sizilien schicken würde, ich pro Galeere mindestens hundert Mann Besatzung mitschicken müsste. Männer, die ich nicht entbehren kann. Wir haben noch nicht einmal zehntausend kampfbereite Männer. Das Heer von Soliman hat, soweit wir das bisher abschätzen können, mehr als viermal soviel. Dennoch glaube ich, wenn der Vizekönig uns 15.000 Mann Verstärkung schicken könnte, dass wir Malta und Europa verteidigen könnten.« Miranda schaute ihn an. War das realistisch? Wie schnell, dachte denn der Großmeister, würde Don García seine Truppen, wenn er das überhaupt täte, in Bewegung setzen?
De la Valette fuhr fort, als hätte er Mirandas Gedanken gelesen: »Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass er diese nicht so schnell in Gang setzen kann. Er soll fünfhundert Mann vorab schicken, dann können wir vielleicht St. Elmo halten. Aber wenn wir diese Männer nicht bis zum 20. Juni hier haben, wird St. Elmo fallen.«
Miranda nickte. Er konnte sich zwar kaum vorstellen, dass eine Verstärkung von 15.000 Mann gegen diese Übermacht reichen würde. Aber wenn jemand es schaffen konnte, dann De La Valette. Da war er sich sicher.
»Und zu Eurer Beruhigung Chevalier, ich werde heute Nacht noch weitere hundert Mann Verstärkung mit einigen meiner besten Ritter nach St. Elmo schicken.«
Wieder stieg Miranda der Geruch der Feuer und der verbrannten Toten in die Nase. Ohne weiter zu überlegen, sagte er: »Bitte Eure Eminenz, erweist mir die Ehre und lasst mich mit Euren Männern in St. Elmo kämpfen.«
23.08.2012 – 19:44 St. George's Bay
Pauline saß mit ihrer Mutter draußen auf dem Pier und schaute in die Bucht.
Sie hatten sich die Bar direkt neben dem kleinen Souvenir Shop ausgesucht, um bei einem abendlichen Cider die Stimmung zu genießen und den ersten Abend auf Malta gemütlich ausklingen zu lassen. Die Bar befand sich in einem der älteren Häuser an der Xatt Ta' San Gorg und bot einen schönen Blick über die kleine Bucht mit den leise in den Wellen schaukelnden Schiffen.
Eine Straße trennte die Bar vom Strand, der gerade von den Spuren des Tages gesäubert wurde. Hier in der Bucht gab es noch die alten Häuser, aber wenn man weiter entlang in Richtung Paceville ging, war alles gesäumt von Neubauten. Der morbide Charme Maltas, den man noch in diesem Teil der Bucht verspürte, würde auf die Dauer wohl weichen müssen. Schade, dachte Pauline. Malta war sonst, da neben Maltesisch auch Englisch gesprochen wurde, ein ideales Reiseland für sie. Die Verständigung war hier viel einfacher, als etwa in den Bergregionen von Madeira. Ohne Portugiesisch kam man dort nicht weit, wenn man sich mit den Bauern austauschen wollte.
Jetzt war nicht die Zeit, darüber nachzudenken, beschloss sie. Lieber genoss sie ihren eisgekühlten Cider. Sie griff nach dem großen Glas mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit und nahm einen tiefen Schluck. Dann widmete sie sich wieder dem Treiben auf dem Pier und am Strand gegenüber.
Pauline hatte gelesen, dass der Gemeinderat vor einigen Jahren diesen Strand künstlich hatte anlegen lassen, um den Touristen die Möglichkeit zu geben, einfach ins Meer zu gelangen. Dafür war das Gestein weggesprengt und Sand importiert und aufgeschüttet worden. Die Gemeinde nutzte den Strandabschnitt jetzt auch für Rettungsschwimmertrainings und für die Demonstration der guten Müllentsorgung.
Die Plätze vor der Bar waren heiß begehrt, daher teilten Pauline und ihre Mutter sich den Tisch mit einem englischen Ehepaar. Er war rotblond und hatte heute eindeutig zuviel Sonne bekommen. Seine Haut hatte fast die Farbe seiner Haare. Aber das schien ihm seine Laune nicht zu verderben. Er trank ein Guinness nach dem anderen und unterhielt sich angeregt mit seiner Frau. Scheinbar kamen sie öfter hier her, denn der Besitzer der Bar war jetzt schon mehrfach an ihrem Tisch gewesen und hatte sich mit den beiden unterhalten. Jetzt stand er direkt neben Pauline und hatte dem Engländer in einer vertrauten Geste die Hand auf den Rücken gelegt. Dem leicht verzehrten Gesichtsausdruck des Briten entnahm Pauline, dass sich auch unter dem bunten T-Shirt ein heftiger Sonnenbrand verbarg. Aber er war zu höflich, um den anderen darauf hinzuweisen.
Auf den ersten Blick war Pauline der Barbesitzer unsympathisch. Längere, ungepflegte Haare, dazu eine große Sonnenbrille, sodass man seine Augen nicht sehen konnte. Im Mund hatte er eine Zigarette und schwang ein Glas Wein in seiner Hand. Auf Pauline wirkte es fast so, als hielte er Hof und erwartete, dass seine Gäste ihm huldigten. An Selbstbewusstsein schien es ihm wirklich nicht zu mangeln, auch wenn er, nach Paulines Meinung, wirklich keine besonders ansprechende Erscheinung war. Sein Hemd wölbte sich deutlich über einen schon recht stattlichen Bauch, dafür waren die Beine, die aus seinen Bermudas hervorschauten, um so dünner. Sie hoffte nur, dass der Typ sie nicht auch in ein Gespräch verwickeln würde. Endlich verschwand der Barbesitzer von ihrem Tisch, nachdem ein neues Paar angekommen war, welches er lauthals begrüßte.
Die Engländerin lächelte Pauline zu, sie hatte bemerkt, dass Pauline das Geschehen recht genau beobachtet hatte.
»Wir kommen oft hierher und kennen Guiseppe schon lange. Ich weiß, er hat schon Charakter.« Das war aus Paulines Sicht eine sehr euphemistische Beschreibung.
»Ist er der Eigentümer der Bar?«
»Ist er. Schon über 30 Jahre. Guiseppe besitzt ein paar Lokale hier in der Gegend. Oben in Paceville hat er noch eine Bar, die muss aber renoviert werden. Es gab einen, ähh, sagen wir kleinen Unfall. Aber wir mögen es hier lieber, weil man im alten Teil von St. Julians sitzt, wo noch nicht die jungen Leute, die Party machen wollen, auftauchen. Dafür sind mein Mann und ich dann doch zu alt.« Sie lachte.
»Ich weiß was Sie meinen. Wenn ich sehe, wie jung die Partygänger hier sind, kommt man sich furchtbar alt vor. Wir sind auch froh, dass unser Hotel etwas abseits liegt.«
»Waren Sie schon einmal hier?«
»Ja, vor vielen Jahren eine Woche im Sprachurlaub. Aber damals gab es wenig Gelegenheit, um sich die Insel anzusehen. Dazu ist diesmal hoffentlich mehr Zeit. Ich verbinde quasi zwei Urlaube miteinander: Eine Woche mit meiner Mutter im Hotel und ab nächster Woche zwei Wochen mit meinem Mann in einem Appartement von Freunden in Sliema.«
»Das klingt nett. Dann bekommen Sie auch gleich zwei ganz unterschiedliche Eindrücke von der Insel. Es ist doch ein großer Unterschied, ob man als Tourist in einem Hotel lebt, oder unter Einheimischen.«
»Ja, ich freue mich auch schon sehr. Jetzt heißt es sich verwöhnen lassen und den Urlaub mit meiner Mutter genießen. Wir wollen den Wellness- und Kosmetikbereich des Hotels ausgiebig nutzen und einkaufen gehen. Alles Dinge, für die mein Mann nicht soviel Verständnis hat.« Die Engländerin nickte, mit einem Seitenblick auf ihre Rothaut neben sich.
»Ich glaube, da sind alle Männer gleich. Ich kann ihn hier noch nicht einmal dazu bringen, Sonnencreme zu benutzen. Und das Ergebnis sehen Sie ja.« Liebevoll tätschelte sie den Arm ihres Mannes an einer der wenigen nicht roten Stellen. Er sah kurz von seinem Guinness auf und lächelte sie an. Er hatte eindeutig das Gespräch der Frauen nicht verfolgt. Wie Ben, dachte Pauline. Der hätte bei dem Thema Wellness und Kosmetik auch gleich abgeschaltet.
Pauline wendete sich an ihre Mutter.
»Mum, was meinst du, kann ich dich kurz alleine lassen?« Paulines Mutter nickte nur, versunken in die Eindrücke der kleinen Bucht.
Pauline ging in die Bar und fragte die dunkelhaarige Serviererin nach den Toiletten.
»Einfach rechts den Gang entlang, dann sehen Sie sie schon. Aber erschrecken Sie sich nicht.« Sie zwinkerte Pauline zu.
Erschrecken? Waren die Toiletten in so einem furchtbaren Zustand? Pauline schaute sich nochmals in der Bar um. O.k., es war nicht super modern, aber gemütlich und sauber. Pauline ging den Gang herunter.
Und dann sah sie, was die Kellnerin gemeint hatte. Sie zuckte unwillkürlich zusammen, musste aber näher gehen und es sich genauer ansehen. Die Wände waren voll von großen Fotos. Diese glichen aber mehr Gemälden, so kunstvoll wurde mit Licht und Schatten gespielt. Das verstörende daran aber waren die Motive. Es waren mittelalterliche Motive, soviel meinte Pauline sehen zu können. Sie zeigten Menschen in alten Kostümen, schwarzen Roben mit weißen Kreuzen oder weißen Gewänder mit Turbanen. Und überall war Blut. Es waren ausschließlich Tote, die dargestellt waren. Grässlich zugerichtet und dann vor historischen Gebäuden oder Landschaften in Szene gesetzt. Pauline wusste, dass die Malteser gerne ihre Geschichte nachspielten, vor allem die Zeit des Great Siege. Die Belagerung durch die Osmanen im 16. Jahrhundert und schließlich der Sieg. Dieser Sieg hatte den Großmeister De la Valette zum Helden für die Ewigkeit gemacht. Und die Hauptstadt von Malta trug jetzt seinen Namen.
Aber trotzdem, Stolz hin oder her. Wer hängte denn solche Fotos in seiner Bar auf? Das war abstoßend. Ob dieser Guiseppe der Fotograf war? Pauline ging noch näher und versuchte eine Signatur zu erkennen. Nichts. So oder so mussten dem Barbesitzer diese Bilder etwas bedeuten, sonst würde er sie nicht aufhängen. Wirklich ekelerregend. Sie sollten sich wohl für die Zukunft eine andere Bar für den abendlichen Cider suchen. Dieser Barbesitzer war irgendwie unheimlich. Sie ging schnell weiter. Erleichtert stellte Pauline fest, dass die Toiletten sauber und fotofrei waren.
Als sie zurück kam, waren die Engländer gerade dabei zu gehen. Schade, sie hätte die beiden gerne noch nach den Bildern gefragt. Frauke meinte, es sei jetzt wohl auch Zeit langsam ins Hotel zu gehen, schließlich hatten sie ja einen anstrengenden Anreisetag hinter sich. Pauline stimmte mit Blick auf das angespannte Gesicht ihrer Mutter zu. Sie wusste, dass die Reise für ihre Mutter zwar eine große Freude war, aber diese dennoch so einen Tag nicht mehr so einfach wegsteckte wie Pauline. Daher war es umso wichtiger, dass sie den Urlaub ruhig angingen.
Für übermorgen hatten sie allerdings schon einen ersten Ausflug nach Marsaxlokk gebucht, einen kleinen Ort im Süden. Dort war am Samstag Markttag, und nach den Fotos zu urteilen, würde es sehr malerisch werden.
Als sie zum Hotel gingen, war es zwar dunkel, aber immer noch richtig warm. Pauline schätzte, dass es bestimmt immer noch um die 25 Grad waren. Mitleidig schaute Pauline auf einen Husky, der ihnen entgegen kam. Wie konnte man auf so einer Insel einen Schlittenhund halten. Strafend blickte sie das Herrchen dazu an. Ein älterer Typ, längere graue nach hinten gekämmte Haare, Bauchansatz. Er trug sein weißes Hemd leicht offen, was den Anblick nicht gerade verschönerte. Dennoch strahlte er eine Arroganz und ein Selbstbewusstsein aus, dass Pauline davon absah, ihm die Meinung zu sagen. Bei so einem Menschen würden Gedanken über Tierquälerei sicher abprallen.
17.06.1565 – Nachmittags St. Elmo
Miranda war erschöpft. Fast zwei Wochen war er jetzt schon in St. Elmo. Er blickte hinunter in den Wallgraben, der mit toten Körpern gefüllt war. Die letzten Tage im Fort waren schrecklich gewesen. Und selbst er, der in so vielen Kriegen für die spanische Krone gekämpft hatte, hatte so etwas noch nicht erlebt.
Die Osmanen hatten angefangen, die Belagerten in der Nacht anzugreifen. Bisher war die Nacht ihr einziger Ruhepol gewesen. Der Moment, in dem die Waffen schwiegen, sie ihre Wunden verarzten und ihre Toten verbrennen konnten. Und vielleicht sogar ein paar Stunden Schlaf finden konnten.
Während der ganzen letzten Nacht hatten die feindlichen Truppen sie mit Geschrei und Kriegsgesängen wach gehalten, die von den Nachbarhügeln ins Fort schallten. Am Morgen wurden sie Zeuge, wie die religiösen Anführer die Gegner mit Gebeten auf die Kämpfe einstimmten. Dann brach die Hölle los, als ob sämtliche Kräfte der Osmanen durch die Nacht mobilisiert worden waren. Ein tosendes Meer der Gewalt übergoss St. Elmo. Begleitet von schlagenden Trommeln und durchdringenden Tönen anderer Instrumente stürmte ein schier unendliches Heer über den Hügel heran und ließ selbst Miranda das Blut in den Adern gefrieren.
De Guerras hatte wieder die Order gegeben, Griechische Feuer und andere Feuerwaffen einzusetzen. Auch die Osmanen benutzten mittlerweile Brandwaffen. Riesige Feuerbälle waren in das Fort geschossen worden. Die furchtbare Hitze der Feuer drohte die Ritter bei lebendigem Leib in der Rüstung zu braten. De Guerras hatte schnell reagiert und angeordnet, große Fässer mit Meerwasser zu füllen, um die Feuer zu löschen. Aber jetzt hallten die Schreie derjenigen, deren offene Wunden mit dem Salzwasser in Berührung kamen, durch das Fort. Miranda sah, wie viele seiner Mitstreiter der Mut verließ, als sie auf ihre verbrannten Kameraden blickten. Der aufkommende Wind aus dem Westen trieb Miranda den Rauch in die Augen, sodass er kaum etwas sehen konnte. Krampfhaft versuchte er zu erkennen, wohin er zielen musste, damit er nicht am Ende noch einen Gefährten traf.
Nur undeutlich sah er, wie Captain Medrano neben ihm versuchte einem der anstürmenden Angreifer die osmanische Flagge zu entreißen. Der Janitschar feuerte eine Gewehrsalve aus nächster Nähe direkt in die Brust des Captains. Dessen Brustpanzer zersprang und er fiel. Miranda hatte ihn als einen der tapfersten und stärksten Kämpfer in den letzten Tagen erlebt. Was für ein Verlust für das Fort. Geschockt blickte Miranda in die toten braunen Augen des Captains und hielt kurz inne. Da spürte er einen dumpfen Schlag und als er an sich herunter blickte, sah er, wie Blut aus seiner Hüfte floss. Es war ein perfekter Schuss gewesen, genau unterhalb der Stelle, wo der Oberkörper nicht mehr durch die starre Rüstung geschützt war. Der Janitschar, der mit seiner Hakenbüchse vor ihm stand, fiel mit einem Schlag von seinem Schwert. Dann setzte der Schmerz ein. Miranda wusste, wenn die Männer sehen würden, dass er sich jetzt zurückziehen würde, wäre das fatal für die Kampfmoral. Kurz dachte er an zu Hause, an seine Frau und die Kinder. Seine Frau würde wollen, dass er sich nach Birgu bringen ließe, damit im Hospital seine Wunden versorgt würden. Er erinnerte sich an ihren Blick, als er verkündete, dass er von Don García nach Malta geschickt wurde, um die spanischen Interessen zu vertreten. Sie kannte ihn gut, sie wusste, dass er kein Diplomat, sondern ein Kämpfer war. Er hatte noch im Großmeisterpalast eine Depesche an sie verfasst und seinen Siegelring mit Wappen, welches ein Elefant zierte, beigelegt. Dieser sollte nicht dem Feind in die Hände fallen. Sein ältester Sohn sollte ihn einmal mit Stolz tragen. Miranda merkte das leichte Ziehen im Magen, als er daran dachte, wie sie den Brief erhalten würde. Sie war eine kluge Frau. Sie würde wissen, dass sie ihn nicht wieder sehen würde. Hätte er sich mehr Zeit nehmen müssen, um sich von ihr und den Kindern zu verabschieden? War das wirklich alles so vorbestimmt gewesen? De La Valette hatte ihn gebeten, als Kommandant nach St. Elmo zu gehen, als er die Bitte des Spaniers vernahm. Miranda hatte, auch aus Rücksicht auf De Guerras, den alten Kommandanten, die Bitte abgelehnt. Wie hätte der sich gefühlt, wenn De La Valette einen neuen Kommandanten geschickt hätte? Der dazu noch nicht einmal zum Orden der Johanniter gehörte? So hatte Miranda den alten Großmeister gebeten, ihm als einfacher Soldat zu dienen. Und dieser Wunsch war im gewährt worden.
Er blickte sich um. Sah seine Kameraden im Kampf mit den rußverschmierten Gesichtern. Blut, ihr eigenes oder das der Gegner, tropfte von ihrer Kleidung. Sollte er sie alleine lassen und zurück nach Birgu gehen? Vielleicht mit der Chance, seine Frau wieder zu sehen? Nein, niemals. Das war er nicht. Er käme sich wie ein Feigling vor. Sein Sohn sollte stolz auf den Vater sein. Er rief einen der jungen Knappen zu sich und bat ihn, einen Stuhl zu holen. Große erstaunte Augen blickten ihn an, aber der Junge zog ab und kam wenig später mit einem Eichenstuhl aus dem Speisesaal zurück.
»Bring den Stuhl da hinauf und hilf mir hoch.« Er deutete in Richtung der Festungsmauer. »Dann hol einen Riemen und schnalle mich fest.« Miranda wusste, dass er nicht mehr die Energie hatte, sich lange aus eigener Kraft auf dem Stuhl zu halten. »Bring noch Verbandszeug und versuch die Wunde abzubinden.« Der Knabe sah ihn verzweifelt an, tat dann aber, wie ihm geheißen.
Dort saß Miranda nun, auf der Mauer, fast erstarrt bei dem Anblick, der sich ihm bot. Die Mauer zur Landseite, auf der er mit einigen der Kanoniers ausharrte, war durch den Ansturm von Mustafas Landbatterien teilweise geborsten. Viele der Ritter, die sich noch auf den Beinen halten konnten, standen jetzt mit spanischen und maltesischen Soldaten in dieser Bresche und eröffneten das Feuer gegen die Heranstürmenden. Wie gerne würde er an ihrer Seite stehen. Aber das ging jetzt nicht mehr. Verbissen zielte er mit der Hakenbüchse des getöteten Janitscharen auf die Osmanen. Seine Wut über die Verwundung siegte über die Zweifel der letzten Tage.
Ja, er hatte die letzten Tage gezweifelt. An diesem Kampf, an der Rolle, die die Johanniter in dem Krieg spielten. Sie hatten einige Gefangene gemacht, die jetzt in dem Verlies von St. Elmo warteten. Darunter einen älteren Janitscharen, dessen Vorfahren spanische Kriegsgefangene der Türken gewesen waren. Der spanischen Sprache mächtig, hatte er die Gelegenheit genutzt, sich mit Miranda zu unterhalten, als dieser bei einem Rundgang die Verliese besuchte. Es war ein ruhiges Gespräch gewesen, ohne Emotionen. Der Janitschar war sich bewusst, dass er in den nächsten Tagen sterben würde. Entweder durch die Hand seiner Gegner, oder, was wahrscheinlicher war, durch die Kanonen seiner Kameraden.
»Wisst Ihr, Chevalier, warum mein Sultan diesen Krieg führt?«, hatte er gefragt.
»Ich weiß, dass Ihr denkt, es wäre um ein Tor nach Europa zu haben. Sicher, ich will nicht abstreiten, dass der prächtige Soliman sein geheiligtes Land vergrößern möchte und die Ungläubigen bekehren. Aber ist es nicht auch das, was die Kreuzritter auf ihren Kreuzzügen taten? Ungläubige bekehren? Und zu welchem Preis? Unser Kommandant Mustafa Pascha hat die Johanniter von Rhodos vertrieben. Und als sie hier ankamen, fingen sie an mit ihren Kriegsgaleeren unsere Handelsschiffe, die von Solimans Besitzungen in Nordafrika in Richtung der griechischen Inseln fuhren, zu plündern. Wusstet Ihr das?«
Miranda konnte nicht leugnen, dass er von den Beutezügen der Ritter gehört hatte. In Europa war es geduldet worden, da sie die Handelsschiffe der Türken und nicht die der europäischen Partner angriffen. Aber letztendlich waren sie kaum etwas anderes als Piraten.
»Vor einigen Monaten haben sie die Handelsgaleere seines Obereunuchen, des großen Wächters seines Serails, versenkt. Eine seiner Lieblingstöchter ist dabei ums Leben gekommen. Wenn Soliman der Prächtige dies hätte ungesühnt geschehen lassen, was für ein Herrscher wäre er dann? Würde Euer spanischer König so etwas zulassen? Sind wir denn so verschieden?«
Miranda hatte nicht geantwortet. Nach diesem Gespräch hatte er aber immer wieder über die Worte des Janitschar nachgedacht. Es war wohl wirklich nur eine Frage der Perspektive, wer in diesem Kampf der Schuldige war. Was würden die Geschichtsbücher daraus machen?
Miranda merkte, wie neben ihm die Kugeln einschlugen. Er musste sich zwingen, nicht in Gedanken abzuschweifen. Jede Unaufmerksamkeit könnte jetzt sein Ende bedeuten. Er blickte hinunter in Richtung der Hügel, auf denen die Truppen von Mustafa Pascha standen.
Im Wechsel schickte dieser nun Derwische, die sich nicht um ihr eigenes Leben scherten, und Janitscharen in fürchterlichen weißen Wellen voran um die Bresche in der Mauer zu erweitern. Aber die Ritter standen. Von oben fielen mit Griechischem Feuer getränkte brennende Räder auf die Anstürmenden herab, die fürchterliche Schneisen in die Krieger schnitten. Es war entsetzlich. Miranda fragte sich, wann Mustafa aufhören würde, Menschen zu opfern. Über den großen Hafen donnerten die Geschütze von St. Angelo. De la Valette versuchte St. Elmo aus der Ferne zu unterstützen. Seine Geschosse rissen große schwarze Löcher in das weiße Feld der Janitscharen. Wann war es endlich vorbei? Mirandas Blick verdunkelte sich, er merkte, wie der Blutverlust ihn schwächte. Dann war sie da, die Nacht. Diesmal entschieden sich auch die Osmanen für Ruhe. Das Tosen der Feuer hörte auf. Jetzt würden beide Seiten ihre Toten zählen können. Es waren wieder zu viele.
Miranda sah im Geiste, wie die Boote von Birgu im Schutz der Nacht hinüberglitten, um die Toten und Verwundeten aus dem Fort zu holen. Er wusste, dass De la Valette ihn zurück nach Birgu beordern würde, sobald er von der Verwundung erfuhr. Aber Miranda hatte seinen Entschluss gefasst. St. Elmo würde sein Grab werden. Niemand würde ihn lebend aus der Festung bringen können.
Entkräftet ließ Miranda die Büchse sinken.
24.08.2012 – 06:17 St. George's Bay
Der Wecker klingelte. Pauline hatte sich vorgenommen gleich morgens laufen zu gehen. Sie wollte diesmal ihre guten Vorsätze für den Urlaub direkt in die Tat umsetzen.
Ihre Mutter drehte sich noch einmal im Bett um, und Pauline zog sich leise ihre Laufsachen an.
Um zu dem kleinen Fitnessstudio im unteren Teil des Hotels zu gelangen, war es der kürzeste Weg, einen Schlenker durch den Frühstücksraum zu machen. Morgens um sechs war das Buffet noch nicht eröffnet, aber aus der Küche drang schon der Geruch von frisch gebackenem Brot, und das Personal fing langsam an, die verschiedenen Köstlichkeiten aufzuladen. Paulines Magen meldete sich hörbar, aber tapfer ging sie weiter den kleinen Gang entlang vorbei an der Kosmetik – hier musste sie unbedingt noch mit ihrer Mutter das ein oder andere ausprobieren – in Richtung Fitnessstudio.
Als sie das Studio durch die Glastür betrat, schlug ihr schon eine muffige, von Schweiß angereicherte Luft entgegen. Wie konnte das sein, es war doch erst sechs Uhr morgens. Warum war es hier so voll? Alle drei Laufbänder waren besetzt. Und als Pauline näher trat und sah, was für Pfützen die drei Herren, die sich dort austobten, auf dem Band und der Armatur hinterließen, verging ihr auch die Lust zu warten, bis ein Laufband frei würde. Sollte sie wieder zurück ins Zimmer gehen? Nein, das käme ja einer Kapitulation gleich. Und sicher würde Ben sie heute Nachmittag bei ihrem Skype Call fragen, ob sie, wie sie so vollmundig am Tag vorher angekündigt hatte, auch laufen gewesen war. Sollte sie ihn anflunkern? Nein, spätestens die Urlaubspfunde würden sie zu Hause verraten. Die einzige Alternative war, draußen zu laufen. Links aus dem Hotel raus, runter Richtung St. George's Bay, vorbei an den kleinen Bars, die sich mit dem Blick auf die Bucht aufreihten, und sich dann langsam Richtung Promenade von Sliema durchschlagen. Sie hatte keine Ahnung, wie weit das in Kilometern war, aber wenn sie merkte, dass sie genug hatte, konnte sie einfach umdrehen.
Der Anfang war locker. Pauline freute sich, dass sie ihre neuen Laufschuhe mitgenommen hatte, und genoss es, dass noch nicht so viele Autos unterwegs waren. Die Luft war frisch. Natürlich war es kein Vergleich zu den Läufen oben auf der Levada auf Madeira. Dort waren Ben und sie mitten in der Natur gelaufen, hier war ihre Umgebung von Menschen gemacht. Aber halt, sie durfte nicht ungerecht sein, es hatte auch etwas Gutes: Hier war sie unter Menschen. Wenn sie an ihre Erlebnisse auf Madeira zurück dachte, bekam sie eine Gänsehaut. Daran wollte sie lieber doch nicht denken.
Sie lief an der Bar vorbei, in der sie mit ihrer Mutter gestern noch den Cider in Gesellschaft von dem englischen Ehepaar getrunken hatte. Zum Glück war um diese Zeit die Bar noch geschlossen, und von dem komischen Guiseppe war nichts zu sehen. Beim Gedanken an die scheußlichen Fotos lief Pauline ein kalter Schauer über den Rücken. Der Typ und sein Hobby waren wirklich unheimlich.
Langsam trabte Pauline die Straße hinunter und ließ dabei das Flair der neuen Umgebung auf sich wirken. Diese erschien erstaunlich britisch. Überall hingen Reklametafeln von bekannten Cidermarken, schottischem Whisky und anderen Produkten von der Insel im Norden. Von einem englischen Kollegen wusste sie, dass Malta auch heute noch von vielen Briten als Möglichkeit genutzt wurde, Geld mit sehr günstigen steuerlichen Bedingungen anzulegen, wie er sich ausgedrückt hatte. Das war wohl wieder einer der typisch britischen Euphemismen, aber Pauline hatte auch lieber nicht nachgefragt.
Als sie die Abkürzung über die Stufen hoch durch die Partymeile von St. Julians nahm, kam sie an einem Absperrband der Polizei vorbei. Von dem Concierge ihres Hotels hatte sie gehört, dass es vor ein paar Wochen einen Brand gegeben hatte. Und als die Feuerwehr nach dem Löschen anfing den Schutt aus der Bar zu räumen, hatten sie einen Toten gefunden. Keiner hatte sich erklären können, warum der junge Mann in der Bar gewesen war. Dem Eigentümer gehörten mehrere Bars hier vor Ort, und er hatte versichert, dass er seine Bar abends geschlossen hatte und wusste, dass niemand mehr da gewesen war. In der Presse wurde spekuliert, dass der junge Mann der Brandstifter war und auf tragische Weise bei dem Anschlag selbst ums Leben gekommen war. Pauline überlegte, ob das die wegen Renovierung geschlossene Bar von Guiseppe gewesen war? Nein, das wäre schon ein komischer Zufall. Und hätte die Engländerin dann nicht erwähnt, dass jemand bei dem kleinen Unfall, wie sie es genannt hatte, ums Leben gekommen war?
Pauline schüttelte den Kopf. Wieso beschäftigte sie sich wieder mit solchen Mördergeschichten? Sie sollte lieber Malta genießen und den Tag morgen in Marsaxlokk planen. Heute wollten ihre Mutter und sie einen ruhigen Tag am Pool verbringen. Das würde ihrer Mutter bestimmt auch helfen, sich ein bisschen an die Hitze zu gewöhnen.
Jetzt war Pauline an der Spinola Bay angekommen. Das Licht war wunderschön, und die bunten Boote, die in dem kleinen Hafen lagen, wurden in das morgendliche Zwielicht getaucht. Da übersah man auch leicht die Verunreinigungen aus Plastikmüll, die Pauline gestern schon bei der Taxifahrt aufgefallen waren.
Dort vorne hatten die Veranstalter für die Touristen eine Möglichkeit zum Bungee Jumpen aufgebaut. Allerdings sprang man nicht von einem Turm herunter, sondern wurde durch die Konstruktion nach oben und dann wieder nach unten geschleudert. Also konnte man es wohl eher eine Bungee Schleuder bezeichnen. Pauline wusste mit Sicherheit, dass sie das nicht ausprobieren würde. Irgendwo in der Nähe bellte ein Hund.
Ihr Blick ging hinüber zum Wasser. Es hatten bereits die Aufbauten für das Fest von St. Julians begonnen. Übermorgen Abend, am letzten Sonntag im August, war der Höhepunkt. Dann würden die jungen Männer des Ortes versuchen, einen etwa 10 Meter langen Pfahl, der in einem Winkel von etwa 45 Grad am äußersten Zipfel der Bucht angebracht war und über das Wasser herausragte, entlang zu klettern. Ihre Aufgabe war es, eine oder gar zwei der Flaggen, die am Ende angebracht wurden, abzunehmen. Da der Pfahl aber mit Seife eingerieben war, endete das ganze meistens mit einem Bad, sehr zum Vergnügen der Zuschauer. Das alles hatte ihnen das maltesische Ehepaar erzählt, das sie gestern Nachmittag am Pool des Hotels kennengelernt hatten. Sie meinten, das solle man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, es wäre eine Tradition seit dem Mittelalter, also nichts, was extra für die Touristen entwickelt worden war. Pauline konnte sehen, dass der lange Pfahl für das Gostra, wie die Einheimischen es nannten, bereits über der Bucht angebracht worden war. Neugierig schaute sie empor, waren vielleicht schon die Flaggen angebracht? Nein, da waren keine Flaggen, aber an der Spitze des Pfahles war etwas anderes. Pauline lief über die Straße, um einen besseren Blick erhaschen zu können.
Was war das?
Sie stolperte über den Bordstein. Oh Gott, das konnte doch nicht sein. Glasige Augen starrten sie an. Die Haut war gräulich, und der Körper fehlte. Jemand hatte einen Kopf am Ende des Gostras aufgespießt. Sollte das ein schlechter Scherz sein, eine Requisite von diesen mittelalterlichen Kostümspielen? Nein, das hier war echt. Kein Spiel. Pauline hielt den Atem an, als sie den Verwesungsgeruch wahrnahm, der von dem Kopf ausging. Wieso musste sie das finden und nicht jemand anders? Und diesmal war kein Ben da, der jetzt alles in die Hand nahm. Sie versuchte sich zu beruhigen, ihr Herz raste, und das Blut rauschte in ihren Ohren. Sie schaute sich um, war niemand in der Nähe? Da sah sie einige Meter weiter zwei Läufer auf sich zu kommen, die auch den kühlen Morgen für einen Lauf nutzten. Sie winkte ihnen zu und rief um Hilfe. Die beiden jungen Männer, dem Äußeren des einen – rote Haare und Sommersprossen mit einem schon jetzt ausgeprägten Sonnenbrand – nach wahrscheinlich wieder Engländer, blieben stehen. Nach kurzem Zögern kamen sie wohl zu dem Schluss, dass Pauline wirklich Hilfe benötigte. Sie liefen auf sie zu. Pauline deutete auf den Pfahl und jetzt sahen die beiden auch, was Pauline gesehen hatte. Der Rothaarige kramte sein Handy heraus, aber anstatt zu telefonieren, machte er erst einmal ein paar Fotos. Pauline war sprachlos. Was für ein Idiot. Mit einer Stimme, die vor unterdrückter Wut zitterte, raunzte sie ihn an:
»Was machen Sie da? Wenn Sie nicht sofort die Polizei rufen, sorge ich dafür, dass Sie wegen Behinderung der Justiz eine Anklage bekommen.« Als sie das sagte, merkte sie gleich, wie dämlich das klang. Aber es war das erste, was ihr eingefallen war.
Der junge Mann schaute sie entsetzt an, fragte dann aber, welche Nummer er denn wohl für die örtliche Polizei wählen musste.
»Sehen Sie hier, dort stehen Sicherheitsvorschriften für die Badegäste.« Pauline deutete auf eine Tafel mit Anweisungen in Englisch. »Und dort ist auch eine Notrufnummer. Ich denke, wir sollten die wählen. Zur Not können die uns weiter verbinden.« Sie selber war erstaunt, wie selbstsicher und ruhig sie klang. In Bens Gegenwart hätte sie sich wahrscheinlich erlaubt, panisch zu werden, aber da er nicht da war, musste sie sich jetzt zusammenreißen.
Der zweite junge Mann war sichtlich beeindruckt von Paulines Vorgehen und drängte seinen Freund, doch Pauline das Telefon für den Notruf zu überlassen.
Pauline wählte die Nummer. Zum Glück nahm fast sofort jemand ab.
»Hallo, mein Name ist Pauline Boysen und ich möchte den Fund eines abgetrennten Kopfes in der Spinola Bucht in St. Julians melden.«
Am anderen Ende der Leitung wurde es still. Jemand räusperte sich.
»Habe ich Sie richtig verstanden, Sie haben einen abgetrennten Kopf gefunden?«
»Ja, auf dem Gostramast in der Spinola Bucht.«
»Moment, bleiben Sie bitte am Apparat.« Scheinbar gab es für diese Art von Fund kein Standardvorgehen. Pauline konnte hören, wie ihr Gesprächspartner mit anderen Personen im Raum laut auf Maltesisch zu diskutieren anfing.
Kurze Zeit später hörte sie eine andere Stimme in der Leitung.
»Mrs. Boysen, bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Die Polizei und ein Krankenwagen sind unterwegs. Sind Sie alleine?«
Pauline versicherte der Stimme, dass sie nicht alleine sei, mit einem Seitenblick auf die zwei jungen Männer, die mit großen Augen jedes Wort verfolgten. Sie zweifelte zwar daran, dass die zwei sie ernsthaft beschützen konnten, falls der Täter zurückkehrte, aber hoffentlich würde die Anzahl von drei Personen ihn schon abschrecken. Die zwei wirkten im Moment eher wie zwei junge Hunde, die von Frauchen ein Leckerli erwarteten. Aber was sollte es, sie war nicht allein, und zumindest der eine von den beiden machte einen einigermaßen intelligenten Eindruck.
Kurze Zeit später konnten sie Sirenen hören. Dann sahen sie auch schon, wie sich über die Promenade, die in Richtung Sliema ging, mehrere Streifenwagen und ein Rettungswagen näherten.
Pauline schaute noch einmal hoch zu dem Kopf. Sie zwang sich, genau hinzusehen. Dunkle lockige Haare und ein Gesicht, das wahrscheinlich im Leben ausgesprochen schön gewesen war, aber jetzt durch den Tod und die einsetzende Verwesung zunehmend entstellt wurde. Und dazu diese leuchtend blauen Augen.
23.06.1565 – Früh am Morgen St. Elmo
Miranda bereitete sich auf das unausweichliche Ende vor. Sein Körper war eine einzige klaffende Wunde. Der Knappe hatte tapfer versucht, jede neue Wunde zu verbinden, aber der Blutverlust war so groß, dass selbst die Hakenbüchse mittlerweile zu schwer zu halten war. Er musste sie auf die Mauer legen, mit der linken Hand den Hahn durchziehen und dann abdrücken. Die rechte Hand hing, Sehnen und Muskeln von Granatsplittern zerfetzt, nutzlos an ihm herab. Das Laden der Büchse übernahm der Knappe für ihn, mit einer Hand war das auch nicht mehr möglich. Selbst wenn ein Wunder geschähe und noch Verstärkung aus Sizilien käme, für St. Elmo und ihn war es zu spät. Schon vor vier Tagen war ihm klar geworden, dass nichts und niemand mehr St. Elmo würde retten können. Er hatte noch eine kurze Depesche an den Großmeister verfasst, um ihm die Lage zu verdeutlichen. Eine Antwort hatte er nicht mehr erhalten.
Alles hatte mit der Ankunft des Korsaren Dragut begonnen, der mit 13 Galeeren und zwei Galeonen auf Geheiß des Sultans die Osmanische Flotte verstärkte. Als Späher seine Ankunft vor Malta meldeten, breitete sich Unruhe in St. Elmo aus. Miranda hörte die alten Ritter klagen, dass der Kampf nun entschieden sei, da einer ihrer stärksten und schlauesten Widersacher jetzt ins Geschehen eingreifen würde. Dragut hatte es vom Piraten zum Admiral in der Osmanischen Flotte geschafft und hatte mehr als einmal den Johannitern empfindliche Niederlagen bereitet.
Der Name Dragut bereitete aber nicht nur den Rittern Sorge. Unter der Bevölkerung Maltas war sein Name gleichbedeutend mit Tod. Miranda hatte gesehen, wie bei den maltesischen Soldaten im Fort die Ankunft des Korsaren Schrecken verbreitete. Zu nah war für sie die Zeit vor fünfzehn Jahren, als Dragut Malta verwüstet und Gozo versklavt hatte. Sie alle hatten Angehörige und Freunde in der Zeit verloren und hatten nun Angst, dass das Schicksal von Gozo ganz Malta treffen würde.
Seit dem 21. Mai hatten sie den Angriffen der Türken stand gehalten. Dass St. Elmo noch nicht gefallen war, glich einem Wunder. Nachts hatte es De la Valette immer wieder geschafft, dem Fort Nachschub zu beschaffen. Nur so hatten sie so lange Widerstand leisten können.
Miranda schaute hinüber zum Großen Hafen. Dort stand das Bauwerk, welches ihren Untergang besiegelt hatte. Der ankommende Dragut hatte mit einem Blick die Lage erfasst und gesehen, wo er ansetzen musste. Jeden Tag hatte Miranda hilflos zusehen müssen, wie der Schutzwall am Großen Hafen wuchs. Am 19. Juni war dieser Schutzwall fertig gestellt worden und bot seitdem den türkischen Artilleristen die ideale Position. Die Position, von der aus sie jedes Versorgungsschiff aus St. Angelo abschießen konnten. So war es seit dem 19. Juni um Mitternacht vorbei: Kein Nachschub aus St. Angelo konnte sie mehr erreichen. Miranda fragte sich, was der alte Mann in St. Angelo wohl empfand. Er musste ohnmächtig mit ansehen, wie St. Elmo fiel. Ob er jeden Tag auf der Mauer stand und zu ihnen hinüber blickte?
Heute Morgen klangen die Kampfschreie der Janitscharen noch schrecklicher als die Tage zuvor. Wussten sie, dass das Ende nah war? Eine neue Flut von Kämpfern hatte sich todbringend über das Fort ergossen. De Guerras hatte noch etwa 100 Mann, die in der Lage waren zu kämpfen. Wie lange würde es noch dauern? Zwei Stunden? Oder würden sie länger standhalten können? Verbissen lud Miranda seine Büchse und schoss. Jetzt musste er sich keine Gedanken mehr machen, ob die Munition reichen würde.
Vier Stunden später war alles vorbei. Das Banner des Sultans wehte über dem Fort und zeigte dem Großmeister in St. Angelo den Triumph des Feindes.
Miranda sah, wie die Janitscharen die restlichen Überlebenden zusammen trieben. Zwei von ihnen schickten sich an, zu ihm auf die Mauer zu steigen. Kurz musterten sie ihn erstaunt, wie er auf einem Stuhl vor ihnen saß. Dann zuckten sie mit den Schultern und schmissen ihn samt Stuhl von der Mauer hinunter in den Hof.
Miranda merkte, wie auch der andere Arm brach. Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. Er lag mit dem Stuhl auf der Seite und versuchte aus dieser Perspektive zu erfassen, was passierte. Er sah, wie ein älterer Mann, gekleidet in einen prächtig geschmückten Umhang und glänzender, mit Gold verzierter Sturmhaube, auf einem Pferd durch das nun weit geöffnete Tor des Forts ritt. Das musste nach den Insignien einer der beiden Kommandanten, wahrscheinlich Mustafa Pascha, sein. Er ließ sich von zwei Janitscharen vom Pferd helfen, in dem sich die beiden auf die Knie in den Staub warfen und er ihre Rücken als Tritt benutzte. Mit ausladenden Schritten, wobei sein großer Säbel, der an seinem Gürtel hing, dünne Spuren in der Asche, die den Boden des Forts bedeckte, hinterließ, ging er in Richtung der Gefangenen.
Miranda erwartete keine große Gnade. Er vermutete, dass sie fast 10.000 Türken das Leben genommen hatten, als sie St. Elmo verteidigten. Mustafa Pascha sah sich um.
Er sagte etwas auf Türkisch zu seinen Untergebenen.
»Er meint, wenn schon so ein kleiner Sohn so einen hohen Preis fordert, was werden wir dann erst für einen so großen Vater zu bezahlen haben?«
Miranda versuchte den Kopf zu drehen, um zu schauen, von wo die Stimme kam. Da sah er, dass De Guerras direkt neben ihm im Staub lag. Gefesselt und blutbeschmiert. Der Ältere sah den Jüngeren an: »Ich spreche etwas Türkisch. Zwar war ich nicht wie unser Großmeister ein ganzes Jahr in Gefangenschaft, aber die fünf Monate haben gereicht, um etwas Türkisch zu lernen. Ich vermute, er meint mit dem kleinen Sohn St. Elmo. Mit dem Vater ist dann wohl Fort St. Angelo gemeint.« Ein Janitschar stieß De Guerras in die Seite, um ihn zum Schweigen zu bringen.
Mustafa Pascha näherte sich ihnen. Er wies zwei Janitscharen an, De Guerras und Miranda aufzurichten, damit er sie betrachten konnte.
In fließendem Französisch fragte er, ob einer von ihnen der Kommandant sei.
»Das bin ich. Kommandant De Guerras, Bailiff of Negropont«, antwortete De Guerras mit lauter Stimme und streckte den Rücken.
»Ihr habt tapfer gekämpft, aber jetzt ist es vorbei. Euch ist klar, dass wir keine Gefangenen unter den anführenden Rittern machen werden?« De Guerras nickte nur kurz.
»Holt mir die Ritter her, die ihr noch lebend findet«, befahl der Pascha seinen Soldaten.
Kurze Zeit später standen die wenigen überlebenden Ritter vor ihm.
Miranda sah, dass Colonel Mas und auch der zweite Kommandant des Forts, de Montserrat, unter ihnen war. Auch einige der jüngeren Ritter, die in den letzten Tagen so tapfer gekämpft hatten, waren noch am Leben. War ihnen bewusst, dass es jetzt zu Ende ging?
Mustafa Pascha schritt die spärliche Reihe der Ritter ab. Scheinbar willkürlich wählte er einige jüngere, einige ältere aus. Ein großer Janitschar trat mit gezogenem Säbel vor. Miranda wusste, was passieren würde. Er zwang sich, hin zu sehen und im Stillen den Männern die verdiente Ehre zu zollen. Sie wurden in eine kniende Position gedrückt. Der Säbel erhob sich achtmal, und acht Köpfe fielen in den Staub. Die Janitscharen stießen wieder ihren hohen Kriegsruf aus.
»Nehmt die Körper und nagelt sie auf Kreuze. Dann können sie es im Tod ihrem Gott gleich tun. Wir werden sie über den Hafen in Richtung St. Angelo schicken, damit der Großmeister sie empfangen kann.« Der Pascha lachte.
Miranda sah De Guerras an. Und zum ersten Mal in all den Tagen, die er an der Seite des alten Spaniers gekämpft hatte, sah er Tränen über dessen Wangen laufen. Es war vorbei.
Mustafa Pascha wandte sich De Guerras, Mas, de Montserrat und Miranda zu.
»Eure Köpfe werde ich als Zeichen der Niederlage gut sichtbar für De la Valette auf die Mauern stecken.« Er deutete auf vier Lanzen, die zwei Janitscharen herbei brachten.
»Hinknien«, befahl er. Keiner von ihnen kam seinem Befehl nach. Die Janitscharen traten ihnen von hinten in die Knie, sodass sie zu Boden sanken. Dann drückte jeweils ein Janitschar dem Ritter vor sich den Kopf nach vorne und hielt ihn in der Position fest. Keiner von ihnen wehrte sich. Ruhig und mit soviel Würde, wie es diese kniende Position ihnen erlaubte, warteten die vier auf ihr Ende.
Miranda schloss die Augen und fing an zu beten. Dann bemerkte er einen leichten Luftzug, den der Säbel des Janitschar vor sich her schob. Das war das letzte, was Andres de Miranda spürte.
24.08.2012 – 07:10 Spinola Bay
Aus dem ersten Streifenwagen stieg eine mittelgroße Frau in Zivil. Sie trug einen dunkelblauen Anzug mit einer weißen Bluse. Die Schuhe waren ein bisschen zu hoch für die Unebenheiten im Gehweg, stellte Pauline gleich fest. Sie musterte die Frau genauer. Dunkle, lange Haare, am Oberkopf etwas altmodisch zusammengenommen. Sie trug einen schmalen schwarzen Anzug und eine jadegrüne Bluse. Trotzdem sie die Bluse nur leicht in die Hose gesteckt hatte, konnte die Weite der Bluse den Bauch nicht verbergen, der sich über dem Hosenbund wölbte. Das war aber auch das einzig rundliche an ihr, alles andere wirkte eckig und kantig. Das Gesicht war eher schmal mit einer länglichen, spitzen Nase und einem mürrischen Zug um den knallrot geschminkten Mund. Die Kantige kam schnurstracks auf Pauline zugestöckelt und sprach sie mit einer erstaunlich leisen und mädchenhaften Stimme an. Aber so leise und weich ihre Stimme auch klang, die nun folgenden Worte waren ganz anders und kamen in einem unglaublichen Tempo, wie ein Stakkato aus ihrem Mund.
»Sind Sie diese Mrs. Boysen? Man hat mir gesagt, Sie haben einen Kopf gefunden? Ich hoffe für Sie, dass das kein schlechter Scherz ist. Ich bin nämlich gestern Abend sehr spät ins Bett gekommen. Es würde mir nicht gefallen, wenn ich umsonst so früh aufgestanden wäre.« Sie schaute Pauline missbilligend von Kopf bis Fuß unter hochgezogenen Augenbrauen an. Scheinbar versuchte sie ihr Gegenüber einzuschätzen. Dann fiel ihr Blick auf die beiden jungen Männer, die hinter Pauline standen. Sofort erhellte sich ihr Blick.
»Und wer sind Sie, meine Herren? Wie ich sehe, machen Sie so früh am Morgen schon Sport. Ich finde es wunderbar, wenn Männer auf ihren Körper achten.«
Pauline dachte, sie wäre in einem schlechten Film. Fing die Frau jetzt an mit den beiden Typen zu flirten? Sie könnte fast deren Mutter sein, außerdem gab es doch wirklich Wichtigeres.
»Ähem, ich wollte Ihnen den Kopf dort oben zeigen«, meldete sich Pauline. Sofort richtete sich ein genervter Blick auf sie. Endlich schaute die Frau hoch. Pauline sah, wie die andere kurz schluckte. Na, geht doch, dachte sie.
»Oh. Jetzt verstehe ich was Sie meinen.« Die Frau drehte sich zu den zwei Polizisten in Uniform um, die sich mittlerweile zu ihnen gesellt hatten und gab ihnen auf maltesisch in kurzen schnellen Sätzen Anweisungen.
Einer der Polizisten zog seine Schuhe aus und fing an dem Pfahl hochzuklettern. Pauline fragte sich, ob der Mörder vielleicht den Pfahl mit Seife präpariert hatte und der Ausflug für den Polizisten gleich in der Bucht enden würde. Aber nein, entweder stellte er sich sehr geschickt an, oder der Pfahl war noch trocken. Er gelangte an das Ende und versuchte den Kopf zu lösen. Die Frau gab von unten Anweisungen und Pauline sah mitleidig, wie der junge Polizist mit hochrotem Kopf versuchte diesen zu folgen. In dem Moment hielt ein anderes Auto und ein älterer Herr sprang erstaunlich behände heraus.
Er schrie: »Stopp! Sofort aufhören!«
Alle Köpfe drehten sich nach ihm um. Der junge Polizist verlor fast das Gleichgewicht, konnte sich aber noch an dem Pfahl festhalten.
»Niemand verunreinigt mir meinen Tatort. Steigen Sie sofort von dem Pfahl herunter, junger Mann. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Spuren gebrauchen. Was ist das denn für ein dilettantisches Vorgehen.« Er drehte sich zu der Frau um.
»Von Ihnen hätte ich mir mehr Besonnenheit erwartet, Inspektor Lucchese. Oder ist es noch zu früh am Morgen für Sie?«
Also war die Frau wohl der Kommissar, dachte Pauline, das konnte ja heiter werden. Sie konnte sich kaum vorstellen, dass sie zu ihr ein ähnlich gutes Verhältnis aufbauen könnte wie zu Comissário Avila von Madeira, der mittlerweile sogar ein Freund von Ben und ihr geworden war.
Aber vielleicht sollte sie nicht ungerecht sein, am Anfang hatte sie Avila auch nicht besonders nett gefunden. Zudem konnte sie sich schon vorstellen, was Ben sagen würde:
»Das ist wieder typisch für dich. Immer diese Stutenbissigkeit.«
Nein, sie musste dieser Inspektorin Lucchese eine Chance geben.
Luccheses Laune schien sich durch das Auftauchen des älteren Herren noch mehr verschlechtert zu haben. Leise fing sie an, mit ihm zu sprechen, während die beiden Polizisten, der eine hatte inzwischen wieder festen Boden unter den Füßen, sich ein hämisches Grinsen kaum verkneifen konnten. Augenscheinlich gefiel es ihnen, dass ihre Chefin einen so deutlichen Rüffel bekommen hatte.
Der ältere Herr fing an, Fotos von dem Kopf zu machen. Die Inspektorin kam hinüber zu Pauline.
»Wir müssen Ihre Aussage aufnehmen, Mrs. Boysen. Folgen Sie mir bitte ins Polizeipräsidium.«
»Aber ich muss noch meiner Mutter Bescheid geben, sie macht sich sonst Sorgen, wenn ich nicht wieder zurück ins Hotel komme.«
»Ihre Mutter?« Ihr Gegenüber schien irritiert.
»Ja, meine Mutter.« Pauline wurde rot. Gott, wie peinlich …
»Ich weiß, es klingt vielleicht etwas eigenartig, aber ich bin eine Woche mit meiner Mutter hier auf Malta, mein Mann kommt erst nächste Woche nach.«
»Hmmm. O.k., dann schlage ich vor, der Streifenwagen bringt Sie kurz ins Hotel, der Kollege begleitet Sie aufs Zimmer, Sie sagen Ihrer Mutter Bescheid und ziehen sich etwas Ordentliches an.« Da war er wieder, dieser kritische Blick, mit dem Pauline von Kopf bis Fuß gemustert wurde.
Der kletterfreudige Polizist winkte Pauline gutmütig zu, und sie ging hinter ihm her zum Streifenwagen. Aus dem Augenwinkel sah sie noch, wie sich die Inspektorin wieder mit einem strahlenden Lächeln an die beiden jungen Läufer wandte. So eine Schnepfe, dachte Pauline.
Der Junge 2
»Was hast du dir dabei gedacht?« Seine Mutter schrie ihn an. Erschreckt schaute er zu seinem Vater hinüber.
Der lachte.
»Ich weiß nicht, was du hast, ich finde, er hat die Aufgabe viel besser gelöst als im letzten Jahr.«
»Und wer macht diese Schweinerei jetzt weg? Du hast gut lachen.« Die Mutter zeigte auf die Überreste der Mäuse. Der Junge hatte Schaschlikspieße genommen und die kleinen Köpfe sorgsam aufgespießt.
»Lass sie doch der Katze. Schließlich sind es ihre Mäuse, die er drapiert hat. Ich finde, heute hat er sich seinen Abend in der Stadt wirklich verdient. Komm her mein Junge, dein Vater ist stolz auf dich. Besser hätte ich es kaum beschreiben können. Genauso war es.« Lachend streckte er die Arme aus und der Junge ließ sich glücklich hineinfallen. Diesmal hatte er seinen Vater nicht enttäuscht. Es war ein schöner Geburtstag.
24.08.2012 – 07:51 St. George's Bay
Pauline schloss das Hotelzimmer auf.
Da hörte sie auch schon die besorgte Stimme ihrer Mutter. »Mäuschen, wo bist du gewesen. Ich habe mir schon solche Sorgen gemacht.«
Dass ihre Mutter sie mit 35 Jahren immer noch Mäuschen nannte. Sie konnte nur hoffen, dass der Polizist kein Wort verstand. Er war eigentlich ziemlich nett, hatte sie im Wagen festgestellt. Er hatte sie auf eine ruhige und besonnene Art nach dem Vorgang gefragt, und sie hatte ihm schon alles erzählt, was sie erlebt hatte.
»Mum, bitte erschrick dich nicht. Das ist Police Sergeant Anthony Rizzo. Ich muss mir eben was anderes anziehen und dann werde ich ihn auf die Polizeistation begleiten.«
»Was hast du denn wieder angestellt?« Ihre Mutter fing an, sie am Arm zu tätscheln. Na prima. Auch ihre Mutter schien, genauso wie Ben, gleich wieder anzunehmen, sie hätte etwas angestellt.
»Nein, ich habe nichts angestellt, Mutter.« Pauline versuchte ihrer Mutter den Arm zu entziehen. Rizzo ahnte scheinbar, worum es ging, auch wenn die Unterhaltung auf Deutsch war. Er konnte sich das Grinsen kaum verkneifen.
»Ich habe beim Laufen eine sehr unschöne Entdeckung gemacht. Und dazu werde ich gleich befragt.«
»Was für eine Entdeckung? Kind, sag mir bitte nicht, du hast wieder eine deiner Leichen entdeckt?« Ihre Mutter war jetzt in heller Aufregung.
Das hatte ja super geklappt, sie nicht zu beunruhigen. Und wieso eigentlich »eine deiner Leichen«. Als ob es normal für mich ist, Tote zu finden. Ich habe doch nur einmal …O. k., dann muss ich ihr wohl auch den Rest erzählen.
»Ja, ich habe tatsächlich einen Toten entdeckt. Aber es war nicht gefährlich und es waren auch gleich zwei junge Männer da, die mit mir bis zum Eintreffen der Polizei gewartet haben.« Ihre Mutter wurde weiß um die Nase.
»Ich komme mit auf die Polizeistation. Ich lasse dich nicht alleine.« Die Stimme ihrer Mutter klang auf einmal sehr entschlossen.
Pauline wusste, dass es sinnlos war, ihre Mutter vom Gegenteil zu überzeugen und wandte sich auf Englisch an den Sergeanten.
»Ist es in Ordnung, wenn meine Mutter mitkommt? Ich glaube, es ist besser für sie, wenn sie jetzt nicht alleine ist.«
Der Sergeant nickte mit dem Kopf und murmelte etwas was Pauline als »So sind Mütter eben …« zu verstehen glaubte.
Kurze Zeit später saßen sie zu dritt im Streifenwagen und fuhren in Richtung Präsidium. Pauline graute schon vor dem Wiedersehen mit Inspektor Lucchese. Hoffentlich war die jetzt in besserer Stimmung. Als sie im Präsidium ankamen und in Richtung der Räume des Homicide Squads gingen, hörte Pauline Lucchese schon von weitem. Die Stimme klang etwas überdreht und sehr hoch. Kurze Zeit später sah Pauline auch den Grund für diesen Stimmungswechsel. Die Inspektorin saß, neckisch mit überschlagenen Beinen und einem Fuß wippend, auf ihrem Schreibtisch, und die beiden Läufer saßen ihr gegenüber. Man hatte nicht das Gefühl, dass hier Polizeiarbeit geleistet wurde, sondern Pauline fühlte sich bei Lucchese Verhalten eher an einen Abschlussball erinnert. Jetzt fing sie sogar an, die Haare nach hinten zu werfen. Oh mein Gott. Mitten in dieser Bewegung erblickte Lucchese Pauline und hielt mit verkniffenem Mund inne. Man sah ihr an, dass sie über die Störung alles andere als erfreut war.
»Ja, Mrs. Boysen. Zu Ihnen komme ich gleich. Ich muss nur noch die Befragung mit diesen beiden wichtigen Zeugen abschließen.« Sie wandte Pauline den Rücken zu. »Wo war ich noch gleich? Ach ja, Sie wohnen also in einem Hotel in der Nähe von Sliema. Wissen Sie eigentlich, dass es dort ein paar tolle Bars gibt, direkt mit Blick auf das Meer. Vielleicht kann ich Ihnen in den nächsten Tagen ein paar Tipps dazu geben. Wie wäre es morgen Abend, Treffen vorm Tower Palace Hotel?«
Unfassbar, die Frau musste es wirklich nötig haben. Pauline schaute den Sergeanten an. Der zuckte nur mit den Achseln. Anscheinend war er dieses Verhalten von seiner Chefin schon gewohnt. Er nahm Pauline mit in den Flur vor Lucchese Büro, auf dem ein paar einfache Stühle standen und organisierte ihrer Mutter und ihr erst einmal einen Cappuccino.
Die beiden jungen Männer verließen kurz darauf das Büro, wobei der eine Pauline seine Karte im Hinausgehen zusteckte.
»Vielleicht können wir ja die nächsten Tage zusammen laufen gehen.« Er zwinkerte ihr zu. Pauline sah, dass das der Lucchese nicht entgangen war. Ihre Befürchtung, dass sie die Nettigkeit des jungen Mannes jetzt ausbaden müsste, bewahrheitete sich sofort, nachdem sie vor dem Schreibtisch Platz genommen hatte. Lucchese hatte mittlerweile ihre Position auf dem Schreibtisch gegen die dahinter auf ihrem Stuhl getauscht. Sie sah auf einmal gar nicht mehr so freundlich aus wie ein paar Minuten zuvor.
»Also, Mrs. Boysen, was haben Sie so früh morgens dort gemacht?« Ihre Stimme hatte jeglichen neckischen Unterton verloren.
»Ich hatte beschlossen draußen zu laufen, weil der Fitnessraum des Hotels total überfüllt und stickig war«, antwortete Pauline wahrheitsgemäß.
Nach etwa einer Stunde, in der Pauline der Lucchese haarklein den Verlauf ihres Morgens erzählt hatte, wurde sie mit den Worten – »Halten Sie sich bitte zu meiner Verfügung« – entlassen.
Pauline hatte während des Gespräches, das ihr viel mehr wie das Verhör einer Verdächtigen vorgekommen war, immer wieder versucht, etwas über den Toten herauszufinden. Aber Lucchese war diesbezüglich sehr zugeknöpft gewesen.
Hmm, wie sollte sie nur ihre Neugier stillen? Im Hinausgehen glitt ihre Hand in die Hosentasche und sie fühlte die Visitenkarte, die der eine Läufer ihr gegeben hatte. Sie überlegte kurz. Könnte das vielleicht die Lösung sein? Gegenüber Ben und ihrer Mutter könnte sie ja behaupten, dass sie das nur täte, um morgens nicht mehr alleine zu laufen. Wenn dabei zufällig ein paar Informationen abfielen, wäre das doch nichts Schlimmes?
24.08.2012 – 16:35 St. George's Bay
Pauline hockte im Hotelflur vor ihrem Zimmer auf dem Boden. Der einzige Platz, an dem sie genug Empfang hatte, um mit ihrem Tablet via Skype zu telefonieren. Das WLan des Hotels war einfach zu schwach.
»Na, was habt ihr heute gemacht? Nur faul am Pool rumgehangen, oder auch etwas besichtigt?« Bens Stimme klang fast so, als stünde er neben ihr. Zum Glück konnten sie keinen Videochat machen, weil die Kamera nicht richtig funktionierte. Sonst hätte er wahrscheinlich an ihrem angespannten Gesicht sofort bemerkt, dass etwas nicht stimmte.
»Ja, wir haben einen ruhigen Tag gehabt. Es ist sehr heiß, und die meiste Zeit haben wir am Pool im Schatten gelegen. Das maltesische Ehepaar mit seinen Kindern war auch wieder da. Mum hat sich gleich zum Babysitten angeboten. Die beiden meinten schon, wenn du kommst, wollen sie uns Mdina zeigen, dort wohnen sie nämlich.«
»Das klingt doch fein. Ich freue mich auch schon auf ein paar ruhige Tage mit dir. Endlich wieder ausgiebig Schnorcheln und im Meer schwimmen, das wird bestimmt schön.«
Pauline atmete tief durch.
»Zum Thema ruhig. Ich muss dir noch etwas erzählen. Versprich mir, dass du dich nicht aufregst. Es ist nichts passiert und mir geht es gut.«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739383361
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (April)
- Schlagworte
- Regionalkrimi Italien Mord Reisen Strandlektüre Mord Serienmörder Regional Tempelritter Historischer Krimi Cosy Crime Regional Krimi Private Ermittlerin Reisekrimi Malta Whodunnit Krimi Thriller Spannung