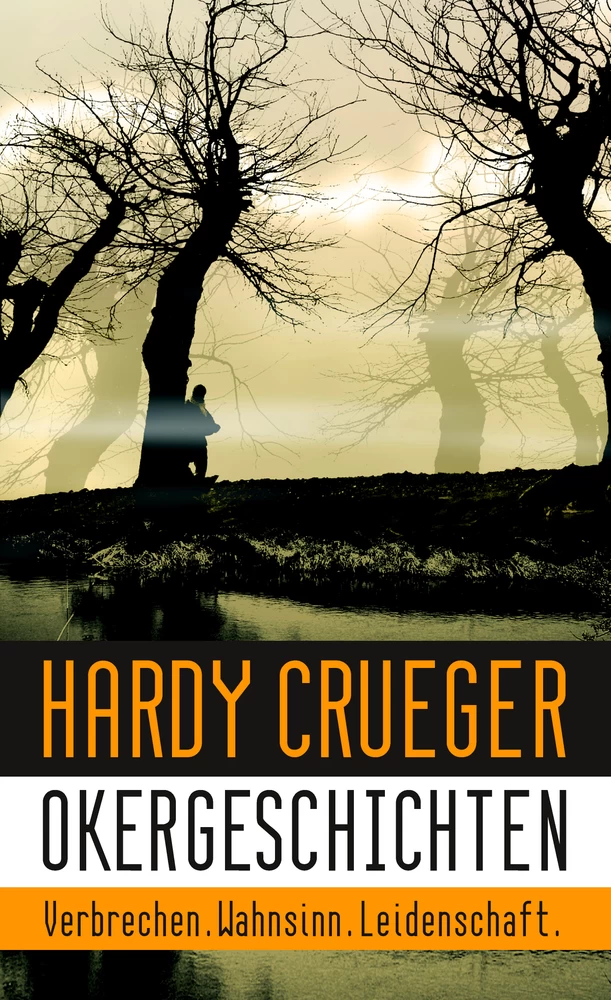Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Editorial
Im brodelnden Wasser des Okerwehrs bei Müden treibt ein toter Mann. Bei Seershausen in der Südheide begeht der Pferderipper den nächsten Mord, und bei Stöckheim wirft ein Angler zum letzten Mal in seinem Leben die Rute aus...
„Es macht schon Herzklopfen, als Leser hilflos zu erleben, wie die Protagonisten sich unentrinnbar in ihr vorgegebenes Schicksal stürzen müssen. Nie ist das Ende seiner Geschichten vorausschaubar, immer sorgt Crueger für eine überraschende Wende – in welche Richtung auch immer.
Crueger macht die Oker in seinen Geschichten zu einem Schicksalsfluss, der Menschleben dem Wahnsinn von Leidenschaft opfert.
Trauer, Wahnsinn, Mysterium, Tod. Und dann beginnt eben ein cruegertypisches Grauen.“
Wolfenbütteler Zeitung
Tatort: Müden
Wo Aller sich und Oker küssen …
Die Leiche des Mannes war längst aus dem strudelnden Wasser geborgen worden und auf dem Weg nach Hannover, in die forensische Abteilung der Medizinischen Hochschule. Untersuchungsbeamte hatten die alte Wehranlage mit dem im Wasser herumwirbelnden Leichnam gefilmt, fotografiert und die nähere Umgebung des Fundortes sorgfältig abgesucht. Aber natürlich nahm Kommissar Carsten Sanders das Okerwehr noch einmal persönlich in Augenschein. Er mochte es, an unbekannten Orten herumzuschnuppern. Es war sein erster Besuch in Müden an der Aller.
Gemächlich ging er den Feldweg zum Wehr hinunter, am Generatorenhäuschen vorbei und lehnte sich auf das Geländer an der Seite des Wasserbeckens. Die Wehrbrücke selber war sehr schmal und mit einer großen eisernen Konstruktion verbaut, mit der man die Tore des Wehrs heben und senken konnte. Das Wasser schoss unter den halb geöffneten Toren hindurch und ergoss sich tosend und schäumend in das Becken zu seinen Füßen. Mehrere Stunden hatte der Tote dort gelegen, festgehalten von Betonklötzen, die am Ende des Auslassbeckens standen wie Zinnen auf einer Burgmauer.
Weil im Dezernat Gifhorn alle verfügbaren Kräfte erkrankt waren, hatte man um Hilfe beim LKA in Hannover gebeten. Deshalb war Sanders hier: wegen eines mutierten Grippevirus. Auf der Fahrt nach Müden hatte ihm Polizeiobermeister Ahlers telefonisch die Fakten mitgeteilt: Ein Mann aus dem Ort, 27 Jahre alt, 1,78 m groß und 71 kg schwer. Gestern Abend war er in das Becken gestürzt und ertrunken. Aber eine Platzwunde und mehrere frische Hämatome am Kopf und Oberkörper des Mannes konnten nicht von dem Sturz ins Wasser verursacht worden sein. Die Verletzungen stammten von wuchtigen Schlägen mit einem stumpfen Gegenstand. Wahrscheinlich aus Holz. Vielleicht einem Baseballschläger.
Es ging auf Mittag zu und die erste Welle der Gaffer war bereits abgeebbt. Sanders schaute in das tosende Wasser. Oker hieß der Fluss, der da durch das Wehr rauschte. Bisher kannte er ihn nur aus Mineralwasserflaschen. Aber das sollte sich bald ändern.
Eine Tatwaffe hatten seine Kollegen nicht gefunden. Im Sog des aufgewühlten Wassers blieb die blinde Suche für den Taucher ergebnislos und lebensgefährlich. Seine Kollegen hatten ihn an der Sicherungsleine wieder ans Ufer ziehen müssen.
Wegen fehlender Spuren in der näheren Umgebung konnte die Tat ebenso gut direkt hier am Wehr vollzogen worden sein wie sonst wo. Sanders strich sich über das fliehende Kinn und seufzte. Auch die Leiche des Mannes würde nur wenige Informationen preisgeben. Das brodelnde Wasser hinter dem Wehr war wie eine riesige Waschmaschine. An Kleidung und Körper würde man keine fremde DNA, keine Partikel und keine Fingerabdrücke mehr finden. Der Leichnam würde nicht sprechen. Eine dürftige Faktenlage, es würde nicht leicht werden.
Die Frage, ob die Tat geplant oder zufällig vollzogen worden war, ließ sich zu diesem Zeitpunkt genauso wenig beantworten wie die des Tatortes. Wenn sie hier auf der Wehrbrücke geschehen war, hatte der Mann vielleicht genau so dagestanden wie er jetzt: Auf das Geländer gestützt, den Blick verklärt auf das quirlende, schäumende Wasser gerichtet. Und plötzlich hatte jemand hinter ihm gestanden. Er hatte den Täter nicht kommen hören. So wie Sanders die alte Frau mit der Gehhilfe nicht hatte kommen hören, die auf einmal neben ihm stand.
»Ts, ts, ts. Schrecklich, nicht wahr?«, sagte sie laut und schaute kopfschüttelnd in das Wasser.
Der Kommissar nickte. »Kannten sie ihn?«, fragte er.
»Na, das war doch der Schänder. Meine Nachbarin hat den Toten gleich erkannt, als sie heute Morgen hier war. Die haben ihn aus dem Wasser gezogen und sie hat sofort gesagt, das ist doch der Schänder. Martin Krutschik! Die Polizisten haben sich mehrmals bei ihr bedankt, weil sie ihnen viel Arbeit erspart hat.«
So hatte es ihm auch Polizeiobermeister Ahlers geschildert.
»Der Schänder?«, fragte er.
»Na, der hat doch immer die Mädchen belästigt, der Kerl. Der war doch krank. Letztens erst hatte er wieder am Spielplatz gestanden und hat …, na sie wissen schon, die Hose runter … und den Kleinen Angst gemacht.«
Ahlers hatte gesagt, man habe Martin Krutschik nie wegen sexueller Übergriffe belangen können. Vor zehn Jahren sei mal eine Anklage wegen versuchter Vergewaltigung gegen den damals 17 jährigen Jungen erhoben, mangels Beweisen aber wieder fallengelassen worden. Während der Untersuchung hatte ein Psychologe autistische Züge bei ihm diagnostiziert. Wegen seiner introvertierten Art sei er ein ideales Opfer von Gerüchten und Spekulationen gewesen, hatte Ahlers gesagt. Immer an der Spitze aller Verdächtigen, wenn Sexualdelikte in Müden und der Umgebung bekannt wurden.
»Na, aber trotz allem«, sagte die Frau, »man darf doch einen Menschen nicht einfach so umbringen. Ohne Gericht, ohne Verhandlung.« Sie drehte den Kopf und schaute Sanders an. Der siegreiche Kampf mit einem Schlaganfall war in ihr Gesicht gemeißelt wie ein Relief. »Sind Sie von der Zeitung?«, fragte sie den Mann in dem legeren Anzug.
»Nein, nein«, Sanders lachte. »Ich wollte mir nur mal den Tatort ansehen.«
»Ja, ist doch mal was anderes als im Fernsehen. Na, ich werd mal wieder los. Die Fußpflege kommt um halb drei. Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen«, sagte der Kommissar und schaute der alten Frau hinterher, wie sie sich mit dem Rollator und ihren mindestens 70 Lebensjahren auf dem Buckel in Richtung Landstraße voranarbeitete. Er blickte noch einmal in das hypnotisch wallende Wasser, dann steckte er die Hände in die Hosentaschen, so dass das Jackett in Höhe seiner Hüfte Stummelflügel bekam, und trottete der Frau hinterher. Sie kannte sich in Müden aus. Sie könnte ein Quell wertvoller Informationen sein.
Als er neben ihr war, bot er seine Hilfe an, die sie dankend ablehnte. »Wissen Sie, ob er Freunde hatte?«, fragte er. »Feinde sicherlich genug. Aber Freunde …?«
Die Alte blieb stehen, legte den Kopf schief, kniff ein Auge zu und schaute zu dem großen Mann mit dem kurzen, dunklen Haar hoch. »Sie sind von der Kripo, oder?«
»Stimmt, Miss Marple.« Der Kommissar lachte und hielt ihr die Hand hin. »Sanders, LKA Niedersachsen.«
»Nein …! Also das ist ja …«, sagte sie und griff zu. »Wenn ich das der Ilse erzähle … ein echter Kriminal … Ober … Haupt … Kommissar …«
»Ja, genau. Ganz, ganz echt. Und vielleicht können Sie mir helfen. Also, hatte der Tote Freunde? Eine Freundin? Einen Freund?«
»Nein, nein, nein. Ach, der doch nicht. Wenn ich den mal gesehen habe, war der immer alleine. Die Mutter tut mir wirklich leid. Freunde hatte der nicht … obwohl … in letzter Zeit, hab ich den oft gesehen. Manchmal saß er dahinten …«, sie deutete auf die spitze Landzunge, die den Zusammenfluss von Oker und Aller markierte, »… und starrte auf das Wasser. Früher sind da oft Kinder drin ertrunken. Oder er stand stundenlang vor dem Laden von der Heidi. Heidi Keller, die hat einen Frisiersalon an der Hauptstraße, Ecke Bahnhofstraße. Ich geh’ da aber schon lange nicht mehr hin.«
Sanders nickte. »Danke«, sagte er. Dann verabschiedete er sich von der alten Frau, stieg in sein Auto und fuhr über die Allerbrücke hinein nach Müden. Bevor er die Mutter des Toten aufsuchte, würde er bei Heidi Keller vorbeischauen, denn den Besuch bei einer Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat, wollte er so lange wie möglich hinauszögern.
Der Meister-Salon-Keller war ein kleiner, modern gestalteter Frisiersalon. Sanders drückte die Tür auf und eine Glocke ertönte. Es waren keine Kunden da und eine Frau in Stiefeln und einem kurzen, grauen Tweedrock kam aus einem Raum im hinteren Bereich.
Der Kommissar zog den Dienstausweis aus der Innentasche des Sakkos. »Carsten Sanders, Landeskriminalamt, Hannover«, sagte er und hielt ihr lächelnd die Plastikkarte hin.
Heidi Keller war vielleicht Mitte dreißig, zehn Jahre jünger als Sanders, einen Kopf kleiner und mit ästhetischen Rundungen. Das kastanienbraune Haar wippte routiniert zusammengesteckt in ihrem Nacken. Der Kommissar sog die Luft ein, die sie umgab: Haarspray, Deo und Kaffee. Sie hob den Kopf. Die blauen Knopfaugen in ihrem runden Gesicht waren ungeschminkt und gerötet. Sie wusste es schon, und es hatte sie mitgenommen.
Sie drehte sich um, ging voraus durch einen Vorhang in eine kleine Küche und bot ihm Kaffee an. Sanders war dankbar. Er setzte sich und schaute sich vorsichtig um. »Sie kannten ihn?«, sagte er und sein Blick glitt nur flüchtig über ihr Gesicht, als sie die Frage bejahte.
»Wie gut denn?«, fragte er leise. »Ich meine, sind Sie zusammen zur Schule gegangen, oder …«
»Nein, er war doch fast zehn Jahre jünger … Alle drei Monate kam er zum Haare schneiden. Immer mittwochs um 16:45.«
Sanders nahm die Tasse und pustete hinein. »Sie hatten ihn ganz gern, was.« Er hoffte nicht zu schnell vorzudringen. Er nahm einen winzigen Schluck.
»Nein, ganz bestimmt nicht. Aber wenn jemand, den man kennt, so grausam ums Leben kommen muss, und …« Das Läuten der Glocke an der Ladentür ließ den Satz unvollendet. »Schatz! Ich bin’s«, hörten sie, bevor sie sich erheben konnte. Ein großer, kräftiger Mann mit kahlem Schädel erschien in der Tür. Als er den attraktiven Mann im Anzug sah, stutze er und hob drohend das Kinn.
»André – das ist Kommissar Sanders. Martin Krutschik ist tot.«
Seine Züge entspannten sich nicht. Sanders stand auf und gab ihm die Hand.
»Ich weiß, Schatz. Das pfeifen doch die Spatzen von den Dächern.« Plötzlich war es sehr eng in der Küche. Der ganze Raum war nur noch angefüllt mit der Gegenwart des kantigen Alpha-Mannes. »Keller, guten Tag, Herr Sanders. Sie vernehmen meine Frau?«
»Nein, wir unterhalten uns.«
»Über den Schänder? Was hat denn meine Frau damit zu tun?«
Sanders schaute ihm direkt in die Augen, als er antwortete. »Sie … kannte ihn?«
Keller hielt seinem Blick stand. »Aber doch nur als Kunde, nicht war, Schatz?«
Frau Keller nickte. Sanders wartete auf das Angebot, sich wieder setzen zu dürfen. Aber es kam nicht. »Herr Krutschik stand immer mal hier vor dem Laden. Stundenlang«, sagte er.
Kellers Augen blitzten. »Der war doch bekloppt!« Die Wut riss ihm den Kopf in den Nacken. »Erst letztens hat er wieder die Kinder auf dem Spielplatz belästigt, das perverse Schwein.«
»Es ist nicht bewiesen, dass er das war. Warum stand er hier vor dem Laden?«
»Was weiß ich. Der gehört doch ins Irrenhaus! Der ist … war doch eine Gefahr für alle! Auf seinem Computer werden Sie sicher eine Menge ekelhafter Filme finden.«
Sanders sah die zusammengezogenen Augenbrauen des Mannes. Die kleine Speichelblase in seinem Mundwinkel. Die zurückgezogene Oberlippe gab spitze Eckzähne frei. Ihm kam ein Verdacht. Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Vielleicht war es noch viel, viel zu früh, diese Frage zu stellen. Aber der Alpha-Mann nervte ihn. Also stellte er die Frage: »Wo waren Sie gestern Abend, Herr Keller?«
»Wa … was? … ich? Was habe ich denn damit zu tun? Das ist ja wohl …« Er schnappte nach Luft. Aber dann bekam sein Gesicht einen triumphalen Ausdruck. »Wir waren im Theater«, sagte er. »Wir haben Ralph Beyer und seine Frau abgeholt, das ist der CDU-Vorsitzende hier. Dann sind wir zusammen nach Braunschweig gefahren. Ins Theater. Macbeth. Danach waren wir noch eine Kleinigkeit essen, beim Japaner. Kurz nach Mitternacht waren wir wieder zu Hause. Warum fragen Sie mich das? Glauben Sie etwa …«
»Ich glaube gar nichts«, sagte Sanders. Er schob sich an Keller vorbei in den Laden. »Auf Wiedersehen, Herr Keller. Frau Keller.«
»Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen, Herr Kommissar«, rief der Mann ihm nach.
Bevor der Kommissar nach diesem Fehlschlag die Mutter des Opfers aufsuchte, wollte er etwas frische Luft schnappen und sich die Beine vertreten. Miss Marple hatte ihn wohl auf einen Holzweg geschickt. Ein Passant wies ihm den richtigen Weg zum Spielplatz. Er setzte sich auf eine Bank mit Blick auf ein paar abgenutzte Klettergerüste und einen Sandkasten. Fünf Kinder tobten herum. Die Mütter schossen Blicke auf ihn ab, die töten konnten. Aber sie wagten nicht, den fremden Mann anzusprechen, der in einem flotten Anzug dasaß wie in einem Werbespot für Versicherungen – aber ohne Krawatte. Also ging er rüber zu ihnen.
Nachdem er sich lächelnd geoutet hatte, sprühten ihm Zeter und Mordio aus verkniffenen rotfleckigen Gesichtern mit solch einem Druck entgegen, dass es ihm das Lächeln wegriss. Es begann eine mentale Leichenfledderei, eine posthume Euthanasie, wie Sanders sie selten erlebt hatte. Sie hätten es getan haben können. Nicht jede der kleinen, speckigen Furien allein, aber alle zusammen hätten sie im falschen Augenblick die Power für einen Lynchmord gehabt. Zumindest verbal. Sie waren grausam, denn sie hatten Angst um ihre Kinder. Sie sprachen es nicht aus, aber sie waren froh, dass der Schänder endlich weg war. Einhellig waren sie der Meinung, dass es früher oder später genau so hatte kommen müssen. Ihr mitleidloser Hass war genau das, was Sanders gebraucht hatte. Er machte ihn stark für den Besuch bei der Mutter des Getöteten. Er bedanke sich bei den Frauen, schlenderte zum Auto zurück, und schaute auf dem Navigationsgerät nach, wo sie wohnte.
Er hatte gedacht, sie würde weinen, schreien, flehen, den Herrgott anrufen, kreischen und klagen. Aber sie tat nichts von alledem. Wenn Kriminalkommissar Carsten Sanders in den letzten Wochen einen coolen Menschen getroffen hatte, dann war es diese kleine dürre Frau, die auf dem abgewetzten Ledersofa vor ihm saß und an ihm vorbei durch die Terrassentür in den Garten schaute. Augen aus Stahl. Wächsernes Gesicht. Wortkarg. Sie sagte, sie sei sogar ein bisschen erleichtert, dass es endlich vorbei sei mit Martin. Sie habe noch eine Tochter in Australien, da wolle sie nun endlich hin. Ihr Sohn habe ihr das Leben hier zur Hölle gemacht. Sie traue sich kaum noch aus dem Haus, wegen der Leute.
Außerdem habe er sie ständig bedroht und jetzt wollte er auch noch sein Erbteil ausbezahlt haben. Er würde bald fortgehen, habe er zur Begründung gesagt. Alle Therapien hatte er abgebrochen, und nun auch noch das mit der Frisöse. Das war ja wohl das Letzte.
»Was?«, fragte der Kommissar.
»Der ist ihr hinterher gerannt. Wie ein Straßenköter einer läufigen Hündin …«
Morgen würde sie anfangen auszumisten, sagte sie nach ein paar Schweigesekunden, und den Verkauf des Hauses in die Wege leiten.
Nach dem Massaker auf dem Spielplatz gab die Mutter Sanders Gemüt fast den Todesstoß. In der Kälte ihrer Aura erstarrte seine ansonsten recht agile Empathie. Er traute ihr alles zu. Er floh regelrecht aus dem Haus. Aber er würde wiederkommen müssen, das wusste er.
vEr fuhr zur Hauptstraße zurück, hielt vor einem türkischen Imbiss und aß die Lahmacun im Auto, unweit des Meister-Salon-Keller. Gerade als er abgebissen hatte, schnarrte sein Handy. Es war ein Mitarbeiter der Gerichtsmedizin aus Hannover. »Der Leichnam hat geredet, haha!«, sagte er albern. »Spaß beiseite, in der Speiseröhre des Toten steckte ein Zettel. Er ist zerkaut und vom Speichel angegriffen, es war mühsam, aber wir konnten die Buchstaben rekonstruieren. Um 23 Uhr am Wehr, Heidi. Das ist auch in etwa der Todeszeitpunkt. Er muss ihn ganz kurz vor oder während des Kampfes mit seinem Mörder in den Mund gesteckt haben.«
»Vielen Dank«, sagte Sanders. »Können Sie mir ein Foto davon rüberschicken?« Der Mitarbeiter bejahte, dann beendeten sie das Gespräch. Es war also kein spontaner Überfall gewesen, sondern eine Falle: Mit der Unterschrift Heidi war Krutschik gezielt zum Wehr gelockt worden.
Ein paar Minuten später sah er die Buchstaben auf dem Bildschirm des Handys. Er schaute zum Salon hinüber. Ein oder zwei Kundinnen mochten im Laden sein. Er würde Heidi Keller gern noch einmal sprechen. Ganz kurz. Nur ein paar gezielte Fragen. Und ihre Handschrift wollte er sehen. Als er die Autotür zuwarf, rollte Miss Marple schlurfend auf ihn zu.
»Na, Herr Kommissar, schon was ’rausgefunden?«, sagte sie, drehte den Rollator herum und setzte sich auf die Ablage.
»Ja, aber ich darf nicht darüber reden«, sagte Sanders und lächelte.
»Natürlich nicht. Aber es waren die Jungs, stimmt’s?«
Sanders Lächeln wurde schief. »Äh … kann sein. Aber … aber was für ein Motiv sollten sie denn haben, die Jungs?« Und wer, um Gottes Willen, waren die?
»Na, weil er doch immer am Spielplatz stand, der Schänder, wegen ihrer Kinder.«
Natürlich, Jungs. Sie kannte die meisten Väter als kleine Jungs. Sanders nickte.
»Vielleicht wollten sie ihn nur mal vermoppen«, spann sie ihren Faden weiter. »Und dann ist er ins Wasser gefallen. Aus dem Wehr kriegt man einen Menschen nur schwer wieder raus.« Sie schaute zum Meister-Salon-Keller und stupste ihr Kinn in die Richtung. »Ihr Mann hat in Gifhorn ein Bauunternehmen. Der lässt da nur billige Russen arbeiten. Bei uns, in dem neuen Anbau, hatten wir sooolch einen Riss in der Wand.« Sie breitete die zitternden Hände bis zu den schmalen Schultern aus. »Das ging bis vor’s Gericht. Die haben uns sogar bedroht. Nein, nein, ich geh da nicht mehr hin. Die Kellers haben keine Kinder...« Sie drehte den Kopf wieder in Sanders Richtung. »Wissen Sie, warum es hier in Müden auf der anderen Seite der Aller keine Häuser gibt? Nein? Na, das ist die fruchtbare Seite. Von den Überschwemmungen. Das Land ist zu schade fürs Bauen.«
»Interessant. Sehr interessant«, sagte Sanders und verabschiedete sich.
Es war gegen 18 Uhr, als er zum zweiten Mal den Frisiersalon betrat. Frau Keller stand hinter einer Kundin und föhnte deren Haar, eine weitere saß noch unter der Trockenhaube. Er setzte sich in die Nähe des geschwungenen Kassentresens auf einen Stuhl und wartete. An der Kasse hing ein Blatt Papier, auf dem die speziellen Angebote angepriesen wurden. Sanders nahm an, dass es die Handschrift von Frau Keller war. Er zog das Handy hervor und verglich die Buchstaben. Sie sahen sich ähnlich. Aber auch die Handschriften der Mutter des Toten und die des Alpha-Mannes würde er noch überprüfen müssen.
Er blätterte in einer Illustrierten. Bunte Bilder einer traumhaften Welt. Die Menschen lieben Illusionen, denn die Wahrheit wollen sie nicht hören. Warum hatte Martin Krutschik sein Erbe eingefordert? Und warum wollte er weg aus Müden? Wollte er fliehen? Der Kommissar schaute auf und sah Heidi Keller an der Trockenhaube hantieren. Über den Rand der Illustrierten hinweg beobachtete er die Friseurmeisterin. Frau Keller bewegte sich hölzern. Wenn die Kundin redete, lachte sie schrill und laut auf. Ihr fiel ein Lockenwickler herunter, sie schüttelte die Dose mit dem Haarspray viel zu lange. Immer wieder schaute sie zu ihm hinüber. Sie schien der einzige Mensch zu sein, den der Tod von Martin Krutschik bewegte.
Als die letzte Kundin fort war, saß er wieder in der kleinen Küche hinter dem Salon. Heidi Keller ihm vis-à-vis. Er stellte ihr die gleiche Frage, deren vollständige Antwort ihm durch das Auftauchen ihres Mannes verweigert worden war. »Sie hatten ihn ganz gern, was?« Den Zettel aus dem Leichnam verschwieg er vorerst. Vielleicht würde es auch ohne Bezichtigung gehen.
»Nein«, sagte sie wieder und zuckte aufschluchzend zusammen. Plötzlich hatte sie ein Taschentuch in der Hand und drückte es in ihr Gesicht. Sie weinte. Leise, als dürfe es niemand sehen. Es war herzzerreißend. In Sanders Hals wuchs ein Kloß, groß und hart wie eine Walnuss. Es gibt Dinge, an die kann man sich nicht gewöhnen. Bei ihm waren es Frauen mit tränennassen Gesichtern. Sie weichten seine Nerven auf. Er musste aufpassen. Sie konnten sehr mächtige Gegner sein. Er atmete ein und schluckte den Kloß hinunter.
Die Attacke ebbte ab. Heidi Keller schnaubte leise in das Taschentuch, dann holte sie tief Luft und straffte ihren Körper. Sie hatte einen Entschluss gefasst. »Am Anfang habe ich ihn gemocht, ja. Er tat mir leid. Er kam ja immer zum Haare schneiden. Er war sehr schüchtern, sensibel, er wurde sogar rot, wenn ich ihn ansprach. Auf dem letzten Weinfest … ich hatte zu viel getrunken … und André … und ich … wir hatten uns gestritten … wegen der künstlichen Befruchtung. Es hatte wieder nicht geklappt. André gab mir die Schuld. Ich bin da einfach weg. Einfach weggelaufen. Irgendwohin. Bis ich an der Mündung saß. Ich … ich… wusste nicht mehr, was ich tun sollte … dann saß plötzlich Martin neben mir. Er saß einfach nur da. Und dann hat er meine Hand genommen. Ganz sanft … zärtlich … es war so … die laue Nacht, die Sterne, das Blinken des Wassers …«
Die Worte und der Klang ihrer Stimme lösten bei Sanders eine Gänsehaut aus. Ein Prickeln zwischen Wonne und Schauer. Wie immer, wenn ihm jemand voller Vertrauen die Wahrheit sagte. Er hörte einfach nur zu.
»Es war … wie in einem Traum. Er erzählte eine Geschichte. Ganz leise. Nur für mich ganz allein. Von Feen und Wassernixen. Von den Flüssen, in denen sie glücklich leben. In denen sich auch all die glücklichen Seelen tummeln, denen das Leben die Liebe gezeigt hat, hatte er gesagt …« Ihre Stimme erstarb in der Erinnerung an die Nacht. Sie war nur ein Hauch, als sie weiterredete. »Wir hielten uns bei den Händen. Er … er sagte, das hier, das ist die fruchtbare Seite, nicht da drüben … Seit dieser Nacht ist er mir hintergelaufen. Ich habe ihm gesagt, er soll das lassen. Ich will das nicht, aber er hat immer wieder angerufen, Briefe geschrieben und vor dem Laden gestanden. Ich habe ihn angeschrien … André hatte ihm gedroht, er soll damit aufhören, sonst … Ich hatte Angst davor, dass mein Mann etwas Unüberlegtes, Schreckliches tun könnte. Er ist doch so impulsiv. Ich ging zu Martins Mutter. Wir … ich … Sie sagte, der braucht nur mal eine ordentliche Tracht Prügel. Dann … ich sprach mit einem Arbeiter aus der Firma meines Mannes. Ich wusste doch nicht mehr, was ich noch tun sollte … er sollte ihn doch nicht umbringen … er sollte ihn doch nicht … umbringen, nur …« Sie konnte nicht mehr weitersprechen. Sie weinte sich die Augen aus dem Kopf.
Nach einer Weile fragte der Kommissar nach dem Namen des Mannes, dann erhob er sich. »Es ist nicht mehr zu ändern. Auf Wiedersehen, Frau Keller.« Er war sehr erleichtert, dass er sie nicht hatte bezichtigen und in die Mangel nehmen müssen, sie anbrüllen oder bedrohen, so wie die gemimten Kollegen im Fernsehen es tun.
Als er im Auto saß, alarmierte er Polizeiobermeister Ahlers, der ihm nach ein paar Minuten die Adresse des Mannes in Gifhorn nannte und dann die nötigen Einsatzkräfte mobilisierte.
Kurz bevor Sanders in die Straße einbog, tastete er nach der Dienstwaffe unter seinem Jackett, denn jetzt begann der gefährliche Teil seiner Arbeit: die Festnahme des Täters. Aber sie konnten ihn im Schlaf überraschen, denn der Mann war bis obenhin vollgedröhnt mit Wodka.
Tatort: Seershausen / Hillerse
Der Pferderipper
Ein sonorer Bariton dröhnte durch den Innenraum des klapprigen VW-Busses. Der bärtige Mann am Lenkrad zeigte beim Mitsingen die goldenen Kronen seiner Backenzähne, während die kurzhaarige Frau neben ihm mit zusammengepressten Lippen aus dem Fenster starrte. Die Stimme des Mannes klang ein bisschen wie die von Johnny Cash, die aus den Lautsprechern sprudelte, und das burns, burns, burns – the ring of fire versetzte seinen gewaltigen Brustkorb in Vibrationen. Der forsche Country-Rhythmus ließ seinen Kopf nach links und rechts zucken, so dass seine langen braunen Locken ununterbrochen herumtanzten.
Die große Frau mochte Johnny Cash nicht, weil er ihn gemocht hatte. Sie war froh, als das Lied zu Ende war, Lutz, der bärtige Fahrer, endlich schwieg und das Ortsschild von Gifhorn vor ihnen auftauchte.
Sie freute sich auf zwei Tage und 60 Kilometer Ruhe und Frieden, welche ihr die Bootstour hinunter nach Celle bescheren sollte. Die Pfingsttage waren vorüber, es war Mittwochnachmittag und kaum mit anderen Bootsfahrern auf dem Fluss zu rechnen.
Sie verfügte über ein gutes Navigationsgerät und lotste den Fahrer durch die Stadt, an einer Kleingartenkolonie vorbei, bis zum Ufer der Aller unterhalb einer kleinen Staustufe.
Der VW-Bus stand ein paar Meter vom Ufer entfernt in der Sonne. Der dicke Lutz half ihr stöhnend, das Kajak vom Dach des Bullis zu wuchten und bis an die Einstiegsstelle zu tragen. Die beiden wasserdichten Packsäcke enthielten alles, was sie für die zwei Tage brauchte: Milch, Müsli, Brot und Käse. Wasser, Kaffee und das Säckchen mit den Zuckerstücken. Trockene Wäsche, Isomatte, Schlafsack und ein Kopfkissen.
»Wo wirst du denn da draußen in der Wildnis übernachten?«, fragte Lutz kurzatmig, und versuchte sich mit einem zerklumpten Papiertaschentuch Schweißtropfen von der Schläfe zu tupfen. »Nur damit ich der Polizei sagen kann, wo sie dich suchen müssen.«
»Irgendwo zwischen Müden und Schwachhausen … Lach nicht, das heißt wirklich so«, sagte sie und cremte sich die kräftigen Oberarme ein.
»Auf einem Campingplatz? Bitte! Mir zuliebe.«
»Auf keinen Fall! Ich will niemanden sehen. Keinen Menschen, deshalb bin ich hier. Lutz, mach dir doch nicht immer solche Sorgen.« Sie setzte Schirmmütze und Sonnenbrille auf, ballte die linke Hand zu einer imposanten Faust und fletschte die Zähne. »Ich kann mich wehren«, sagte sie und stieß die Faust blitzschnell gegen seine Schulter.
»Aua! … Ich weiß, ich weiß«, sagte Lutz und rieb sich die Stelle, an der ihn ihre Faust getroffen hatte. »Aber wenn da so ein durchgeknallter perverser Idiot vor dir steht, mit nichts als geiler Mordlust in den Augen, weil er als Kind übelst missbraucht wurde und Frauen mehr hasst als der Nazi den Neger … gegen so was hat auch eine ehemalige Zehnkämpferin wie du keine Chance.«
Sie griff nach dem Doppelpaddel, stieß einen Schrei aus und ließ es mehrmals um ihren Kopf wirbeln wie den Rotor eines Hubschraubers. »Wer mir zu nahe kommt – der ist so gut wie tot!«
Die Ruderblätter sausten knapp über Lutz’ Lockenkopf hinweg. Trotzdem duckte er sich und hob die Hände. »Okay, okay, du bist echtes Dynamit, Baby. Ist dein Handy geladen?«
Sie ließ das Paddel sinken. »Natürlich«, sagte sie und schob die Mütze weit in ihren kräftigen Stiernacken. »Mach dir keine Sorgen. Ich rufe dich morgen Vormittag an«, lächelnd legte sie das Paddel in das Boot und hievte die beiden wasserdichten Packsäcke hinein. Sie kannte den dicken Lutz noch nicht lange. Sie mochte ihn, weil sie sich auf ihn verlassen konnte. Hin und wieder trug er Frauenkleider. Und auch deshalb mochte sie ihn, weil er kein richtiger Mann war.
Lutz nickte und stieg in seinen VW-Bus. »Also, bis morgen in Celle. An der Allerbrücke. Und hüte dich vor dem Heidemörder. Und den Werwölfen. Und dem Pferderipper.«
»Sehe ich vielleicht aus wie ein Pferd«, schnaubte sie und zog die Neopren-Schuhe an.
»Natürlich nicht«, sagte Lutz, knallte die Tür zu und lehnte sich aus dem Fenster. »Aber wer weiß, zu was solch ein schwachsinniger, kaputter Idiot noch alles fähig ist!«, rief er. »In der Zeitung stand, dass er gefährlich ist! Der könnte auch Menschen töten! Also, pass auf dich auf…« Sie schaute ihm nach und hob eine Hand zum Abschied. Dann band sie sich die Paddeljacke um ihre kräftige Hüfte, schob das Boot ins Wasser und stieg hinein.
Die Sonne hatte längst ihren höchsten Stand überschritten, und wenn der Fluss die entsprechende Biegung machte, spiegelte sich ihr stechendes Licht in hunderten blinkender Facetten auf den krauseligen Wellen des Wassers.
Mit ein paar kräftigen Paddelschlägen entfernte sie sich vom Ufer, glitt an einer kleinen Insel entlang und unterquerte nach ein paar Minuten die Bundesstraße mit einem schäumenden Sprint. Hinter der Brücke hüllte sie der Fluss in die ersehnte Ruhe und den Frieden, den sie so bitter nötig hatte.
Souverän zerschnitt das Kajak die Wasseroberfläche und hinterließ eine V-förmige Spur, die in zwei, drei schrägen Wellen gegen das Flussufer anlief. Sie zog energisch das Paddel durch, glitt schnell über dem Wasser dahin, bis der Kopf eines Pferdes über einen Zaun lugte. Mit riesigen, glänzenden Augen schaute das Tier sie neugierig an. Sie hörte auf zu paddeln. Das Kajak wurde langsamer. Sie begann zu kichern. Aus dem Kichern wurde ein Lachen, das immer lauter und verrückter schrill den Fluss hinunter hallte.
Das Lachen steigerte sich zu einem hysterischen Brüllen, das in einem durchdringenden Schrei gipfelte. Sie warf den Kopf hin und her. Ihr Mund war ein schwarzes Loch und ihre Augen waren zusammengekniffen, als würde sie sie nie wieder öffnen wollen. Als wünsche sie, für immer blind zu sein.
Sie schrie, um sich zu erinnern, und die Enten stoben mit hektischen Flügelschlägen nach allen Seiten davon. Sie schrie und warf sich so heftig von einer Seite auf die andere, dass beinahe das Kajak gekentert wäre. Sie schrie, um wütend zu werden. Sie schrie, um den Hass zu wecken. Sie schrie all die Dämonen wieder herbei, die die Therapeuten meinten, vernichtet zu haben. Sie schrie, um sich zu erinnern: An die Ohnmacht, an die unbegreifliche Machtlosigkeit, die sie fast umgebracht hatte. Sie, vor der Kirche, ganz in Weiß und mit roten Rosen, weinend vor Glück. Und er kam nicht. Der Bräutigam war nicht gekommen! Sie schrie, um sich zu erinnern, um ihre Wut zu wecken. Sie schrie die alten Bilder herbei. Vor zehn Jahren waren sie entstanden, und heute, heute würde sie sie endlich auslöschen. Sie schrie, als sei sie besessen, und wer es sah, würde erzählen, er habe eine Verrückte gesehen.
Mit hochrotem Kopf rang sie nach Atem. Die Schirmmütze war ihr vom Kopf gefallen und trieb neben dem Boot im Wasser. Sie beugte sich über den Rand, fischte sie heraus, wrang sie aus. Dann legte sie die Hände zusammen, ließ Wasser hineinlaufen, kühlte sich das erhitzte Gesicht, strich mit den nassen Fingern über das kurze Haar.
Das Doppelpaddel lag quer über dem Kajak. Sie packte es, tauchte es in den Fluss und das schmale Boot kam wieder in Fahrt. Mit kräftigen Stößen trieb sie es vorwärts, immer schneller fuhr sie den Fluss hinunter, wirbelte die Paddel herum, bis ihre Arme gefühllos wurden. Am Nachmittag erreichte sie Müden.
Vor dem Wehr legte sie an einem kleinen Steg an. Zwei Spaziergänger wünschten ihr einen guten Tag, als sie die Packsäcke an das Ufer stellte, und beobachteten beeindruckt, wie geschickt sie das Kajak aus dem Wasser zog, es hochhob und über die Straße trug. 18 Kilo, das schaffte sie mit links. Hinter dem Wehr fuhr sie noch ein paar hundert Meter die Aller entlang. Dann wendete sie das Kajak in einer rauschenden scharfen Kurve nach links und fuhr in die Oker hinein.
Sie überwand das historische Okerwehr, fand ihren Rhythmus und fuhr zügig die Oker aufwärts. Gegen die Strömung konnten ihre Muskeln beweisen, was sie auch jenseits der 40 noch zu leisten im Stande waren. Erst vor dem nächsten Dorf legte sie eine kurze Rast ein.
Die Sonne sank dem Horizont entgegen, aber sie hatte noch genug Zeit. Das Navi zeigte ihr an, dass sie Meinersen und Seers-hausen hinter sich gelassen hatte und mit dem letzten Tageslicht erreichte sie den Platz, den sie sich zum Übernachten ausgesucht hatte. Etwa einen Kilometer hinter Volkse bildete das verschlungene Band alter Okerauen einige Halbinseln. Dort war ein sicherer Lagerplatz, an drei Seiten von Wasser umgeben, so dass eine Gefahr sich nur von einem engen Durchgang her nähern konnte.
An dem schmalen Strand zeigten Schleifspuren und eine Feuerstelle, dass der Ort häufig von Kanuten aufgesucht wurde. Sie landete an, zog das Kajak aus dem Wasser, verbarg es im Ufergebüsch und richtete ihr Lager ein. In der Dämmerung schob sich die weiße Scheibe des Mondes in den tief dunkelblauen Himmel, den mehr und mehr Sterne sprenkelten. Auf dem Gaskocher machte sie Kaffeewasser heiß. Sie legte beide Hände um den Becher und schaute hinauf zu den grauen Flecken auf der Mondoberfläche.
Der Bräutigam, der die Pferde so sehr liebte als sei er verrückt, war nicht gekommen. Er hatte sie stehen lassen wegen dieser Schlampe. Deshalb war sie damals zusammengebrochen. Während die 25. Olympischen Spiele in Barcelona ohne sie eröffnet wurden, hatte sie besinnungslos und mit zerflossener Seele auf den Trümmern ihres Lebens gelegen. Zehn Jahre war das her, aber die Wunde hatte sich nicht verschlossen. Sie eiterte und schwelte in ihrer Seele vor sich hin und überschwemmte sie mit rotem Blut. Sie wusste, wo der Ripper zuschlagen würde. Sie hatte lange gebraucht, um es herauszufinden, aber sie hatte es herausgefunden. Und heute Nacht würde er zum letzten Mal in seinem Leben zuschlagen.
Als es an der Zeit war, holte sie aus einem der Packsäcke den Gürtel mit der Pistole und dem Messer, legte ihn an und machte sich in einem leichten Trab auf den Weg durch die Felder. Sie kannte das Terrain gut. Als sie den Tatort des Rippers ausspioniert hatte, war sie auf den Feldwegen zwischen der Oker und der Koppel mit dem Mountainbike herumgerast.
An der Straße wartete sie in einem Gebüsch, bis keine Autoscheinwerfer mehr zu sehen waren. Sie huschte über den Asphalt, nutzte jede Deckung, jeden Schatten der Bäume und Büsche, bis sie den Feldweg erreicht hatte, der zu der Koppel führte. Es war noch zu früh und sie verbarg sich in der Dunkelheit eines Gebüsches und wartete. Nervös schaute sie immer wieder auf die Uhr, kontrollierte mehrmals die Pistole. Ihr wurde kalt, und das Zittern ihres Körpers stachelte die Wut weiter an, bis sie es kaum mehr abwarten konnte.
Sie schlich den Weg entlang, erreichte die Koppel, auf der das Pferd stand, das sich der Ripper als nächstes Opfer auserkoren hatte. Eine hübsche, schwarze Hannoveraner Stute. Sogar jetzt, im kalten Mondlicht, glänzte ihr Fell. Die Stute hatte sie längst gehört und schaute mit zuckenden Ohren in ihre Richtung.
Unsichtbar im tiefen Schatten eines Baumes versteckt blieb sie stehen, schaute sich um, horchte in die Dunkelheit. Immer noch nichts. Rasch ging sie am Zaun entlang bis zum Tor, öffnete es und betrat die Wiese. Vorsichtig näherte sie sich dem großen Pferd, das sie skeptisch mit einem schwarzen, glänzenden Augapfel abschätzte. Etwa fünf Schritte vor dem Tier blieb sie stehen.
»Na komm, Pferdchen. Ich tue dir nichts«, flüsterte sie und streckte die Hand aus. »Na ganz ruhig. Komm, meine Süße. Ich habe hier was für dich. So was kriegst du bestimmt nicht alle Tage.« Sie zog das Zuckersäckchen hervor, nahm drei Stücke heraus und hielt sie dem Pferd auf der flachen Hand entgegen. »Na komm, Pferdchen. Ist lecker. Echter Zucker.«
Die Stute streckte den Kopf nach vorn, witterte und schnaubte, aber sie legte die Ohren nicht an. »Ganz ruhig«, flüsterte sie. »Ja, so ist’s brav.«
Behutsam näherte sich das große Tier, bis es mit den weichen, pelzigen Lippen ihre Handfläche berührte, um die Zuckerstückchen aufzunehmen. »Na, möchtest du noch mehr?«, fragte sie und tätschelte den Hals des Tieres. Als Antwort beschnüffelte die Stute das Zuckersäckchen. Sie drehte die Hand und ließ den restlichen Zucker auf die Wiese fallen. Als das Pferd den Kopf senkte, zog sie die Pistole.
Weder in Eickenrode noch in Rietze hörte man den Schuss. Ein grässlicher Laut kam aus dem Pferd, als es einen Satz zu machen versuchte und dann zusammensackte. Weinend steckte die Frau die Tokarew in das Holster zurück.
Tödlich verletzt lag die Stute mit zuckenden Beinen am Boden und atmete hysterisch. Der Körper des Tieres zuckte. Die großen dunklen Augen waren panisch aufgerissen, so dass das Weiß der Augäpfel im hellen Schein des Mondes aufblitzte. Die Zunge leckte hilflos in der Luft herum und roter Schaum quoll unter den Lefzen hervor. Der Bräutigam hatte die Pferde geliebt und die Pferdemädchen bestiegen. Eines nach dem anderen.
Die Frau zog das Jagdmesser aus der Scheide. Die Pferdemädchen hatten ihr alles genommen: die Olympiade und den Bräutigam.
Unter Tränen setzte sie die Spitze des Messers unterhalb des Brustbeins des Tieres an, spannte die Muskeln und stieß die Klinge mit einem Ruck knirschend durch Haut und Knorpel tief in das Pferd hinein. Der mächtige Körper versuchte sich aufzubäumen, aber der Kreislauf der Stute kollabierte und schickte sie in eine erlösende Ohnmacht. Der riesige Brustkorb hob und senkte sich in schnellen, flachen Atemstößen.
Aber sie durfte sich nicht rächen, den Bräutigam und die Mädchen töten.
Das Pferd gurgelte und zuckte krampfartig zusammen. Sie umklammerte mit beiden Händen den Griff des Messers und säbelte mit kräftigen Schnitten den Leib des Tieres auf.
»Man darf den Menschen nichts tun«, flüsterte sie. »Man darf sie nicht ausweiden. Den Mädchen darf man nicht eines ihrer verlogenen Haare krümmen. Die müssen am Leben bleiben, die Pferdemädchen und der Bräutigam! Sonst kommt man in des Teufels Küche. Und wer will da schon hinein?«
Das warme Blut der Stute lief ihr über die Hände und salzige Tränen über ihr Gesicht. Das Pferd musste so unerträglich leiden. Denn nur dann würden auch die Pferdemädchen leiden, und der Pferdenarr, der ihr Bräutigam gewesen war.
Sie werden hysterisch kreischen. Brüllen, sich erbrechen, ohnmächtig umfallen, wenn sie von dem qualvollen Tod des Pferdes erfahren. »Sie sollen sich ihre beschissenen blauen Augen aus dem Kopf heulen«, flüsterte sie. »Sie sollen Angst haben um ihre großen Pferdepuppen. Richtig, richtig Angst! Sie sollen leiden …« Mit beiden Händen riss sie die Bauchdecke des Pferdes auf. »… so wie du. So wie ich.« Das sich windende Gekröse glitt aus dem aufgeschlitzten Bauch heraus. Auch sie würden sich krümmen und winden wegen der unbegreiflichen Machtlosigkeit, die in ihren Mägen wüten würde. Bis auch sie am Boden zerstört mit zerflossenen Seelen auf den Trümmern ihres Lebens lagen. Sie weidete die Pferdemädchen aus und den Bräutigam, der sie bestiegen hatte.
Das Herz der Stute schlug immer noch, als sie endlich von dem Tier abließ. Nur langsam kam sie wieder zur Besinnung, richtete sich auf und schaute schluchzend auf das arme Tier hinab, das sich langsam von einem Geschöpf in einen Kadaver verwandelte. Sie schluchzte und weinte, die Tränen sprudelten aus ihren Augen hervor und flossen die glühenden Wangen hinab. Die Pferdemädchen sind grausame kleine Biester. Tier- und Menschenquäler, allesamt. Das war ganz allein ihr scheußliches Werk. Ihretwegen hatte auch dieses Pferd so qualvoll sterben müssen.
Mit einem lauten Schluchzer holte sie Luft, wischte das Messer im Gras ab, steckte es in die Scheide und ging zum Fußweg zurück. Geduckt schlich sie durch das Gebüsch neben dem Weg zur Bundesstraße, dann durch die Feldmark zurück zu ihrem Lagerplatz in der Schlinge der Oker.
Erleichtert wusch sie sich im Fluss das Blut ab, reinigte penibel das Messer und ihre Kleidung. Dann kroch sie in ihren Schlafsack und fiel erschöpft in die bodenlose blutrote Kammer ihrer Seele, in der die zerfetzte Leiche des Bräutigams seit zehn Jahren vor sich hinmoderte.
Mit dem ersten Tageslicht erwachte sie, kochte Kaffee und aß ausgehungert zwei Portionen Müsli, Brot und Käse. Als es hell genug war, packte sie zusammen, belud das Boot und machte sich auf den Weg nach Celle, zu dem Punkt, an dem sie sich mit dem dicken Lutz verabredet hatte.
Zügig paddelte sie die Oker hinunter. Wann man das tote Pferd entdecken würde, wusste sie nicht. Aber es war auch vollkommen egal, denn die Polizei würde wieder nur nach einem Mann fahnden. Einem kräftigen, verrückten Mann in einem Auto auf der Straße, nicht nach einer einsamen Frau in einem Kajak auf dem Wasser.
Ein paar Stunden später paddelte sie kraftvoll auf der Aller entlang in Richtung Celle. Lutz war ehrlich froh, als sie ihn anrief und er ihre Stimme hörte.
Quelle: „Der Pferderipper“, aus: „Dem Verbrechen auf der Spur“, Hrsg. NDR Niedersachsen, Schlütersche, Hannover 2006, Seiten 199 –207.
Tatort: Querum / Walle
Über alle Flüsse
Es war nicht nur eine Kette unglücklicher Zufälle, die zu den tragischen Ereignissen geführt hatte. Es waren auch die bedrückenden Umstände der Trennung seiner Eltern, die den siebenjährigen Steffen zu der Tat veranlasst hatten, die seiner Mutter so großen Kummer bereitete. Beinahe müsste man sagen, es waren zwei Jungen, die den Plan geschmiedet hatten. Aber der Reihe nach. Es begann früh am Morgen eines sonnigen Karfreitags…
Steffen erwachte gegen fünf Uhr morgens mit einer erheblich schlechten Laune. Mürrisch wälzte er sich im Bett herum. Der neue Freund seiner Mutter entpuppte sich immer mehr als echter Kotzbrocken. Dem Geld und den Süßigkeiten, die er ihm in den ersten Tagen zugesteckt hatte, waren nur Meckereien gefolgt. Gestern Abend hatte er Steffen sogar verboten, während des Abendbrots Fluch der Karibik 3 zu gucken. Steffen und sein Freundbruder Kevin hatten keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als eine Kreischattacke loszulassen, bis seine Mutter ihn ins Kinderzimmer zerrte.
Mürrisch kroch Steffen aus dem Bett und krabbelte zu dem Playmo-Piratenschiff hinüber. Er schob das Schiff ein paar Mal über den Teppich, aber das wurde ihm schnell langweilig und so griff er nach der Zwille, die sein Vater aus einer handlichen Astgabel und ein paar Einweggummis für ihn gemacht hatte. »Du schießt aber nur mit den weichen Plastikkugeln, hörst du«, hatte sein Vater gesagt und ihm einen Beutel davon gegeben. Aber vor ein paar Tagen hatte Steffen im Bastelkeller herumgestöbert und ein Tütchen mit Stahlkugeln gefunden. Damit machte das Zwilleschießen viel mehr Spaß. Wenn die Stahlkugeln auf das Schiff knallten, brachen Teile davon ab, und er musste aufpassen, dass er es nicht vollkommen kaputt schoss.
Beim Einsammeln der verschossenen Stahlkugeln fiel Steffen sein Lieblingsbuch in die Hände. Ein großes Piratenbuch mit tollen Bildern und einer spannenden Geschichte. Mit geblähten Segeln gingen die Piratenschiffe aufeinander los. Die Kanonen spuckten Feuer und Rauch. Die Kugeln zerfetzten die Segel. Ein Schiff wurde geentert. Ein paar Seiten weiter wurde ein Beiboot zu Wasser gelassen und die Piraten ruderten mit einer dicken Schatzkiste an Bord auf eine Insel zu, dann in eine Bucht hinein und einen Fluss hinauf, wo sie den Schatz versteckten. Boa, ey, ein Piratenschatz, meinte Freundbruder Kevin.
»Das wär’ was«, dachte Steffen. »Abhauen. Und einen Piratenschatz finden«. Hinter dem Haus, am Ende des Gartens, floss ein Bach entlang, der Wabe hieß. Steffen durfte da nie alleine hingehen. Alle Erwachsenen waren der Meinung, das sei zu gefährlich. Aber Steffen war sauer. Auf seine Mutter und den Kotzbrocken. Er würde abhauen und den Schatz finden.
Zum Geburtstag hatte er ein blau-gelbes Schlauchboot vom Großvater bekommen. Es war winzig und gerade gut genug, um im Teich bei Bienrode zwischen den Badenden herumzudümpeln. Seit dem letzten Sommer lag es, zusammen mit der Pumpe und zwei Paddel, die man zusammenstecken konnte, unter der Kellertreppe.
Er holte das Boot und schleppte es raus auf die Terrasse. Dann packte er für die Fahrt zum Piratenschatz Schokolade, Gummibärchen, Kartoffelchips und eine Flasche Cola in seinen kleinen roten Rucksack. Er zog die Piratenverkleidung vom Karneval an, steckte die Zwille zu dem Gummisäbel in den breiten Gürtel und warf seine Jacke über.
Vom Frühjahrsregen war der Bach ziemlich angeschwollen. Flott pumpte er sein Boot auf und schon schwamm es auf dem Wasser. Steffen legte alle Sachen hinein, dann gingen er und sein Freundbruder Kevin an Bord. Er nahm ein Paddel zur Hand, aber der Bach war so eng und schmal, dass er damit mehr die Uferböschung durchpflügte, als dass er wirklich paddelte. Trotzdem kam er voran und das Piratenboot trudelte langsam den Bach hinab.
*
Nachdem Steffens Mutter aufgewacht war und festgestellt hatte, dass ihr Sohn sich nicht in seinem Zimmer befand, machte sie sich große Sorgen. Zusammen mit ihrem neuen Freund durchsuchte sie aufgeregt das Haus und den Keller, die Garage und den Garten. Dann noch einmal den Keller, das Haus und die Garage. Sie suchten den Garten und das Stück Land bis zur Wabe ab und schauten auf die Straße. Aber der Junge blieb verschwunden. Die Mutter lief aufgeregt zu den Nachbarn. Sie rief ihre Eltern an, raste mit dem Fahrrad durch ganz Querum, telefonierte mit Freunden, fragte hier, fragte dort, aber niemand hatte ihr Kind gesehen. Der neue Freund rief die Polizei an.
*
Die Frühlingssonne brannte vom Himmel herab. Die Blätter der Bäume hatten sich noch nicht ganz entfaltet, und die Sonnenstrahlen stachen auf das Land, das Wasser und auf das winzige Schlauchboot. Steffen hatte das Piratentuch mit dem weißen Totenschädel über den Kopf gezogen und eine schwarze Klappe bedeckte sein linkes Auge.
Tapfer hatte er sich Meter für Meter durch den engen Bach gekämpft, und Freundbruder Kevin hatte gemeint, wenn sie hier erstmal raus wären, würde es besser werden. Er hatte recht. Das Boot wurde aus dem engen Bach hinaus und in einen größeren Wasserlauf hinein getrieben, der mit einer viel stärkeren Strömung dahinfloss. Es schlingerte herum und drehte sich um die eigene Achse, ehe Steffen es mit dem Paddel zähmen konnte. Er glitt unter einer Eisenbahnbrücke hindurch, dann ging es ein ganzes Stück geradeaus bis zu einer gebogenen Fußgängerbrücke aus Holz. Auf der Brücke stand ein Pärchen mit einem Hund. Die Frau winkte ihm zu, und als Steffen unter der Brücke hindurch fuhr, sagte der Mann: »Oh, der böse Schunter-Pirat, jetzt wird’s aber gefährlich.«
Steffen sagte nichts, denn nur wenn er sich auf das Paddeln konzentrierte, kam das Boot gut voran. Aber es war anstrengend. Manchmal ließ er sich einfach von der Strömung tragen und beobachtete die Enten, die in der Nähe des Ufers herumschnäbelten. Da!, rief Freundbruder Kevin. Das sind die Feinde! Schiff klar zum Gefecht! An die Kanonen! Gebt ihnen Saures! Steffen zog die Zwille aus dem Gürtel und legte eine Stahlkugel in die Schlaufe. Er spannte das Gummi, zielte auf eines der feindlichen Schiffe und ließ los. Die erste Kugel zischte ins Wasser.
*
Nach einer halben Stunde hielt ein Streifenwagen vor dem Haus. Während die Beamtin Steffens aufgebrachte Mutter befragte, zeigte der neue Freund dem anderen Polizisten Steffens Zimmer und den Garten. Sie sahen das halb zerstörte Playmo-Piratenschiff und das aufgeschlagene Piratenbuch, zogen aber keine Schlüsse daraus.
Steffens Mutter und die Polizistin stellten fest, dass Steffens kleiner roter Rucksack, eine Jacke und ein paar Schuhe verschwunden waren. Nur das Handy lag in seinem Zimmer. »Der ist doch abgehauen«, sagte die Beamtin. »Hatten Sie Streit?« Steffens Mutter sank weinend auf das leere Kinderbett und erzählte mit gebrochener Stimme, was am Abend vorher geschehen war. Die Beamtin ließ sich Fotos von Steffen zeigen, ging zum Streifenwagen und gab eine Beschreibung des Jungen an die Zentrale durch.
*
Die zweite Kugel traf das feindliche Schiff mit voller Wucht. Der Kopf der Ente wurde nach hinten geschleudert. Ein Auge flog heraus und für einen Moment stach ihr Schnabel kerzengerade in die Luft, bevor der Hals zur Seite knickte und ihr Kopf im Wasser versank. Ein sauberer Schuss, Kapitän, meinte Kevin.
Steffen erschrak. Das hatte er nicht gewollt. Ganz sicher nicht. Auch wenn die Stahlkugel die Ente nicht getötet hatte – jetzt würde sie mit Sicherheit ertrinken. Er musste sie retten. Sofort. Schnell. Höchste Alarmstufe.
Hektisch paddelte er zu der Ente hin, beugte sich über den Rand des Bootes, griff nach dem Tier, erwischte es an den Schwanzfedern und zog es aus dem Wasser.
Ein wenig Blut sickerte aus der leeren Augenhöhle, aber die Füße zuckten, und Steffen glaubte, dass das Tier noch lebte. Wir haben einen Schiffbrüchigen an Bord, Kapitän Steffen, meinte Kevin. Es ist ein Mädchen. Sie heißt – Ente.
*
Die Sonne stand hoch am Himmel, als viele aufgebrachte Nachbarn halfen, in Querum und Umgebung nach dem vermissten Jungen zu suchen. Man schaute in die Schunter, Streifenwagen fuhren langsam am aufblühenden Querumer Forst vorbei, während Steffens Mutter weinend und mit einem Foto in den Händen zu den Pferdewiesen an der Wabe hinunterlief, durch die Kleingärten eilte und jeden Menschen, den sie traf, nach ihrem Sohn befragte.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739351018
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Juni)
- Schlagworte
- Kurzkrimis Mord auf der Oker Braunschweig Krimi Stories OKER Pferderipper Harzkrimi Psychothriller Noir Erzählungen Kurzgeschichten