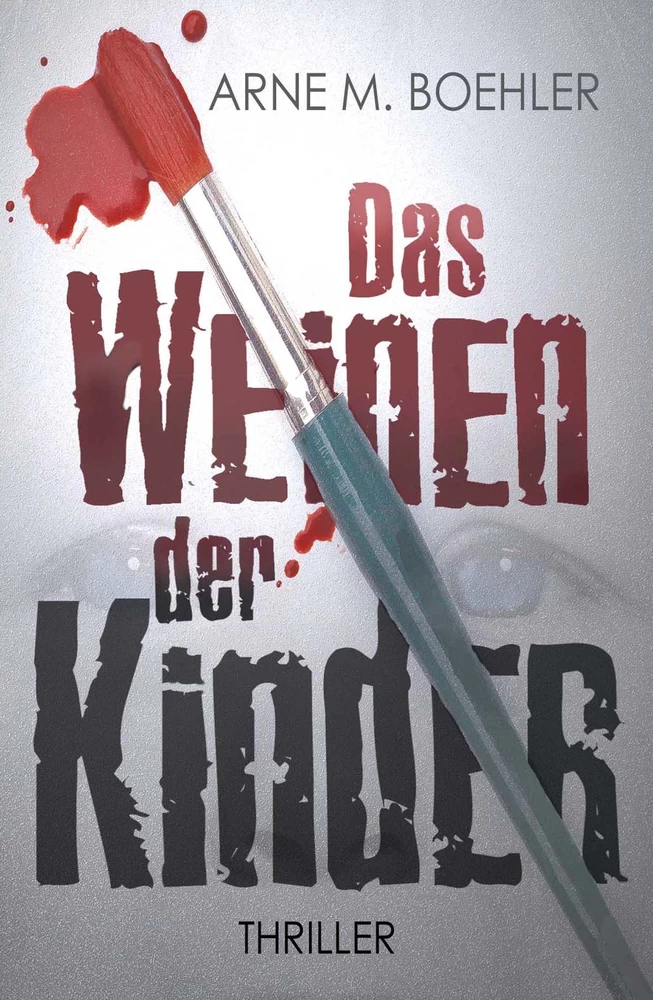Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Table of Contents
1. Kapitel
Das Bett der Wiltach war übervoll vom Regen der vergangenen Tage und eisiger Wind wehte von Osten das Flussufer entlang. Eine trübe Brühe, kaum Wasser zu nennen, wälzte sich Richtung Stadtmitte, dürftig beleuchtet von den wenigen gelben Laternen am Uferweg. Dort war um diese Uhrzeit keine Menschenseele mehr unterwegs.
Die Brücke über den Fluss war wegen Bauarbeiten abgesperrt. Dennoch wartete auf der mächtigen Stahlkonstruktion aus der Gründerzeit ein Mann ungeduldig auf die Person, mit der er sich verabredet hatte. Er hatte seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen und fror.
Zu seinem Erstaunen hatte Yvonne von Laatz zugesagt, ihn zu treffen. Das war unvorsichtig von ihr, denn sein Trick war unbeholfen gewesen und fadenscheiniger als die Unterhosen seiner Mutter. Er hatte nur ein paar wolkige Andeutungen gemacht, von einem russischen Kunstwerk aus obskurer Herkunft, das er gerne an den Mann bringen wolle. Und da sie gerade hier vor Ort sei und außerdem eine Koryphäe auf dem Gebiet, hätte er gerne ihre Einschätzung gehört. Er würde sich auch nicht lumpen lassen, falls ein Verkauf zustande käme.
Sie hatte ihm das Ammenmärchen geglaubt, möglicherweise aus Geldgier, viel wahrscheinlicher aber, weil sie ihre professionelle Neugier nicht zähmen konnte und sehen wollte, welchen Schund er feilbot.
Statt einer russischen Ikone trug er allerdings eine nicht registrierte P229 unter seinem Mantel, eine kompakte, leicht zu versteckende Pistole der Firma Sig Sauer.
Und seinen Hass natürlich. Auf das gefühllose Monster, das sein Leben verwüstet hatte.
Die Hochschullehrerin ließ sich Zeit. Als sie zehn Minuten überfällig war, wollte er sich schon zurückziehen. Doch dann sah er, wie sich ein Schatten aus dem Dunkel des Brückenpfeilers bei den östlichen Wiesen löste und im Schein der Laterne Gestalt annahm.
Sie musste es sein, denn sie trug das Erkennungszeichen unter dem Arm, das er ihr vorgegeben hatte, eine Ausgabe des Wiltheimer Anzeigers.
Das herzlose Monster kam direkt auf ihn zu, eine kleine, zierliche Gestalt in Trenchcoat und Jeans. Die Professorin. Kuchen-Yvonne.
Viele Stunden hatte er versucht, sich einzureden, dass sie unschuldig war, dass jeder sein Schicksal selbst in der Hand hatte, und am Ende hatte er die selbstgestrickte Mär sogar beinahe geglaubt. Beinahe. Dann hatte sein zutiefst gekränktes Ich obsiegt. Frau Professor sollte büßen für das, was sie ihm angetan hatte, ihm und seiner Familie. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Er wollte Vergeltung.
You can’t have your cake and eat it, hatte sie gesagt. Du kannst deinen Kuchen nicht gleichzeitig essen und behalten. Triff eine Entscheidung. Das hatte sie mit ihrer beschissenen Metapher gemeint und ungerührt niedergemäht, was ihm sein Liebstes gewesen war.
Tausendmal verfluchte Kuchen-Yvonne.
Sie kam näher und sah sich suchend um.
Er trat aus dem Zwielicht des Portalturms und hob die Hand.
Yvonne von Laatz kam langsam auf ihn zu und erwiderte den stummen Gruß. Sie trug ein Kopftuch und hatte einen Schal um den Hals geschlungen, den sie sich über den Mund bis zur Nase hochgezogen hatte, um sich vor dem grimmigen Wind zu schützen, der böig anschwellend über den Fluss fegte.
»Frau von Laatz?«
Sie blieb fünf, sechs Schritte entfernt von ihm stehen und nickte. Legte den Kopf zur Seite und musterte ihn.
»Wo haben Sie das Bild?«
»Ich habe es nicht«, sagte er. Der Ostwind riss die Worte mit sich fort.
»Weshalb sind wir dann hier?«, fragte sie.
Ihre Stimme klang rau und unattraktiv durch den Schal. Anders als er sie sich vorgestellt hatte. Wenn sie Angst verspürte, dann verbarg sie diese gut. Leute aus ihrer Schicht wurden mit der Gewissheit geboren, dass man jedes Problem lösen kann. Notfalls mit Geld, alles nur eine Frage des Preises, nicht wahr?
Er zog die Pistole hervor.
»You can’t have your cake and eat it«, sagte er langsam und richtete den kurzen Lauf der Waffe auf sie.
Sie zeigte keine Regung. Ein Windstoß pfiff durch die Stahlpfeiler und ließ ihren Mantel flattern.
»Eine Englischlektion mit Pistole? Das ist mal was Neues. Wollen Sie Geld?«
Sie griff in die Tasche und warf ihm ihre Geldbörse vor die Füße.
»Falls es um das Museum in Dürrweiding geht: Ich bin die falsche Ansprechpartnerin. Ich berate Herrn Wohlstedt nur. Wenden Sie sich an ihn.«
»Dein albernes Museum ist mir egal. Ich will, dass du bezahlst, für das, was du uns angetan hast.«
»Ich kenne Sie gar nicht!«
»You can’t have your cake and eat it, nicht wahr?«, sagte er. »Das bedeutet, dass man sich entscheiden muss, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde dich töten.«
Er machte vier schnelle Schritte auf sie zu und riss ihr den Schal vom Gesicht.
Ihr überraschter Aufschrei verflog im Heulen des Windes.
Er zuckte zurück.
»Wer bist du, verdammt nochmal?«, schrie er.
Ein kantiges, fast männlich wirkendes Gesicht mit hohen Wangenknochen war unter dem Schal hervorgekommen und sah ihn ausdruckslos an.
»Yvonne von Laatz, wer sonst?«
Das konnte nicht sein. Kuchen-Yvonne sah anders aus!
Er packte sie mit der Linken an der Gurgel und drückte zu, seine ganze Frustration in fünf Finger legend.
»Lüg mich nicht an! Wer bist du, verdammt nochmal?«
Ein dumpfer Schmerz in der Leiste ließ ihn zusammenfahren. Sie hatte ihm ihr Knie ins Gemächt gerammt.
Während er sich zusammenkrümmte, taumelte sie rückwärts - bloß weg von ihm - für einen fatalen Moment orientierungslos. Zwei Schritte. Drei. Dorthin, wo sich wegen der Bauarbeiten lediglich eine behelfsmäßige Brüstung befand. Ihr letzter Schritt fand keinen Halt mehr, ihre verzweifelt nach oben greifenden Arme erfassten nur Luft.
Sie verschwand lautlos in der Tiefe.
Seine Knie krachten, als er auf den Asphalt sackte. Wie konnte das sein? So einschneidend konnte das Alter doch ihr Gesicht nicht verändert haben!
In seinen Ohren begann es zu sausen.
Sie war es nicht. Sie ist es nicht gewesen!
Verzweifelt durchwühlte er ihre Geldbörse, fand den Ausweis. Da stand der Name, Yvonne von Laatz, neben dem Bild der Frau, die soeben in den Tod gestürzt war. Aber sie war es nicht gewesen, trotzdem nicht! Sie war nicht das Monster.
Friss oder stirb, brüllte der Ostwind ihn an und bleckte die Zähne.
Er hatte einen unschuldigen Menschen in die Fluten der Wiltach getrieben.
Seine verkrampften Finger lösten sich von der Pistole, die mit einem leisen Klacken auf die Teerdecke plumpste. Statt Vergeltung zu üben, hatte er Schuld auf sich geladen. Furchtbare Schuld. Und seine Gier nach Rache war noch immer ungestillt.
Mühsam erhob er sich. Setzte sich in Bewegung, weg von diesem schrecklichen Ort.
Er begann zu rennen, den stechenden Schmerz in den Knien ausblendend, hetzte von der Brücke wie ein angeschossenes Wild, hinaus in die Dunkelheit, wo das Maul der Nacht ihn verschluckte.
2. Kapitel
Der Flugbegleiter eilte ein letztes Mal durch den Airbus und kontrollierte, ob alle Passagiere ihre Gurte angelegt hatten. Anke Neuhaus beachtete ihn gar nicht, so sehr war sie in ihre verworrenen Gedanken versunken. Seit dem Telefonat mit Remigius Wohlstedt grübelte sie darüber nach, was er ihr hatte sagen wollen.
Sie solle sich nach ihrer Ankunft bei ihm im Geschäft melden, hatte er gesagt, unbedingt sofort! Es gehe um Leben und Tod. Anke kannte ihn lange genug und wusste, dass Remigius jede Mücke zum Mammut aufblies. Diesmal allerdings hatte sie einen Unterton herausgehört, der diesem Mann fremd war. Verzweiflung. Und dann, kurz bevor der Steward Anke wegen des noch immer nicht abgeschalteten Telefons ansprach, hatte Remigius noch Yvonne erwähnt.
Sie sei tot, hatte er gesagt. Ob Anke das mitbekommen habe? Vermutlich bei einem Überfall in einen Fluss gestürzt und ertrunken. Furchtbar nicht wahr? Und das sei alles seine Schuld.
Draußen zog das wolkenverhangene Erdinger Moos vorbei, als die Maschine beschleunigte und die Schwerkraft überwand.
Anke hatte den Kontakt zu Yvonne vor langer Zeit abgebrochen. War immer nur stumm an ihr vorbei gehuscht, wenn Yvonne bei Remigius in der Kunstgalerie erschien, alle Jubeljahre. Und vor wenigen Tagen, gut sechzehn Jahre nach dem Zerwürfnis wegen Niels und dem abrupten Ende ihrer Freundschaft, hatte Yvonne sie angerufen und komisches Zeug gestammelt. Und jetzt sollte sie Opfer eines Verbrechens geworden sein?
Die trübgraue Landschaft verschwand unter der Wolkendecke. Anke kuschelte ihr Gesicht in das Reisekissen, aber an ein Nickerchen war nicht zu denken.
Yvonne.
War da einem gekränkten Künstler der Kragen geplatzt und er hatte Rache genommen für einen ihrer famosen Verrisse? So musste es gewesen sein. Es grenzte an ein Wunder, dass das nicht schon viel früher geschehen war.
*
Die Zeit, die es dauerte, bis ihr Koffer auf dem Gepäckband des Kölner Flughafens erschien, nutzte Anke für einen Gang zur Toilette. Sie hatte das Bedürfnis ihr Aussehen zu überprüfen. Vielleicht deshalb, weil Holger kam, um sie abzuholen, und sie ihm zeigen wollte, was für ein Prachtstück sie immer noch war? Nein, das war natürlich Unsinn.
Dafür, dass sie sich ziemlich erschöpft fühlte, fand Anke ihr Spiegelbild durchaus in Ordnung. Die große, schlanke Frau mit den halblangen, blonden Haaren, die ihr müde entgegenlächelte, konnte noch ein wenig Lippenstift vertragen, etwas Rouge für den blassen Teint und Puder für die Augenringe, welche die randlose Brille kaum kaschierte. Für Anfang vierzig dennoch recht annehmbar.
Sie entdeckte ihren Trolley sofort, ein knallbuntes Plastikbonbon in einem Heer von grauen und schwarzen Koffern, zog ihn vom Band und ging den wohlbekannten Weg zur Ankunftshalle. Dort entdeckte sie die drei Wartenden, noch bevor sich die gläserne Schiebetüre öffnete. Sie standen in einem Pulk und erspähten Anke in der Flut der ankommenden Passagiere deshalb nicht sofort.
Die übergewichtige Teenagerin mit den langen schwarzen Haaren und der Kleidung in derselben, lebensfrohen Farbe starrte auf ihr Handy und schien den Trubel in der Wartehalle überhaupt nicht wahrzunehmen. Neben Cora stand als kunterbunter Kontrast ihre kleine Schwester, rothaarig, mit hellgrüner Regenjacke und Gummistiefeln in Pink. Die schmale Achtjährige musterte alle Ankommenden mit dem offenen, neugierigen Blick, den nur Kinder zustande bringen. Hinter ihr stand nicht Holger, sondern seine Mutter, die Hände auf den Schultern ihrer Enkelin abgelegt. Sie entdeckte Anke als Erste, stupste die Kleine an und zeigte auf sie.
»Mama!«
Mara hüpfte auf ihre Mutter zu und umarmte sie so stürmisch, dass Anke aufpassen musste, dass sie bei diesem Überfall nicht das Gleichgewicht verlor und nach hinten kippte. Anke beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie auf die Wange. Sie fühlte sich warm an, das Feuer ihres Haars duftete nach Zitrone.
Nur drei Tage ohne sie. Und so sehr vermisst.
Cora sah lediglich kurz vom Display des Smartphones auf, und als Anke ihr über den Kopf streichen wollte, drehte sie ihn weg.
»Hat dir jemand die Stimme geklaut?«
Ein genervtes Augenrollen bildete die einzige Antwort des Teenagers auf den misslungenen Scherz.
Gertrud reichte Anke mit einem nachsichtigen Lächeln die Hand. Du weißt doch, wie sie ist, zurzeit.
»Ich habe euch was mitgebracht.«
Anke kramte in den Taschen ihres Parkas und reichte ihren Töchtern je eine Packung Rahmkaramellen, die sie im Duty-Free-Shop in München gekauft hatte.
»Toll! Kann ich gleich eins haben?«
Mara machte sich umständlich daran, die weiße Tüte aufzureißen, aber ihre Finger rutschten immer wieder ab.
»Warte, ich helfe dir«, sagte Gertrud.
»Können wir erstmal zum Auto gehen, ja?«, sagte Anke.
Gertrud ließ die hilfreich ausgestreckte Hand wieder sinken.
»Wie du meinst.« Sie bedachte Mara mit einem entschuldigenden Blick.
»Wie war die Messe?«
»Anstrengend.«
»Und der Flug?«
»Sanft wie selten zuvor.«
Gertrud nahm ihr den großen Hartschalenkoffer ab und sie machten sich durch das Gedränge auf den Weg zum Parkdeck. Mara hopste um ihre Mutter herum wie ein Gummiball. Cora und ihre Großmutter gingen schweigend voraus.
»Wo ist eigentlich euer Vater?«
»Der Papa hat gesagt, sein Chef hat ihn anderufen, und er muss ganz schnell zu einem Mietding kommen! Mama, was ist das, ein Mietding?«, sagte Mara.
Cora ließ ein verächtliches Schnauben vernehmen. Immerhin schien es hinter ihrer unbeteiligten Teenager-Maske noch ein paar Gefühle zu geben.
»Er musste kurzfristig nach London«, informierte Gertrud sie. »Irgendeine wichtige Besprechung.«
»Aber er hat doch versprochen, dass er die Kinder zu sich nimmt, während ich in München bin.«
Gertrud fütterte den Parkscheinautomaten mit einem Schein.
»Du weißt doch wie die sind, bei seiner Bank«, sagte sie und nahm das Ticket entgegen.
Als sie bei Ankes Subaru ankamen, öffnete Gertrud die Heckklappe und Anke wuchtete den Trolley in den Kofferraum.
»Es war halt anders vereinbart, aber ich wundere mich über gar nichts mehr«, sagte sie.
»Ich weiß überhaupt nicht, was du immer hast! Die beiden sind doch gerne bei uns! Ist alles kein Problem. Und bei mir isst Mara auch immer ordentlich, nicht wahr, Schatz?«, sagte Gertrud.
Sicher. Oma ist die Beste.
Aber was sollte Gertrud auch sonst sagen? Holger war ihr einziger Sohn, und Anke konnte sich nicht erinnern, dass sie ihn jemals kritisiert hatte, obwohl es Anlässe dazu reichlich gegeben hätte.
»Möchtest du fahren?« Gertrud hielt Anke den Zündschlüssel hin.
Die winkte ab.
Als Gertrud den Wagen startete und ruckelnd aus dem Parkhaus zirkelte, bereute Anke bereits, den Beifahrersitz gewählt zu haben. Sie steckte die Schnalle des Gurtes ins Schloss, doch er rastete nicht ein. Sie versuchte es ein zweites Mal, mit dem gleichen Ergebnis.
Nicht schon wieder. Der Wagen war doch erst in der Werkstatt gewesen! Egal, jetzt musste es erstmal ohne Anschnallen gehen. Auf dem kurzen Stück und bei Omas gemächlicher Fahrweise bestand ohnehin keine Gefahr für Leib und Leben.
»Diese Professorin von Laatz ... kanntest du die nicht?«, fragte Gertrud nachdem sie endlich die gelbschwarze Schranke passiert und sich in den nachmittäglichen Verkehr eingereiht hatten.
»Ja, ich habe sie aber viele Jahre nicht gesehen. Wieso?«
»Sie ist tot. Ertrunken. Hast du davon nicht gehört?«, sagte Gertrud im Plauderton.
Es klang surreal. Wo Anke doch erst vor wenigen Tagen mit Yvonne gesprochen hatte.
»Die Zeitungen sind voll davon«, fuhr Gertrud ungerührt fort. »Magst du was darüber hören?«
Von dir bestimmt nicht. Und auch nicht jetzt.
Anke schüttelte knapp den Kopf und wendete den Blick. Beobachtete die Regentropfen, die an der Seitenscheibe in fingerdicken Rinnsalen nach unten strebten wie die Tränen auf der Wange eines weinenden Kindes. Yvonnes seltsamer Anruf hallte in ihrer Erinnerung nach ...
Sie kommt gerade aus der Dusche, in den Bademantel des Münchener Hotels gehüllt und mit einem weißen Handtuch-Turban auf dem Kopf, als das I-Phone klingelt.
»Och, bitte nicht!«
Das Display zeigt eine unbekannte Nummer. Anke drückt den Anruf weg. Sie hat heute auf der Messe genug gesprochen, der Tag ist lang gewesen und sie will sich vor dem Einschlafen gemütlich eine Stunde im Bett lümmeln und den neuen Roman von Stephen King lesen, den sie auf ihren Reader heruntergeladen hat.
Das Telefon klingelt wieder. Dieselbe Nummer. Vielleicht ist der Anruf wirklich dringend. Die Kinder sind übers Wochenende bei Holger, hoffentlich ist ihnen nichts passiert?
Widerwillig, aber gleichzeitig Böses ahnend, drückt sie auf den grünen Hörer.
»Hallo?«
»Schön, dich zu hören.« Die Stimme am anderen Ende ist gefärbt von Rotwein und dem Rauch einer Milliarde Zigaretten. Ein Klang, den Anke sofort wiedererkennt.
»Yvonne«, flüstert sie. Nur dieses eine Wort. Und aus dem Nichts meldet sich das Ziehen in ihrem linken Bein wieder, die längst verheilte Wunde im Oberschenkel, wo Yvonne mit dem Küchenmesser hineingestochen hat, vor sechzehn Jahren.
Anke beginnt zu zittern, kann den Widerhall der längst verdrängten Ereignisse kaum ertragen. Freude und Hass liefern sich einen kurzen, erbitterten Zweikampf in ihr.
»Das mit Holger tut mir leid«, sagt die Reibeisenstimme. Ganz weit weg.
Woher hat Yvonne überhaupt diese Nummer? Der Hass gewinnt das Duell um Ankes Herz.
»Ich werde darüber hinwegkommen«, sagt sie kalt. »Hast du getrunken, Yvonne?«
»Nein, was spielt das für eine Rolle? Ich ... hör mir zu! Ich weiß, dass einiges schiefgelaufen ist zwischen uns.«
So kann man das ausdrücken. Ein zwanzig Zentimeter langes Kochmesser zum Beispiel. Bis ans Heft ins Bein gestoßen. In Ankes Bein, wohlgemerkt.
»Und ich erwarte auch keine Jubelschreie von dir, weil ich jetzt anrufe.«
»Was willst du?«
»Ich ... ich weiß es auch nicht. Es war einfach so ein Gefühl. Habe von dir geträumt. Und von deinen beiden Kindern. Ich ..., ach, vergiss es!«
Es klingt seltsam, wenn diese Frau Ankes Kinder erwähnt, die sie nie zu Gesicht bekommen hat. Das geisterhafte Ziehen im Bein wird heftiger. Nichts hat sich verändert. Yvonne ist immer noch das gleiche Miststück wie damals.
»Um was geht es?«
»Ich ... ach Anke, ich ...«
Immer noch dieselbe Drama-Queen.
»Ich habe nicht mehr lange zu leben.«
Anke hat beim allerersten Ton gespürt, dass der Anruf zu nachtschlafender Zeit nicht nur dazu dient, nach vielen Jahren einfach mal wieder hallo zu sagen.
»Metastasen im ganzen Körper. Höchstens noch drei Monate.«
Obwohl Anke Yvonne zu hassen gelernt hat, trifft sie die Offenbarung mit ungeahnter Wucht. Doch wieder gewinnt ihr eigener Schmerz die Oberhand.
»Ich wünsche dir... Kraft«, ist alles, was sie herausbringt.
»Da ist noch etwas, Ännchen …«
Anke saugt tief Luft ein.
Ännchen. So hat Yvonne sie früher genannt. Vorher.
Vor Niels.
»Ich muss weiterarbeiten, Yvonne.«
Anke öffnet das Fenster und lehnt sich hinaus. Es ist kalt für eine Nacht im Oktober, aber die Herbstluft fühlt sich gut an. Ihr Atem zieht in langen, weißen Schwaden hinaus in die Nacht und löst sich dann in der Kälte auf.
Die Anruferin wird von einem Hustenanfall geschüttelt, der Anke allein vom Zuhören weh tut. Sie will ansetzen, das seltsame Gespräch abzuwürgen, da kommt Yvonne ihr zuvor:
»Ich will reinen Tisch machen, bevor es mich erwischt.«
»Okay ...?«
Die Professorin schweigt.
»Yvonne?«
»Ich habe mit Holger geschlafen. Als du mit Cora schwanger warst. Und noch ein paarmal danach.«
Das hat sie nicht soeben gesagt, oder? Das darf sie nicht gesagt haben! Holger hat unzählige Weibergeschichten auf dem Kerbholz. Aber nicht mit Yvonne. Das passt nicht zusammen.
Ankes Kopf wird heiß.
»Ich weiß nicht, warum, aber wir haben es getan. Und ich bin nicht besonders stolz darauf, das kannst du mir glauben. Und es tut mir leid. Ich ...« Ein weiterer Hustenanfall.
Anke widersteht dem Impuls, sofort aufzulegen, unterdrückt das Übelkeitsgefühl, das sich ihrer bemächtigt. Der Oberschenkel pocht wild.
»Sollen wir uns treffen?«, fragt Yvonne.
»Anke? Bist du noch dran?«
*
»Anke?«
Gertruds Stimme holte sie aus der Erinnerung zurück.
»Ja? Sorry...«
Obwohl erst Nachmittag war, herrschte auf den Straßen Kölns zäher Verkehr, und der herbstliche Wolkenbruch verschlechterte die Sicht erheblich.
»Ich sagte, ich habe Apfelkuchen gemacht.« Gertrud musste die Stimme etwas erheben, um gegen den Lärm des Regens anzukommen, der auf das Dach des Wagens trommelte.
»Danke, das ist lieb. Aber ich müsste nochmal kurz in die Galerie«, sagte Anke.
»Oh, Mama! Bitte fahren wir zu Oma und Opa!«, ertönte es mümmelnd vom Rücksitz. Anscheinend hatte Mara, die zurzeit beängstigend wenig aß, sich gleich die Hälfte der Bonbons in den Mund geschoben.
»Ach, Schätzchen, ich muss Remigius noch ein paar Unterlagen vorbeibringen.«
Im Gegensatz zu Anke war Gertrud eine perfekte Köchin und Bäckerin und ihr Apfelkuchen eine Delikatesse.
»Warum machen wir es nicht so: Ihr fahrt mit zu Oma, ohne mich. Ich komme dann mit dem Taxi nach und hole euch beide und den Wagen dort ab.«
Gertrud stieß ein missbilligendes Geräusch aus.
»Kann das nicht bis morgen warten?«, fragte sie.
»Es geht nicht anders«, erklärte Anke. »Abgemacht?«
Gertrud zuckte mit den Schultern und starrte auf die Straße.
»Gut, danke. Ich hole euch nachher bei Oma ab, okay? Aber nicht zu viel Kuchen essen, wir gehen noch zu McDonald's.«
»Das ist so typisch für dich!«, sagte Cora.
Es waren ihre ersten Worte seit Ankes Ankunft. Demzufolge hatte sie ihre Stimme nicht an durchreisende Händler verkauft. Immerhin.
Die Tüte mit Coras Bonbons klatschte auf Ankes Schoß. Ungeöffnet.
»He, was soll das?«
»Ich bin allergisch gegen Nüsse, schon vergessen?«
Von der Fahrerseite kam ein empörtes Zischen, das nicht Cora galt.
Willkommen daheim.
3. Kapitel
Vierhundert Kilometer von Köln entfernt knallte Niels Sörensen den Hörer auf das altmodische, schwarze Telefon in seinem Atelier und drosch mit dem Fuß einen leeren Farbkübel gegen die Wand, dass es krachte.
»Du bist so Scheiße!«, brüllte er den Apparat an, und verfiel in seine Muttersprache: »Så utroligt lort!« So unglaublich Kacke.
Er meinte nicht das Gerät, sondern seine schottische Assistentin Fiona McCarthy, die offenbar nicht in der Lage war, ein paar technische Kleinigkeiten für die bevorstehende Versteigerung in Brüssel auf die Reihe zu bringen.
Was war nur los mit ihr, in letzter Zeit? Wofür bezahlte er die dumme Pute, wenn er sich dann selbst um alles kümmern musste, verflucht nochmal?
Mit Anke wäre ihm das nicht passiert. Ja, Anke ...
Tief in seinem Innersten wusste er, dass er zornig auf sich selbst war, auf seine Unfähigkeit, sich zu konzentrieren und sich wieder seiner Lebensaufgabe zu widmen.
Seit wann ging das eigentlich so, mit dieser Malhemmung? Früher war er morgens ins Atelier gestürmt, wo fünf oder sechs unfertige Bilder nur darauf gewartet hatten, zu Ende gemalt zu werden. Bei mir fehlt noch Rot, schrie ihn dann ein Bild an, ein anderes brüllte: nicht dieses Blau! Und dann legte Niels los und malte. Tanzte zwischen den Leinwänden hin und her wie einst Fred Astaire, mit traumwandlerischer Sicherheit.
Vorbei.
Er sah aus dem Fenster der ehemaligen Papierfabrik, die er sich zusammen mit einigen anderen Künstlern zum Atelier umgebaut hatte. Jetzt, im Oktober, herrschten im Freien schon kühle Temperaturen und hier drinnen war es so kalt, dass ihn selbst mit dickem Strickpullover fror. Sogar sein Gehirn war tiefgekühlt. Was war nur mit der Heizung los? Die Misere hatte begonnen, als er vor einigen Monaten die Sache von Anke und Holger erfahren hatte. Seitdem produzierte er nur noch gequirlten Hühnermist.
»Lass die Energie fließen, so wie früher, dann wird es schon«, hatte Fiona versucht, ihn zu motivieren. Ihre hilflosen Tränen waren sogar durchs Telefon zu hören gewesen.
Statt rumzuheulen sollte sie ihn besser hart rannehmen. So wie Anke früher.
Anke. Immer wieder Anke.
Vergiss sie endlich. Du hast es selbst vermasselt.
Er seufzte. Fiona hielt keinem Vergleich mit Anke stand. Ohne auch nur ein einziges Bild gesehen zu haben, hatte dieses Arbeiterkind aus Glasgow in einem Interview geprahlt, dass die neue Werkschau ihm endgültig den Durchbruch bescheren und in die Top Ten der europäischen Maler katapultieren würde. Damit hatte sie die Erwartungen von Kritikern und Sammlern in stratosphärische Höhen geschraubt. Er selbst hatte jedoch keinen blassen Schimmer, wie er sie erfüllen sollte.
Mit Abscheu betrachtete er die Leinwand, an der er gerade gearbeitet hatte.
»Røv skidt«, murmelte er.
Genau das waren die Bilder, die er in verzweifelten achtzehnstündigen Arbeitstagen hinschmierte. Eselsdreck, nichts als stinkender Eselsdreck. Sein luftiger Pinselstrich, die kräftigen Farben, all seine Markenzeichen wollten nicht auf die Leinwand, obschon er verzweifelt mit neuen Materialien, Strukturen und Formen experimentierte. Alles, was dabei rauskam, war Schrott. Nichts von seiner früheren Wildheit zeigte sich, kein Anzeichen von dem Drama oder dem schockierenden Realismus, der ihn zum enfant terrible der deutschen Kunstszene hatte werden lassen. »Du unverschämter, dänischer Bastard«, hatte eine zwanzig Jahre ältere Kritikerin ihm am Rande einer Ausstellung einmal anerkennend zugeraunt und ihm mit einem anzüglichen Grinsen ihre Privatnummer in seine Hose gesteckt. Ein geiler Ritt war gefolgt.
Diese guten Zeiten waren vorbei.
Seine heutigen Motive lungerten gelangweilt auf den Leinwänden herum und sein flacher Pinselstrich entlockte gelegentlichen Besuchern nicht einmal mehr ein Gähnen. Gegen diese Seuche half weder Yoga noch Tantra. Er hatte beides mit Fiona ausprobiert. Auch literweise Whisky hatte keinen positiven Effekt, von Koks ganz zu schweigen. Es putschte ihn zwar auf, hatte jedoch schon vor vielen Jahren aufgehört, ihn zu beflügeln.
Niels starrte auf die Reiseprospekte, die Fiona angeschleppt hatte. Brauchte er tatsächlich einen Tapetenwechsel, eine radikale Veränderung, so wie sie vorschlug?
Das war doch Unsinn. Die vier Wochen Ayurveda auf den Azoren hatten ihn jedenfalls nicht zu einem besseren Maler gemacht.
Seine neue Freundin, Tanice, war ein Lichtblick gewesen. Aber bereits nach wenigen Wochen hatte er bemerkt, dass unter ihrem attraktiven Firnis eine gewöhnliche Durchschnittsfrau steckte.
»How many kids shall we have, baby?«, war die einzige Frage, die Tanice umtrieb, wenn sie nicht gerade recherchierte, wie häufig ihr Bild in Klatschspalten und Promi-Blogs auftauchte, wälzte sie Kataloge mit Babyklamotten.
Nein, danke. Ein bräsiges Familienleben kam für Niels nicht infrage, und Tanice’ Jugendlichkeit entzog ihm eher Energie, als dass sie ihm welche zuführte.
Zwei Frauen, zwei Fehlgriffe. Es war hoffnungslos.
»Lort«, flüsterte er noch einmal.
Er warf den Pinsel auf den Boden und pfefferte die Palette in die Ecke, wo sie gegen eine Batterie leerer Weinflaschen klirrte und mit der Farbseite nach unten zu liegen kam. Klar, wie auch sonst?
Was er in den vergangenen Stunden auf die Leinwand gekleckert hatte, war furchtbarer Schund, den ihm die Kritiker um die Ohren hauen würden. Bettvorleger statt Bastard. Er kickte die Staffelei ins Nirwana und beschloss, sich für heute geschlagen zu geben.
Vielleicht sollte er trinken? Oder vögeln? Tanice war in London auf irgendeiner Jetset-Party, aber die Nummer von Nightshades, dem Münchener Escort-Service, lag griffbereit.
Aber eigentlich hatte er keine Lust auf eine Hure. Ohne genau zu wissen warum, ging er in den ehemaligen Maschinenraum, den er als Archiv nutzte, und begann halbherzig in den unfertigen Bögen und Leinwänden zu stöbern. Es war doch nicht auszuschließen, dass sich unter seinen abgebrochenen oder verworfenen Werken unerkannte Juwelen befanden, oder? Bilder, die ihm die dringend benötigte Inspiration lieferten?
Die alten Werke waren noch größerer Bockmist als das, was draußen im Atelier stand. Er hatte diese Bilder aus gutem Grund niemals fertiggestellt, geschweige denn das Publikum damit belästigt.
Sein Blick fiel auf ein graues, großformatiges Objekt, das ganz hinten in der Ecke an der Wand lehnte, zur Hälfte verdeckt von unbenutzten Leinwänden und einem blauen Vorhang, der vor einer schmalen Lüftungsluke hing.
Er zwängte sich zu der Luke durch und hob den Stoff an. So ähnlich hatte seine Bewerbungsmappe an der Kunstakademie ausgesehen. War sie das? Er hatte sie viele Jahre unbeachtet bei jedem Umzug einfach mitgenommen, ohne ihren Inhalt erneut zu inspizieren. Es musste so sein, allerdings konnte er sich beim besten Willen nicht mehr genau daran erinnern, denn seine Studienzeit lag über zwanzig Jahre zurück und die wenigen Tage, an denen er damals nicht mit Alkohol und irgendwelchen Drogen vollgepumpt war, konnte man an einer Hand abzählen. Selige Jugendzeit.
Er zog die angestaubte Mappe heraus - sie war unerwartet schwer - und nahm sie mit ins Atelier. Dort hievte er sie auf einen großen Tapeziertisch und betrachtete sie. Ein flacher Fremdkörper aus einer anderen Galaxie, der das Licht des Raumes auf seltsame Weise aufzusaugen schien, gleichzeitig aber eine kalte, bösartige Energie an seine Umgebung abstrahlte.
Wollte er wirklich mit seinem Alter Ego konfrontiert werden? Mit seinem zwanzigjährigen, kokainverseuchten Ich und dessen unreifem Gekrakel, das vielleicht noch schlimmer war als die Lappen, die hoffnungsfrohe Bewunderer und Hobbymaler ihm manchmal zur Begutachtung vorlegten?
Niels waren ja heute bereits die Bilder peinlich, die er vor fünf oder zehn Jahren geschaffen und damals noch zu Spottpreisen verhökert hatte.
Er grinste. Auch diese Zeiten waren vorbei, zum Glück. Sein letztes Gemälde hatte für vierhunderttausend den Besitzer gewechselt. Vier. Hundert. Tausend. Für ein Bild! Der Preis war ihm äußerst schmeichelhaft vorgekommen. Wie konnte ein Stück von ihm beschmierte Leinwand so wertvoll sein?
Egal.
Die Mappe lag immer noch unberührt vor ihm. Er wandte sich von ihr ab, ging zum Schnapsregal, griff nach der Flasche mit dem Talisker und entkorkte sie. Der Whisky roch nach Medizin und schmeckte nach Torf und Rauch.
Zurück am Tapeziertisch öffnete er die Mappe. Warum fühlte sich das blassblaue Band, mit dem die beiden Deckel zusammengehalten waren, so heiß in seinen Fingern an? Warnte ihn etwa sein Instinkt, sich den alten Bildern zu nähern?
Er zögerte und ließ das Band fahren, war versucht, die Schleife wieder zuzubinden und den Ordner schnellstmöglich dorthin zurückzubringen, wo er ihn hergeholt hatte.
Er nahm einen weiteren, großen Schluck aus der Flasche und ließ den Whisky seine Kehle hinunterrinnen. Das rohe Feuer beseitigte seine Zweifel und mit einem Schwung öffnete er den Pappdeckel.
Kein Knall ertönte. Und es entfleuchte auch kein Schwefeldampf. Nur ein leicht muffiger Geruch stieg auf.
Zuoberst lag ein Aquarell. Es zeigte ein Stillleben mit Blumen – er konnte sich nicht erinnern, es jemals gemalt zu haben. Darunter kamen noch einige ähnliche Versuche zum Vorschein, und halbwegs ungelenke Aktstudien. Hatte er in seiner Jugend tatsächlich solchen Unsinn produziert? Es musste wohl so sein.
Er blätterte weiter, bis ein Ölbild erschien, ein Porträt, das er herausnahm, um es im Licht genauer zu betrachten. Es war, wie alle anderen Bilder in der Mappe, auf billiges Leinwandimitat gemalt worden und passte zu seiner Vermutung über die Entstehungszeit der Bilder. Als er im Teenageralter angefangen hatte, seine ersten Studien zu malen, hatte er sich in einem Schreibwarenladen in Aalborg solche Blöcke besorgt. Sie waren billig, aber für Anfänger halbwegs brauchbar.
Das Ölgemälde war eine Zumutung. Nicht weil es schlecht war, im Gegenteil. Es zeigte ein Kindergesicht. Einen kleinen Menschen in tiefstem Leid, so plastisch, dass Niels ein kalter Schauer den Rücken hinunterlief.
Er hatte sich in den letzten Wochen oft gefragt, warum er als Jungspund in die Kunstakademie aufgenommen worden war, bei seinem beschränkten Talent. Aber wenn er in seiner Jugend zu dieser Leistung fähig gewesen war, dann erübrigte sich die Frage.
Die folgenden Porträts in der Mappe übertrafen das erste noch. Alle stellten Traurigkeit und Kummer dar, aber doch so unterschiedlich und faszinierend, gleichzeitig jedoch auch dermaßen abstoßend in ihrer virtuosen Darstellung des Elends, dass Niels nach kurzer Zeit überwältigt war. Er legte die Blätter zurück in die Mappe und klappte den Deckel zu. Legte mit Nachdruck die linke Hand darauf, wie um zu verhindern, dass sich der Karton noch einmal von selbst öffnete.
Mit der anderen Hand griff er zur Schnapsflasche und trank gierig. Was hatte ihn veranlasst, diese Bilder zu malen? Porträts noch dazu, eigentlich gar nicht sein Sujet? Und wieso hatte er sie in der Mappe vergessen und niemals wieder hervorgeholt? Kokain hin oder her, aber so benebelt konnte er doch nicht gewesen sein, oder?
Der Whisky begann schnell zu wirken und der letzte Rest seines Erinnerungsvermögens ließ ihn im Stich. Er schüttelte den Kopf. Nahm einen weiteren Schluck.
Aus dem aufsteigenden Alkoholnebel waberte eine andere Frage in seinen Sinn: Welchen Weg musste er gehen, um die Quelle dieser Fähigkeiten erneut anzuzapfen?
Anke.
Unsinn!
Doch: Anke.
Warum eigentlich nicht?
Weil sie dir den Schuh in den Arsch treten wird, dass er drin stecken bleibt. Deshalb!
Es käme auf den Versuch an ...
Niels bekam nun doch Lust auf eine Hure. Ja, ein wenig vögeln würde ihm das Hirn freipusten.
Er ging zum schwarzen Telefon und wählte die Nummer. Auswendig.
»Ob Natascha heute Abend wohl ...?«
Seine Favoritin war frei.
»Wunderbar! Ich erwarte sie, wie üblich.«
Natascha sah Anke ein bisschen ähnlich, und wenn sie zusätzlich die randlose Brille aufsetzte, die Niels extra für die Treffen mit ihr besorgt hatte, war die Illusion perfekt. Zumindest mit ein paar Gläsern Talisker intus.
Der Abend war gerettet. Und dann würde man sehen.
4. Kapitel
Die Galerie Remigius Wohlstedt befand sich in der Kreuzgasse in der nördlichen Altstadt von Köln, nur einen Steinwurf entfernt vom Schauspielhaus, im Erdgeschoss eines schmucklosen, vierstöckigen Gebäudes aus der Nachkriegszeit. Als Anke den Laden aufschloss, hörte sie bereits die hohe, aufgeregte Stimme des Inhabers, der in sein Handy brüllte.
»Wie kannst du es wagen, mir so einen Unfug aufzutischen?« Beim letzten Wort sprühten kleine Spucketröpfchen aus seinem Mund.
Der gemaßregelte Anrufer schien sich zu verteidigen, kam aber nicht zu Wort.
»Das ist alles Schwachsinn!«, schrie Remigius in den Hörer, so dass die beachtliche Wampe unter seinem Hemd wackelte. Er hatte die Siebzig längst überschritten, war kahl rasiert und trug immer maßgeschneiderte Kleidung in den Farben Lila und Schwarz. Seit dem Infarkt und mehreren Bypässen vor zwei Jahren war die Zahl seiner cholerischen Anfälle deutlich zurückgegangen, aber manchmal brach sein hitziges Temperament immer noch durch. Anke fürchtete dann jedes Mal, dass sein schwaches Herz den Geist aufgeben könnte. Gleichzeitig war sie froh, heute nicht das Objekt seiner Beschimpfungen zu sein, denn im Zorn verwandelte er sich in eine Furie, deren Augen weit aus den Höhlen des blutrot angelaufenen Kopfes traten. Der ganze Mann sah dann aus, als stünde er kurz vor dem Platzen.
»Du hast’s verbockt! Du ganz allein. Und die arme Yvonne kann gar nix dafür!« Seine hohe Stimme überschlug sich, während er in das Handy schrie, das er jetzt wie ein Mikrofon vor sein glühendes Gesicht hielt.
»Einfach verbockt hast du´s! Kein Aber! Wenn du den Termin nicht einhältst, verliere ich ein Vermögen! Und du fliegst hochkant raus!«
Remigius kappte die Verbindung und legte das Telefon in seinen Schoß.
»Nulpe!«
Ohne ein weiteres Wort rollte er in das kleine Zimmer, das sich an den hinteren Teil des Verkaufsraumes anschloss, und knallte die Tür zu.
Anke ging ihm nach und klopfte zaghaft an.
»Komm schon rein«, brummte es von innen.
»Zachy?«, fragte sie.
»Kennst du einen größeren Idioten?«, antwortete er und fummelte in der Herrenhandtasche herum, die er immer im Rollstuhl mit sich führte.
Er schien nicht zu finden, was er suchte, und blickte zu Anke auf.
»Und jetzt, da ..., da Yvonne ..., da sie von uns gegangen ist, versucht er ihr seinen Misserfolg in die Schuhe zu schieben. Das ist so mies von ihm.«
Wieder begann er in der Tasche zu kramen, doch ohne Erfolg.
»Das ist alles so schrecklich. Ich fühle mich grauenhaft, weil ich Yvonne gebeten habe, Zachy ein wenig zur Seite zu stehen. Und dann läuft sie ausgerechnet dort einem Irren über den Weg«, sagte er.
»Gertrud hat Andeutungen gemacht. Was ist genau mit Yvonne geschehen?«
»Man hat sie ausgeraubt und in einen Fluss gestoßen, in diesem Provinzkaff, ist das zu glauben? Nicht hier im ach so gefährlichen Köln.«
Er gab die Suche in den Tiefen des Täschchens endgültig auf.
»Verflixt nochmal, wo sind denn meine ...?«
Anke nahm die Schatulle mit den Mentholdrops von seinem Schreibtisch und hielt sie ihm vor die Nase.
»Ach, danke, Liebes. Auch eins?«
Manchmal glaubte Anke, dass Remigius sich ausschließlich von den grünen Dingern ernährte, was seine immense Körperfülle jedoch nicht im Mindesten erklärt hätte. Sie lehnte mechanisch ab. Dass Yvonne für immer weg sein würde, sickerte erst jetzt langsam in ihr Bewusstsein und belastete sie stärker als gedacht.
»Weiß man schon, wer ...?«
»Ach woher denn!«, schmatzte Remigius. »Die Polizei tappt im Dunkeln. Wahrscheinlich irgendein Gelegenheitsräuber. Du kennst doch Yvonne: Anstatt dem Dieb brav ihre Brieftasche auszuhändigen, hat sie bestimmt eine Diskussion mit ihm angefangen. Und dann ... ach, es ist schrecklich!«
Auf unbestimmte Weise spürte Anke, dass seine Theorie nicht stimmte. Yvonne war zwar nie einer verbalen Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen, aber gleichzeitig viel zu intelligent, um sich nachts mit einem Straßenräuber anzulegen. Sie war nicht das zufällige Opfer eines Schurken geworden, das fühlte Anke.
»Und Zachy?«, fragte sie.
»Was soll mit dem sein? Er packt die Gelegenheit beim Schopf und versucht, ihr alle Schuld für sein Versagen ans Bein zu binden. Jetzt, wo sie sich nicht mehr dagegen wehren kann.«
Remigius stopfte sich ein weiteres grünes Bonbon in den Mund.
»Ist natürlich Quatsch, was er da verzapft. Yvonne ist ja erst vor ein paar Wochen in Wiltheim eingetroffen. Der Blötschkopp hat´s selbst vergeigt, so sieht´s aus.«
»Was soll ich dazu sagen? Du kennst meine Meinung«, sagte Anke vorsichtig.
»Nun fang bitte nicht wieder damit an! Ich hatte einen guten Grund, ihn zu meinem Assistenten zu machen!«
Richtig. Deine Synapsen laufen Amok, wenn ein attraktiver junger Mann auf der Bildfläche erscheint.
»Er wurde mir wärmstens empfohlen! Und du, mit deinen beiden Kleinen, hattest ja nicht die Zeit«, fügte Remigius hinzu.
»Ganz so war es nicht«, widersprach Anke. »Soweit ich mich erinnere -«
»Ist jetzt auch wurscht! Er hat’s jedenfalls vergeigt.« Remigius schob seine Unterlippe nach vorn wie ein schmollendes Kind.
»Du magst ihn sehr, nicht wahr?«, sagte sie. Das war untertrieben: Remigius schmachtete den höchstens halb so alten Zachy förmlich an.
»Ach, Unsinn! Er ist ein Versager, nichts weiter. Kann gar nicht glauben, dass ich vorhatte, ihm den Laden zu vererben.«
»Wie bitte? Du wolltest ihn als Erben einsetzen?«
Remigius sah zu Boden. »Das ist natürlich vom Tisch. Zumindest solange, bis er das Museum zum Erfolg geführt hat.«
Also erbt Zachy keinen Heller.
»Neulich war er hier und hat mir hoch und heilig versprochen, dass alles in Ordnung kommt. Er brauche nur ein wenig Hilfe und eine weitere Geldspritze, weil in Süddeutschland alles viel teurer sei als hier, auch die Baukosten und so weiter. Und ich Hornochse habe ihm alle Vollmachten gegeben, die er wollte. Und zusätzlich Yvonne von Laatz beleiert, damit sie ihm mit ihrem Namen Türen öffnet, die ihm angeblich verschlossen waren.«
»Und?«
Remigius seufzte.
»Jetzt ruft er an und beichtet, dass die Eröffnungsvernissage um mindestens ein halbes Jahr verschoben werden muss.«
»Wirklich? Wofür habe ich dann in München die Werbetrommel gerührt?«
»Ich weiß es ja«, sagte er kleinlaut.
»Darf ich dich daran erinnern, dass es seine Idee war, das mit dem Museum?«, sagte Anke. »Ein Rückzieher zu diesem Zeitpunkt wird unserem Ansehen erheblich schaden, und die Sammler und Künstler verlieren das Vertrauen in unsere Zuverlässigkeit.«
»Ich weiß, es ist furchtbar.« Remigius standen Tränen in den Augen.
»Na, na, so schlimm wird es schon nicht sein.« Anke verkniff sich, hinzuzufügen, dass sie selbst dem unerfahrenen Zachy niemals so viel Verantwortung übertragen, geschweige denn, ihm Yvonne von Laatz als Beraterin an die Seite gestellt hätte. Das war eine andere Geschichte.
»Du musst das Ding jetzt schaukeln«, sagte Remigius.
Sie sah ihn erstaunt an.
»Ich soll die Kohlen aus dem Feuer holen? Für ihn? Für sie?«
»Für mich, Liebes. Nur für mich.« Er nahm ihre Hand, und Anke wurde sich wieder bewusst, warum sie so gerne mit ihm zusammenarbeitete: Wenn er nicht gerade tobte oder feilschte, war Remigius Wohlstedt einer der liebenswürdigsten Menschen auf diesem Planeten.
»Tu es einfach für mich«, wiederholte er. »Ich habe doch sonst keinen Mitarbeiter, dem ich so vertrauen kann. Und du warst immer wie eine Tochter für mich.«
Anke ließ sich auf die dunkelrote Couch fallen, auf der Remigius seine Nickerchen hielt, wenn er sich im Hinterzimmer einschloss, »um Rechnungen zu prüfen«. Sie legte die Beine übereinander und verschränkte die Arme.
»Cora wird mich erwürgen.«
Wie sollte sie ihrer heftig pubertierenden Tochter beibringen, dass sie Köln verlassen sollte – und all ihre Freundinnen und Schulkameraden? Nur um ihrer Mutter in ein bayerisches Kuhkaff zu folgen? Mara war diesbezüglich pflegeleicht. Aber sollten sie diesen Umbruch wirklich auf sich nehmen, für ein höchst fragwürdiges Projekt, das Zachys wirrem Hirn entsprungen war? Weil Remigius ihm blind vor Verliebtheit gefolgt war, entgegen Ankes eindringlicher Warnung?
»Teenager finden schnell neue Freunde«, sagte Remigius, ihre Gedanken lesend. »Und es wäre doch nur für kurze Zeit. Und, schließlich war es doch auch deine Idee.«
»Verdreh bitte nicht die Tatsachen! Ich habe vorgeschlagen, eine dritte Dependance zu gründen, das stimmt. Aber in München, und nicht im Nirgendwo!«
»Sieh bitte dort nach dem Rechten, Anke. Mir zuliebe.«
»Ich weiß wirklich nicht, ob ich die Richtige dafür bin.«
»Ich würde es ja selbst tun, aber schau mich an!« Er deutete auf den Rollstuhl. »Seit dem verdammten Infarkt bin ich nicht mehr der Alte. Also überleg es dir bitte, Liebes.«
Er setzte einen lauernden Blick auf, der nichts Gutes verhieß. »Ich würde dich nämlich ungern als Mitarbeiterin verlieren.«
Was waren denn das für Töne?
»Wieso verlieren? Willst du mich etwa rausschmeißen? Tu dir bloß keinen Zwang an!«
Er hob abwehrend die Hände.
»Das will ich doch gar nicht, hör zu -«
»Nein! Du hörst jetzt zu!«, unterbrach sie ihn. »Holger ist zwar ein Idiot und ein notorischer Schürzenjäger, aber er zahlt seine Alimente pünktlich jeden Monat. Ich mache den Job bei dir nicht wegen des Geldes, sondern weil er mir Spaß macht. Außerdem kannst du mich gar nicht feuern, denn ohne meine Kontakte bist du aufgeschmissen und ich habe nicht vor, dir meine -«
»Jetzt halt mal die Luft an! So war es gar nicht gemeint«, unterbrach Remigius ihren Furor.
»Ach ja? Wie soll ich es bitte sonst verstehen?«
»Nicht so, überhaupt nicht so! Es läuft momentan einfach nicht gut für uns.«
Er nahm sich ein weiteres Bonbon und hielt Anke wieder die Dose hin.
»Lass mich endlich mit den albernen Dingern in Frieden!«
»Ich wollte dir das alles schon am Telefon sagen, aber wir wurden ja unterbrochen. Fichtenau ist zu Bengtson desertiert, während du in München warst. Und bereits vor drei Wochen hat sich Schirin Dogan gemeldet und angekündigt, sich nach einem anderen Galeristen umsehen zu wollen.«
»Schirin? Wirklich? Jetzt, wo ich sie mit so viel Mühe aufgebaut habe und die Sammler endlich ihre Werke wollen?«
Remigius nickte.
»Und Gustav Waldmann ist vorgestern gestorben. Das musste bei einem Sechsundachtzigjährigen ja irgendwann passieren.«
»Unsere drei Aushängeschilder!«, rief Anke.
»Ja, verstehst du mich jetzt? Uns brechen erhebliche Einnahmen weg, und der Markt für alte Bilder ist leergefegt, weil jeder Geldsack inzwischen Kunst bunkert und kaum mehr jemand Bilder zur Versteigerung anbietet.«
»Aber warum hast du mir nichts von Schirin gesagt? Ich hätte doch mit ihr gesprochen und versucht -«
»Ich lasse mich nicht erpressen«, schnitt Remigius ihr das Wort ab. »Nicht von ihr und auch von sonst niemandem.«
Sein Kopf nahm wieder eine bedenkliche Röte an.
»Beruhige dich bitte.« Anke musste einen erneuten Wutanfall verhindern, also verzichtete sie darauf, das Thema zu vertiefen. Sie stand auf, trat von hinten an den Rollstuhl und legte Remigius die Hand auf die Schulter.
»Wir finden eine Lösung. So wie immer.«
Er ergriff ihre Hand.
»Das Museum in Bayern könnte eine sein.«
»Du hast vermutlich recht«, sagte Anke, ohne daran zu glauben.
»So gefällst du mir besser. Ich lasse mich auch nicht lumpen. Wie wär’s mit einer Gewinnbeteiligung? Sagen wir fünf Prozent? Zusätzlich zum Gehalt einer … Geschäftsführerin?« Er drehte sich zu ihr um und sah sie an. Wie immer, wenn es um Geld ging, erinnerte sein rundes Gesicht mit der spitzen Nase an einen Fuchs.
»Ich weiß nicht …«
»Also sieben? Natürlich nur vom Gewinn, nicht vom Umsatz, dass wir uns da nicht falsch verstehen.«
Was war denn mit ihm los? Remigius war so knickerig, dass er ungeachtet seines beträchtlichen Vermögens in einer Zweizimmerwohnung zur Miete hauste. Dass er ihr überhaupt eine Gewinnbeteiligung anbot, war trotz ihrer langjährigen Freundschaft mehr als ungewöhnlich. Dass er sogar bereit war, über das Gehalt in Verhandlungen zu treten, war ein beispielloser Vorgang.
»Dreißig«, sagte Anke und hoffte, das Thema damit endgültig zu begraben.
Er wurde bleich und schob die Pastille nervös in seinem Mund herum.
»Willst du mich ruinieren? Das kann ich nicht!«
»Es geht mir gar nicht ums Geld, Remigius.«
»Worum dann?«
Warum verstand er nicht, dass es im Leben um viel mehr ging als ums Geschäft?
»Lass mich einfach eine Nacht darüber schlafen, okay?«
5. Kapitel
Als sie in den Parkplatz des McDonald´s in der Neuenhofstraße hineinfuhr, übersah Anke beinahe den weißhaarigen Rentner, der mit zwei vollen Papiertüten auf seinen verbeulten BMW zusteuerte. Er schüttelte nur erbost den Kopf und ging weiter, während sie den Subaru in eine enge Parklücke lenkte und genervt den Motor abwürgte.
Ihr Kopf fühlte sich an, als ob ein böser Clown darin einen mächtigen Ballon aufblies, der ihr Gehirn schmerzhaft zusammenquetschte, so wie früher, wenn sie sich am Vorabend drei Flaschen Wein genehmigt hatte. Der Migräneanfall war dem Stress der vergangenen Tage geschuldet, obwohl sie ihn gerne nur dem Anrufer angelastet hätte, mit dem sie gerade verbunden war und der ihre Aufmerksamkeit erheblich vom Straßenverkehr ablenkte.
Sie hätte sich in den Arsch beißen können, das Telefonat überhaupt angenommen zu haben, denn eigentlich war sie im Moment nicht empfänglich für seine mit Selbstmitleid gewürzte Unverfrorenheit. Zum Glück schlief Mara tief und fest auf dem Rücksitz, und Cora hatte ihre Kopfhörer auf und starrte gebannt aufs I-Phone.
»Du vögelst jahrelang mit anderen Weibern und jammerst dann über die Konsequenzen? Werd endlich erwachsen.«
»Anke ...«, winselte es in ihren Gehörgang.
Was hatte sie an diesem Schwächling einmal gemocht, abgesehen von seinem blendenden Aussehen und seinem Geld?
»Ich habe dich nicht betrogen«, wiederholte er. »Niemals! Selbst wenn du es hunderttausendmal behauptest, wird es dadurch nicht wahr. Wieso glaubst du allen anderen, nur mir nicht?«
Es war so sinnlos. Die Belege für seine Seitensprünge waren Legion.
»Nehmen wir doch mal Yvonne. Was war mit ihr?«
»Yvonne - wie kommst du denn darauf?«
»Hör zu, ich habe mir vorgenommen, nicht mehr mit dir zu streiten. Die Zeiten sind vorbei, Holger. Besser, du akzeptierst das.«
»Aber ...«
»Nein und nochmals nein. Und wenn wir schon dabei sind: Unterlass es bitte zukünftig, mir das Jugendamt auf den Hals zu hetzen. Oder steckt deine Mutter dahinter? Oder deine Neue?«
»Sie heißt Nicole.« Die Erwähnung ihres Namens schien eine Spur Kampfgeist in ihm zu wecken. »Und nein, sie stecken nicht dahinter.«
Anke hatte Nicole noch nie gesehen und legte auch keinen Wert darauf. Aber sie wusste von ihren gemeinsamen Freunden, dass er die Französin bei einem Kongress seiner Bank in Paris kennengelernt hatte und dass sie zehn Jahre jünger war.
»Nicole spricht nur Gutes über dich. Und sie mag Mara und Cora wirklich sehr.«
Na klar, was soll sie dir denn sonst erzählen, du Mondkalb? Dass sie deine Brut nicht ausstehen kann?
»Und Cora versteht sich auch mit Amoya gut. Das ist Nicoles Tochter, und ...«
»Ich muss weiter, Holger. Die Kinder haben Hunger.«
Er überlegte offenbar.
»Oma sagt, du hast bei Remigius so viel um die Ohren, dass du dich nicht richtig um die beiden kümmerst.«
Es war also Gertrud, die das Jugendamt eingeschaltet hatte.
»Ich vermisse meine Kinder, Anke. Was spricht dagegen, dass sie bei uns leben? Oder wenigstens Cora? Frag sie. Sie möchte es, und Nicole hat genügend Zeit, um sie zu umsorgen!«
Holger ging es nicht um das Wohl seiner Töchter. Er wollte ihr eins auswischen, um jeden Preis, weil sie ihn durch die Trennung in seiner männlichen Ehre gekränkt hatte.
»Ich bin ihre Mutter, und sie bleiben bei mir! Du schiebst sie doch jetzt schon bei jeder Gelegenheit zu Gertrud ab.«
»Das ist ...«
»Wo warst du zum Beispiel heute? Am Flughafen?«
Er schwieg, wie immer, wenn er in einem Streit nicht weiterwusste.
»Du bekommst die Kinder nur über meine Leiche, Holger. Ein karrieregeiler Investmentbanker und seine Jetset-Freundin sind nicht das, was ich mir als angemessenen Umgang für meine Töchter vorstelle. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass deine Nicole die Mutter von einer Göre ist, mit der Cora schon mal einen Satz gewechselt hat.«
Im Rückspiegel regte sich Mara in ihrem Kindersitz.
»Ich muss aufhören.«
»Dir geht es doch nur um den Unterhalt.«
»Ach, Unsinn! Das Schmerzensgeld erleichtert mir einiges, nicht mehr und nicht weniger. Also verschon mich mit dieser Leier. Ich muss jetzt wirklich ...«
»Nein, so lasse ich mich nicht abspeisen! Ohne mein Geld müsstest du dir einen richtigen Job suchen, nicht nur das bisschen Rumreisen für Wohlstedt. Ist es nicht so?«
Seine Stimme war hart geworden, ungewöhnlich frostig. Eine neue Schmerzwelle wogte durch Ankes Kopf.
»Hast du mir sonst noch etwas Dringendes mitzuteilen? Ich habe jetzt nämlich keine Zeit für diesen Quark«, zischte sie.
»Na gut, ich wollte das mit dir eigentlich auf gütliche Weise regeln, aber du willst es ja so. Ab heute arbeiten meine Anwälte daran, den Nachweis zu erbringen, dass die Kinder bei mir besser aufgehoben wären, nicht nur in finanzieller Hinsicht.«
»Ich lache später drüber.«
»Seit wann bin ich lustig?«, fuhr er fort. »Es ist doch ganz simpel: Ich habe eine Partnerin, du lebst allein. Ich verdiene dreihundertvierzigtausend im Jahr, du lebst von der Hand in den Mund. Noch dazu bist du in deinem Hungerleiderjob ständig unterwegs und hast kaum Zeit für die Kinder. Ich reise zwar auch viel, aber Nicole kann ihnen den sicheren Hafen bieten, den sie brauchen. Was glaubst du wohl: Für wen wird sich der Richter am Ende entscheiden? Für den Top-Banker oder die flatterhafte Kunsttussi?«
Anke legte auf. Es gab eine Million Gründe, seine Drohung nicht ernst zu nehmen, dennoch zweifelte sie keine Sekunde an seinen Absichten. Er hatte ihr gerade den Krieg erklärt, und der würde blutig werden.
»Was ist los?«, fragte Cora und nahm die Kopfhörer ab. »Gehen wir nicht rein?«
»Doch, klar.«
6. Kapitel
Holgers monatliche Zahlungen waren so bemessen, dass Anke nach der Trennung ein schnuckeliges Penthouse in Porz-Zündorf hatte mieten können, mit ausreichend Platz für sie drei. Dort saß sie in ihrem kleinen Arbeitszimmer, nachdem sie Mara zu Bett gebracht hatte. Doch anstatt die wenigen Messe-Aufträge für Remigius aufzubereiten, starrte sie aus dem Fenster. Eisenfarbene Wolken hingen immer noch über der Stadt, aber der Regen hatte aufgehört. Unten auf dem Rhein schipperte ein Frachter mit Kohlen vorbei, Richtung Süden, wohin sie mit ihren Töchtern ziehen sollte, wenn es nach Remigius ging.
Wieder ein Umzug, nach so kurzer Zeit. An einen Ort, an dem sie niemanden kannte und völlig auf sich allein gestellt war. Schwer vorstellbar.
Nach dem Gespräch mit Remigius hatte sie sich wie die ungeliebte Tochter eines Vaters gefühlt, der sie zu lebenslangem Küchendienst bei den Seppeln in Bayern verdonnerte, als zweite Wahl nach Yvonne von Laatz.
Ganz so schlimm war es natürlich nicht. Wenn Anke die Angelegenheit nüchtern betrachtete, musste sie zugeben, dass die Aufgabe in Süddeutschland durchaus reizvoll war. Sie konnte ihren Horizont erweitern, neue Kontakte knüpfen und irgendwann in ferner Zukunft ihre eigene Galerie in Angriff nehmen.
Die Wünsche der Kinder durfte sie allerdings nicht außer Acht lassen, denn die beiden hatten ein Recht auf ein glückliches Leben. Und dann war da auch noch ihr eigenes Problem, das bei einem Ortswechsel möglicherweise wieder seine hässliche Fratze zeigen würde.
Er. Ihr Dämon. Den sie dank eines jahrelang geknüpften Netzwerkes aus Freunden und Therapeuten gut in den Griff bekommen hatte, eines Netzwerkes, welches ihr beim Wegzug aus Köln entzogen würde.
Und dann? Würde der böse Feind sie vielleicht wieder heimsuchen. Das durfte auf keinen Fall geschehen.
Im Westen brach die Wolkendecke auf, und die letzten Strahlen der Abendsonne tauchten den Fluss, der seit ihrer Kindheit ein vertrauter Anblick für Anke war, in rötliches Gold. Die Regentropfen an der Fensterscheibe strahlten wie Brillanten.
Sie klappte ihr Laptop auf, startete den Browser und ging auf lovebistro.de. Vielleicht hatte sich ja ein interessanter Neuzugang ihr Profil angesehen und eine Nachricht hinterlassen.
Es fanden sich sechzehn neue Posts. Anke klickte sich durch die zugehörigen Profile und wunderte sich von Bild zu Bild mehr über sich selbst. Warum hatte sie sich auf dieser Dating-Plattform angemeldet? Hier tummelten sich hauptsächlich kleinwüchsige, hässliche oder verheiratete Männer, die einen Seitensprung suchten. Manche brachten es sogar fertig, alle drei Eigenschaften in einer Person zu vereinen und sich dennoch als Gottes Geschenk an die Frauenwelt auszugeben. Eine Ausnahme bildeten die milchbärtigen Jünglinge, die behaupteten, es sei der Traum ihrer schlaflosen Nächte, eine Beziehung mit einer doppelt so alten, »reifen Frau« zu führen. Wer’s glaubt, wird selig.
Einige der Bübchen konnten zwar durchaus mit begehrenswerten Körpern aufwarten, aber was geschah nach der ersten Nacht?
Bye-bye, Baby.
Dating-Portale waren Mist. Aber welche Alternativen blieben ihr, um irgendwann einmal wieder Aussicht auf Sex zu haben, geschweige denn ein erfülltes Liebesleben? Das Kölner Nachtleben konnte sie in ihrem Alter und mit zwei halbwüchsigen Kindern, als Kontaktbörse abschreiben. In ihrem beruflichen Umfeld war ein Drittel der Männer schwul, ein Drittel egozentrisch und den Rest konnte man vergessen.
Sie klickte auf den letzten Kandidaten, der ihr eine Nachricht geschickt hatte, ein Spinner namens Cockzilla_38, der zu hoffen schien, dass allein die Aufnahme seines windschiefen Gemächts die Damenschaft in Wallung versetzen würde.
Nein danke. Dann lieber keinen Sex mehr bis zum jüngsten Tag.
Anke verließ das Portal und googelte den Ort, an dem Zachy sich mit der neuen Galerie abplagte.
Allertiefste Provinz.
Vielleicht verschleppte Remigius’ Liebling das Projekt ja bewusst, damit er dort endlich wieder wegdurfte? Falls ja, schien diese Bemühung mit Erfolg gekrönt zu sein.
Skype signalisierte, dass Marlis online war.
»hi süße. holger droht, mir die kinder wegzuklagen - mürrischer Smiley -, magst du kurz reden?«
Sekunden später erschien auf dem Bildschirm ein schwarzer, ziemlich verstrubbelter Pagenkopf.
»Du hast ihm hoffentlich gesagt, dass er diesen erbärmlichen Furz von einer Idee gleich vergessen kann?«, klang Marlis’ geübte Juristinnenstimme blechern aus den Lautsprechern des MacBooks.
»Ja ..., na ja, so ähnlich.«
»Du hast ihm diese Frechheit durchgehen lassen?« Marlis runzelte die Stirn. »Warum schonst du ihn? Das Schwein hat verdient, zu bluten. Außerdem hat er mit einer Klage sowas von keine Chance.«
»Er klang recht zuversichtlich, ehrlich gesagt.«
»Lass ihn nur machen! Wir treten ihm den Stiefel so in den Arsch, dass er die Einzelteile seines Hinterns auf dem Mond aufsammeln kann.«
Erst jetzt nahm Anke die hellgrünen Badezimmerkacheln an der Wand hinter ihrer Chatpartnerin wahr.
»Sitzt du eigentlich gerade auf dem ...? Ich meine ..., soll ich es später nochmal versuchen?«
»Unsinn! Du wolltest mich sprechen? Hier bin ich! The doctor is in the house.«
Marlis grinste und entblößte dabei ihre perfekten Zähne.
»Ich will nicht mehr von Holger abhängig sein, egal was kommt«, sagte Anke und berichtete Marlis von dem Gespräch mit Remigius.
»Dabei kann von einem Vorschlag nicht wirklich die Rede sein«, sagte sie zum Schluss. »Eigentlich erpresst er mich, zumindest indirekt.«
Marlis wiegte ihren Kopf hin und her und zündete sich eine Zigarette an.
»So wie es bei mir ankommt, musst du dir das zweimal überlegen. Du sagst, Wohlstedts Geschäft rauscht gerade den Bach runter. Wie soll er da das zusätzliche Gehalt einer Geschäftsführerin bezahlen?« Sie blies den Rauch direkt in die Cam.
»Schon wahr, aber wenn ich demnächst nicht putzen gehen will, ist es die einzige Chance, um von Holgers vergiftetem Trog loszukommen.«
»Hm, das überzeugt mich nicht wirklich. Lass ihn doch zahlen!« Marlis machte zwei Züge nacheinander und entsorgte die Kippe.
»Wenn Holger wirklich in die Kiste mit den fiesen Tricks greift, und das wird er tun, so wie ich ihn kenne, dann kann ich dem Jugendamt immerhin einen gut bezahlten Job vorweisen, der nicht mehr ständiges Reisen erfordert. Außerdem würden wir uns öfter sehen«, sagte Anke. »Ich mach mir nur ein wenig Sorgen um die Mädels. Zuerst die Trennung, und dann schleppe ich sie vierhundert Kilometer weg, mitten ins Nirgendwo, fort von ihrem Vater -«
»Der alles tut, um dich ihnen madig zu machen, vergiss das nicht!«, sagte Marlis. »Viel wichtiger erscheint mir die Frage, ob du den Job überhaupt willst.«
»Das weiß ich eben nicht. Es ist eine Herkulesaufgabe. Angeblich hat Zachy nicht die Hälfte dessen erledigt, was er sich vorgenommen hatte.«
»Ein Traumjob also!« Marlis zündete sich eine weitere Zigarette an.
»Sarkasmus bringt mich leider auch nicht weiter.«
»Was willst du denn von mir hören? Das Ganze klingt für mich nach einem Galadinner, bei dem zu jedem Gang trockene Brötchen als einzige Speise gereicht werden. Mit Wasser zum Runterspülen. Nicht nach meinem Geschmack!«
»Immerhin brächte ich dadurch auch Gertrud auf Distanz, du weißt schon, Holgers nervige Mutter, die immer noch in meinem Leben rumpfuscht.«
Marlis bohrte hingebungsvoll in der Nase, schien völlig zu vergessen, dass jede ihrer Bewegungen auf Ankes Monitor sichtbar war.
»Das scheint dich auch nicht zu überzeugen«, sagte Anke.
»Ach Süße, was soll ich dir raten? Was wird aus deiner Therapie? Der Selbsthilfegruppe? Dem Krav Maga? Das alles gibt dir Halt. Und den gibst du auf, wenn du nach Süddeutschland kommst.«
Anke nickte. Es hatte lange gedauert, bis sie ihre Alkoholsucht in den Griff bekommen und genug Vertrauen aufgebaut hatte, um ihr Innerstes einer Gruppe von völlig Fremden anzuvertrauen. Damit nun wieder neu beginnen zu müssen, jagte ihr eine Höllenangst ein.
»Ach, verdammte Zwickmühle«, sagte sie.
»Dafür finden sich Lösungen, wenn du es wirklich willst«, sagte Marlis. »Ich werde mich für dich umhören, wenn du möchtest. Wo befindet sich das zukünftige Museum nochmal?«
»Der Ort heißt, warte … Dürrweiding.«
Als Anke den Namen aussprach, klang er in ihren Ohren wie das widerliche Geräusch, das manche Menschen von sich geben, wenn sie Rotz hochziehen, um ihn auszuspucken. Genauso hinterwäldlerisch wie die meisten Bayern, denen sie bisher begegnet war.
»Die nächstgrößere Stadt ist Wiltheim an der Wiltach.« Ebenfalls Worte, die ihren rheinischen Lippen nur schwer abzuringen waren.
»Das ist doch kein Ort, gegen den jemand mit einem Funken Verstand das schöne Köln eintauscht, oder?«
»Na ja, so schlimm sind die Bayern auch nicht. Wiltheim ist nur eine knappe Stunde von München entfernt und nur vierzig Minuten von mir«, sagte Marlis. »Also wenn du wirklich willst …«
»Greifst du mir etwas unter die Arme, wenn ich mich dazu entschließe?«
»Natürlich! Was denkst du denn?« Marlis schnitt eine aufmunternde Grimasse und verabschiedete sich. Dann verschwand ihr Gesicht vom Bildschirm.
A friend in need is a friend indeed, sagte es in Ankes Kopf. Das war eine der Weisheiten ihrer Mutter, die sie in ihrer Jugend so gehasst hatte, die sich dessen ungeachtet trotzdem in ihrem Bewusstsein festgefressen hatten. Ob es Cora wohl einst genauso erging, mit all den schlauen Sprüchen, mit denen Anke sie zumüllte?
Ein schnarrendes Geräusch ertönte, ähnlich wie die Spielkarten, die sie sich als Kinder an die Speichen ihrer Fahrräder geklipst hatten. Der unangenehme Ton der Türklingel war erst ein einziges Mal erschallt, nämlich als der knuddelige Nachbar von nebenan sich ein Nudelsieb von Anke ausgeliehen hatte.
Es war viertel vor elf. Sie hatte keinen Besuch eingeladen und konnte sich auch nicht vorstellen, wer um diese Uhrzeit vor der Türe stehen sollte, da bisher kaum jemand die neue Adresse kannte.
Doch bevor der hässliche Ton erneut mahnte und Mara aufweckte, ging sie zur Tür. Der kleine Überwachungsbildschirm zeigte zwei Unbekannte, die scheckkartengroße Ausweise in die Kamera hielten, als Anke sich meldete.
»Kriminalpolizei. Können wir Sie bitte kurz sprechen, Frau Neuhaus? Es geht um Yvonne von Laatz.«
»Verdächtigen Sie etwa mich?«, fragte Anke nach dem Öffnen der Tür. Ihr Tonfall war eine Prise gereizter als gewollt.
»Wir leisten Amtshilfe für die Dienststelle in Bayern, die in dem Fall ermittelt. Es gibt eine Spur, die zu Ihnen führt«, antwortete der junge Polizist und klang fast so, als ob er sich für seine Aufgabe entschuldigte. Er hatte einen unaussprechlichen Nachnamen und attraktive, schwarze Augen. Unter seinem hellblauen Hemd steckte ein gut durchtrainierter Körper, der jedem Laufsteg der Welt Ehre gemacht hätte.
»Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?«, fragte Anke.
Die ältere Kollegin des Model-Ermittlers wäre problemlos als Protagonistin in »Bauer sucht Frau« durchgegangen. Sie wirkte allerdings bedeutend aufgeweckter als die Trullas in der Reality-Show und wandte während der gesamten Befragung ihre blassblauen, bohrenden Augen nicht eine Sekunde von Anke ab.
»Standen Sie vor ihrem Tod mit Frau von Laatz in Kontakt?«, fragte sie.
Das Handy. Anke wusste aus den Thrillern, die sie abends verschlang, dass die Polizei Verbindungsdaten von Mobiltelefonen auslesen konnte.
»Sie hat mich vor einigen Tagen angerufen.«
»Weswegen?«
»Ich weiß es nicht.«
Die Augenbrauen der Polizistin zuckten nach oben.
»Ich meine … keine Ahnung, ehrlich gesagt«, fügte Anke schnell hinzu.
»Telefonieren Sie häufig miteinander?«
»Wenn Sie einmal in fünfzehn Jahren viel finden, dann ja.«
Die Polizistin nickte zufrieden. Sie schien von Yvonnes Handydaten zu wissen, dass es der einzige Anruf gewesen war.
»Darf man fragen, worum es in Ihrem Telefonat ging?«, schaltete sich der südländische Beamte mit der Kölner Sprachfärbung wieder ein, nicht ohne seiner Kollegin einen unsicheren Seitenblick zuzuwerfen.
Anke zuckte mit den Achseln.
»Nichts Besonderes. Wir haben geplaudert.«
»Ach ja? Und deshalb ruft sie Sie nach eineinhalb Jahrzehnten Funkstille urplötzlich an? Um zu plaudern, über dies und das? Kochrezepte vielleicht?«, fragte die Polizistin.
»Sie hat mir mitgeteilt, dass sie todkrank ist, und wollte reinen Tisch mit mir machen. Wir hatten uns zerstritten.«
Die Beamtin notierte das.
»Sonst nichts?«
»Nein.«
»Woher kannten Sie sich?«
»Von der Kunsthochschule. Wir haben uns dort angefreundet und später wieder aus den Augen verloren.«
»Verstehe. Was haben Sie nach dem Telefonat gemacht? Nachts zwischen zehn und drei Uhr?«
»Geschlafen, was sonst? Ich war in einem Hotel in München, weil ich dort am Samstag an einer Kunstveranstaltung teilgenommen habe.«
Anke nannte den Namen des Hotels, den sich der junge Polizist in seinem Tablet notierte.
»Hatte Frau von Laatz Feinde?«, fragte die Rustikale mit dem stechenden Blick.
»Keine Ahnung, woher soll ich das auch wissen? Ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir seit Jahren keinen Kontakt mehr hatten. Aber, ganz allgemein gesprochen, kommt ungefähr die Hälfte aller bildenden Künstler des Universums infrage. Yvonne von Laatz ist ... war eine der bedeutendsten Kunstkritikerinnen Deutschlands, eine anerkannte Expertin für die Moderne. Sie hat mit ihren Artikeln hunderte Karrieren ermöglicht und dreimal so viele in den Sand getreten. Was glauben Sie, wie viele Rechnungen da offen sind?«
*
Nachdem die beiden Polizisten die Wohnung wieder verlassen hatten, schaltete Anke alle Lichter aus, setzte sich auf den riesigen, flauschigen Teppich und vergrub ihre Finger in der Wolle.
Sie hatte den Beamten nichts Erhellendes zu Yvonnes Tod berichten können. Die Erinnerung gaukelte ihr vor, dass sie die fragliche Nacht allein im Bayerischen Hof verbracht und früh zu Bett gegangen war. Ein Buch von Stephen King gelesen hatte, irgendwas Blödes mit Ameisen am Ende.
Und so war es auch gewesen. So musste es gewesen sein. Aber stimmte das? Was, wenn sie sich ein paar Drinks aus der Minibar genehmigt und danach mit Yvonne getroffen hatte? München war nicht allzu weit von Wiltheim entfernt. Und mit einem Taxi, bei Nacht ...?
Humbug.
Und wenn sie sich doch mit Yvonne getroffen hatte und es zum Streit gekommen war? Wenn die Situation eskaliert war und ...
Nein, unmöglich. Daran würde sie sich doch erinnern, oder?
Sie hatte nicht getrunken, vorgestern Abend. Sie trank gar nicht mehr. Die Hotelrechnung würde es belegen.
Sie suchte nach der Rechnung, fand sie aber nirgends. Ging zurück zum Teppich. War das Unmögliche möglich? Die vielen Filmrisse kamen ihr in den Sinn, unter denen sie vor Beginn ihrer Therapie gelitten hatte. Alle Ereignisse, an die sie sich nach dem Suff nicht mehr erinnerte, darunter einige grässliche Vorfälle. Zuletzt das Feuer, das sie und Mara beinahe das Leben gekostet hatte, die ultimative Katastrophe, nach der sie die Reißleine gezogen und den Entzug begonnen hatte. Nicht nur wegen der Kinder, sondern auch um ihrer Selbstachtung willen.
Die Tränen bemerkte sie erst, als sie vom Kinn in den Ausschnitt und auf den Flokati tropften. Da war so viel Ballast, den sie mit sich rumschleppte.
Sie schniefte in den Ärmel ihres Sweaters.
Auf einmal erschien ihr die Idee, in den Süden zu gehen, in einem völlig neuen Licht. Etwas Neues zu beginnen wäre großartig, ganz wunderbar. Es würde sie vom emotionalen Unrat befreien, der sich in ihr angesammelt hatte.
Bayern wirkte langweilig und rückständig - spießig sowieso -, aber was Ankes Leben betraf, war es auch das sprichwörtliche weiße Blatt Papier.
Es bot die Chance auf einen Neuanfang.
7. Kapitel
Alles begann, als Tommy starb. Damals war ich sechs.
Er war schwarz und hatte einen kleinen weißen Fleck auf der Nase. Wenn wir im Garten des Reihenhauses spielten, jagte er mit Vorliebe einem Ball hinterher, den ich unermüdlich für ihn warf.
Weil ich gerne ein Indianer gewesen wäre, und nicht der Sohn eines Beamten und einer Hausfrau, redete ich mir beim Spielen ein, dass Tommy ein Wolf war, den ich in der Wildnis gefunden und gezähmt hatte. Der beste Freund des Menschen.
Ein Wurf misslang mir. Der Ball rollte durch den Zaun.
Tommy schoss jaulend hinterher und geriet unter die Räder eines Holzlasters. Ich musste lernen, dass die Knochen eines Pudels nicht kräftig genug sind, um die Wucht von vierzig Tonnen Stahl zu überstehen.
Seither verfolgt mich das Unglück. Ein dunkler Schatten setzte sich damals auf meine Fährte, und ich kann ihm nicht entrinnen, bis zum heutigen Tag. Wo immer ich mich verstecke, welchen Schleichweg ich auch nehme, wie viele Haken ich schlage, er macht mich ausfindig und klatscht mir aufs Gramm genau die Ration Schweinefraß auf den Teller, die er für mich zubereitet hat.
Manchmal hält er still. Doch das heißt nicht, dass er mich aus den Fängen lässt.
Oh nein.
Dann bereitet er lediglich eine noch viel grausamere Mahlzeit für mich vor.
*
Jakob Wigland hasste Beerdigungen. Wenn es möglich war, erfand er Ausreden, um nicht dabei sein zu müssen, wenn eine Holzkiste mit den Überresten eines Menschen im Boden verscharrt wurde.
Doch in diesem Fall hätte selbst die kreativste Notlüge ihn nicht vor der Teilnahme bewahren können, weshalb er gemeinsam mit einer beachtlichen Schar schwarz gekleideter Trauergäste auf dem Friedhof von Dürrweiding vor einem weiß lackierten Sarg stand, den er nicht nur wegen der grellen Farbe als Zumutung empfand, sondern auch, weil darin ein Mensch lag, den er sehr gut gekannt hatte und der viel zu früh gegangen war.
Der Geistliche rollte mit den Augen und gab in einem seltsamen Singsang einige irritierende Äußerungen über Gottes große Gnade von sich, die überhaupt nicht zum traurigen Anlass passten.
»Der ahlmähtige Goht, der dieg geschahfen haht, ruft dier tsu: Fürgte dieg nigt, denn ig habe dieg erlost; ig rufe dieg bei deinem Namin: Du bihst meiin.«
Ein katholischer Geistlicher aus Afrika auf dem platten Land in Bayern. Die Welt stand Kopf. Wigland war schon vor vielen Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Dass dem Konkurrenzverein eines Tages sogar der Priesternachwuchs ausgehen würde, hätte jedoch selbst er nicht für möglich gehalten.
Er stand direkt hinter Oskar Müller, seinem Vorgesetzten und Freund, und starrte auf dessen breiten, wulstigen Hals.
Es war Oskars Frau, die in dem Sarg lag.
Der Trauernde ertrug die Katastrophe mit stoischem Gleichmut, hielt reglos die Hand seiner alten Mutter, die neben ihm im Rollstuhl saß. Wigland ahnte, wie düster es im Inneren des vom Schicksal Geschundenen aussah, aller zur Schau gestellten Gefasstheit zum Trotz.
Der Sarg wurde in das Loch abgesenkt und der Pfarrer warf eine Schaufel Erde darauf.
Klonk.
Wie zur Antwort ertönte aus dem Inneren der weißen Kiste ein Laut.
Wiglands Kehle wurde trocken. Die Frau rechts neben ihm, eine untersetzte Rentnerin mit grellrot gefärbten Haaren, schien den gedämpften Ruf nicht vernommen zu haben. Auch kein anderer Trauergast reagierte.
»... niemm das Zeigen des Kreuzes. Friede sei miet dier«, singsangte der Afrikaner im Talar.
Wieder drang ein Ton aus dem Sarg, dieses Mal deutlich hörbar.
Nahm das keiner wahr außer ihm, verflucht nochmal? Wigland wollte gerade ansetzen und die anderen auf das Wehklagen aufmerksam machen, als etwas Unglaubliches geschah: Der Sargdeckel bewegte sich knirschend, die Schrauben, mit denen er befestigt war, drehten sich aus dem Holz und fielen klirrend vor den Trauernden in den herbstlich gefrorenen Kies.
Alle erstarrten. Noch bevor jemand reagieren konnte, sprang der Deckel in die Höhe und schoss mit einem höllischen Sausen direkt auf Wiglands Kopf zu. Im allerletzten Augenblick duckte er sich. Krachend und splitternd landete der Deckel an der Kirchenmauer.
Die überrumpelte Trauergemeinde drehte sich zurück zum Grab. Der Vorgang war bizarr, aber niemand schrie oder lief.
Im Sarg regte sich etwas.
Wigland überfiel eine grausige Ahnung. Er wollte sich umdrehen und rennen, aber die Trauergäste hinter ihm bildeten eine undurchdringliche schwarze Wand und bewegten stumm ihre Köpfe hin und her. Er hätte ohnehin nicht laufen können, denn seine Schuhe waren am eisigen Boden festgefroren. Er konnte sie keinen Millimeter bewegen.
Aus der Kiste erhob sich eine Gestalt.
Das konnte nicht sein!
Anna.
Wiglands siebenjährige Tochter, gekleidet in ein weißes Gewand, drehte ihren Kopf zu ihm und sah ihn mit toten, anklagenden Augen an.
Du bist nicht für mich da gewesen, sagte ihr Blick. Es ist deine Schuld.
*
Mit einem Schrei fuhr Wigland aus dem Schlaf. Sein Shirt klebte am Oberkörper. Vor der Schlafzimmertür miaute der Kater. Was für ein beschissener Traum!
Es dauerte einige Minuten, ehe er den Alb abschütteln konnte. Wie ferngesteuert erhob er sich vom Bett und öffnete die Tür.
Der Fellknäuel witschte ins Zimmer und gab den Blick frei auf ein übelriechendes Präsent.
Immer noch etwas benommen beseitigte Wigland den Katzenkot vom Teppich und ließ sich danach auf das Ledersofa im Wohnzimmer plumpsen.
Es war halb drei. Am Nachmittag. An weiteren Schlaf war nicht zu denken, obwohl er hundemüde war.
Das wuschelige Monstrum hüpfte auf die Sitzfläche, legte sich schnurrend neben ihn und blinzelte ihn vertraulich an.
»Saubär.«
Warum hatte Wigland sich überreden lassen, den greisen Maine-Coon-Kater bei sich aufzunehmen, und den ganzen Zoff mit dem Vermieter auf sich genommen, um der haarigen Dreckschleuder ein Zuhause zu bieten?
Es war seine Weichherzigkeit gewesen, was sonst? Wenn er sich nicht erbarmt hätte, wäre der Liebling seiner verstorbenen Mutter ein Opfer der Giftspritze geworden, und das war kein katzenwürdiges Ende.
Geistesabwesend strich er dem Tier über den massigen Kopf und starrte das Regal mit seiner Plattensammlung an - über zweitausend Scheiben, alphabetisch geordnet von AC/DC bis ZZ Top. Gepflegter Lärm für präpotente Buben, über den ein langsam ergrauender, achtundvierzigjähriger Kriminalkommissar mit Bauchansatz eigentlich hinausgewachsen sein sollte. Aber er mochte den Krach eben.
Der Kater schnurrte hingebungsvoll.
Ohne den Teppichkacker wäre Wigland in den letzten Wochen noch einsamer gewesen. Dabei hatte er sich selbst den Sonderurlaub verordnet, gegen Oskar Müllers ausdrücklichen Willen. Weil er sich ausgebrannt gefühlt hatte. Leer.
Der Albtraum von vorhin spülte sich wieder vor sein inneres Auge. Die Beerdigung hatte tatsächlich stattgefunden vor ein paar Monaten. Mit dem kleinen Unterschied, dass Oskars Frau Ella im Sarg gewesen und auch dringeblieben war.
Warum hatte sein Oberstübchen Ellas Beerdigung mit Anna verquickt? Warum zwei Ereignisse zusammengebracht, die nichts miteinander zu tun hatten und Jahrzehnte auseinanderlagen?
Träume sind Schäume.
Er ging in die winzige Küche der Zweizimmerwohnung und schenkte sich ein Glas Milch ein. Der Kater strich miauend um seine Beine.
Oskar hatte die Zeremonie ohne sichtbare Regung verfolgt und auch in den folgenden Wochen Ellas plötzliches Ableben nicht thematisiert. Aber natürlich war Wiglands alter Kamerad im Kern erschüttert gewesen. Der harte Hund, der sich unerbittlich an die Spitze des Systems gebissen hatte, wirkte plötzlich dünnhäutig, in die Ecke gedrängt und angefasst, viel mehr als nach dem ersten Schicksalsschlag, als sein erwachsener Sohn bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war.
Warum Herr Müller sich den Dienst weiterhin antat, hieß es immer wieder hinter vorgehaltener Hand. Wo er doch mit dem Erbe seiner Frau - mehrere Millionen Euro, sagte man - sofort sein Altenteil hätte antreten können?
Wigland nippte an der kalten Milch.
Er kannte die Antwort: Erstens gab es die Millionen wohl nicht, und zweitens brauchte Kriminalrat Oskar Müller den Nervenkitzel. Es genügte ihm nicht, die Tageszeitung zu studieren und seine Reptilien zu füttern. Nein, Oskar liebte den thrill. Ein Jagdhund starb nicht an Altersschwäche, sondern auf der Hatz. Deshalb hatte Oskar auch mit Unverständnis reagiert, als Wigland ihn um den Sonderurlaub gebeten hatte.
»Und was willst du in der Zeit machen? Nase bohren? Du bist ein Bulle, das bringt dich auch nicht weiter«, hatte Oskar geraunzt. Und ohne seinen Trauerfall wäre er wahrscheinlich stur geblieben und hätte Wiglands Bitte nicht nachgegeben. Aber schließlich hatte er den Antrag unterschrieben und seinem besten Mordermittler ermöglicht, die Nächte zu verbummeln und einen Großteil der Tage zu verschlafen.
Das Schlimmste war, dass Oskar mit seiner Skepsis richtiggelegen hatte. Der Sonderurlaub war eine Schnapsidee.
Bereits in der ersten Woche der Auszeit hatte irgendein Arschloch eine wehrlose Frau ausgeraubt und in die Wiltach gestoßen, und Wigland hatte tagelang neben dem Telefon gehockt und absurderweise gehofft, dass es klingeln und Oskar ihn beknien würde, den Urlaub zu beenden und die Ermittlungen zu leiten.
Das war natürlich nicht geschehen. Stattdessen hatte Oskar ihm eine Therapie aufs Auge gedrückt und die Aufklärung des Falles an die junge Charlotte Thürauf übertragen.
Und entgegen Wiglands hirnrissiger Hoffnung, dass sie versagen würde, verbuchte Charlie innerhalb weniger Wochen einen Erfolg und übergab einen obdachlosen Zimmermann an die Staatsanwaltschaft. Der bestritt die Tat zwar vehement, aber alle Indizien sprachen für ihn als Täter, nicht zuletzt, weil er bei seiner Verhaftung die Brieftasche der Getöteten bei sich getragen hatte. Chapeau, Charlie.
Wigland sah aus dem Fenster. Er hasste die Kälte und das verfluchte weiße Zeug, das seit Tagen aus dem Himmel rieselte und die geschirrhandtuchgroße Geschwulst an der Fassade, die sein Vermieter als Balkon bezeichnete, in eine Miniatur-Arktis verwandelte.
Verdammter Winter. Warum hatte er den Urlaub nicht in der warmen Jahreszeit genommen?
Weil sein Zusammenbruch im Herbst geschehen war, deshalb. Der Auslöser war die Sache mit Lydia gewesen, die Anna so ähnlich sah.
Seiner Anna. Die er so unsagbar vermisste.
»Es war nicht deine Schuld, das mit Anna«, hatte Oskar immer gepredigt. »Hör endlich auf, dich deswegen zu zermartern.«
Wigland hatte trotz der gutgemeinten Worte einen Psychologen aufgesucht. Der hatte einen Burnout diagnostiziert und deshalb drehte er nun Däumchen. Seit Wochen. Eine Scheißidee. Er war nun mal ein Jagdhund, so wie Oskar.
Vor lauter Langeweile hatte er mit dem Gedanken gespielt, Gemma zu besuchen, aus alter Freundschaft, sozusagen. Doch es war sinnlos, sich mit ihr zu unterhalten. Seine Ex-Frau spielte immer die gleiche Leier, war in der furchtbaren, gemeinsamen Vergangenheit festgefroren wie der Blumentopf mit dem Olivenbäumchen auf dem Balkon. Selbstmitleid in Dauerschleife.
Wigland zog seinen Laptop unter einem Haufen alter Zeitschriften hervor und surfte zu einem Online-Shop für gebrauchte Schallplatten. Er entdeckte ein seltenes Vinyl-Album von Wishbone Ash, das nicht in seiner Sammlung stand, zumindest konnte er sich nicht daran erinnern.
Kaufen. Ein gutes Gefühl. Etwas erwerben, das er einmal anhören und dann für immer vergessen würde.
Ohne besondere Absicht gelangte er auf die Seite des Dating-Portals, dessen Mitgliedschaft er Sina verdankte.
»Zehn Jahre Einsamkeit sind genug!«, hatte seine Schwester alle Proteste abgewürgt und ihm postwendend eine Mitgliedschaft eingerichtet.
Lovebistro.de - Partner mit Niveau.
Na klar. Dabei war Wigland sich gar nicht sicher, ob er überhaupt eine neue Partnerin wollte, völlig wurscht ob mit oder ohne Niveau.
Aber Sina hatte darauf bestanden.
»Ich habe keinen Bock, dir im Alter den schlaffen Hintern abzuwischen!«
Er musste grinsen. Hatte gar nicht vor, als Tattergreis zu enden.
Live fast, die young.
Yeah.
Haha. Mit achtundvierzig war er zu alt, um jung zu sterben. Trotzdem hatte er mit seiner Skepsis gegenüber der Verkuppelungsseite - selbstverständlich - recht behalten. Ein einziges Mal hatte er sich mit einer, am Telefon recht sympathisch wirkenden, Dame getroffen und danach geschworen, nie wieder ein Blind Date zu verabreden: Dornröschen68 hatte sich als billig und adipös entpuppt und außerdem gestanden, dass sie voll auf Hip-Hop abfuhr.
Outlook signalisierte, dass eine E-Mail von Sonny angekommen war.
»Die Streberin dreht voll das große Rad! Lässt sich nix von mir sagen. Sieh zu, dass du bald ins Geschäft zurückkommst, mein Bübchen. Der Weltuntergang droht!!!«
Drei Ausrufezeichen.
Wigland bleckte die Zähne.
So war sein Kollege Sonny. Übertrieb immer maßlos, aber es tat dennoch gut, zu hören, dass man vermisst wurde.
»Wird schon nicht so schlimm sein«, tippte er.
»Oh doch, sogar schlimmer! Müller hat sie mit der übergangsweisen Leitung der Abteilung betraut.«
Hoppla. Das ging schnell.
Wigland musste zurück in den Dienst, bevor diese Ehrgeizlerin Charlie seinen Laden komplett auf den Kopf stellte.
8. Kapitel
Mein Geburtstag war vorübergegangen, ohne dass sich meine Hoffnung auf einen neuen Hund erfüllt hatte.
An einem dieser Dezembertage, an denen es selbst mittags nicht richtig hell wurde, betrat ich nach der Schule unser Haus.
»Mama?«
Ich ließ meinen Schulranzen auf den Boden fallen.
»Bin wieder da!«
In der Küche klebte ein Zettel an der Mikrowelle, auf den sie ein Herz gezeichnet hatte. Das war ihr Code für: Essen ist hier drin. Hab dich lieb.
Ich holte mir Chips und Cola und setzte mich vor den Fernseher.
Als sie eine Stunde später immer noch nicht zurück war, beschloss ich, mich ohne ihre Genehmigung auf den Weg zu Sven zu machen, einem Schulfreund, mit dem ich mich zum Rodeln verabredet hatte.
Ich holte den Bob aus der Garage und zog ihn hinter mir her zum Wäldchen, auf dessen anderer Seite Sven wohnte. Der Pfad führte an einem kleinen Moorweiher vorbei, in dem wir uns im Sommer oft abkühlten.
Dort fand ich sie.
Mama hing am Ast jener Weide, auf der wir immer unsere Handtücher trockneten, wenn wir dort zusammen beim Schwimmen waren. Ihr Körper pendelte sanft im Wind.
»Friss oder stirb«, hauchte der dunkle Schatten mir ins Ohr.
Friss oder stirb.
*
Anke glaubte das Aroma von warmem Kakao auf ihrer Zunge zu schmecken, als sie das ehemalige Jagdschlösschen zum ersten Mal sah, aber das war natürlich nur Einbildung.
Das barocke Bauwerk mit dem hohen Satteldach lag südlich von Dürrweiding auf einer kleinen Anhöhe. Die nachträglich angebauten Ziererker im neugotischen Stil ließen es wie die Kulisse eines tschechischen Märchenfilms aussehen, den Anke als Winzling mit ihrer Mutter im Fernsehen geguckt hatte. Dabei hatten sie warmen Kakao getrunken und sich eng aneinander gekuschelt.
Das Schloss war hübsch, keine Frage, vielleicht ein wenig zu kitschig für ein Museum der modernen Kunst im einundzwanzigsten Jahrhundert. Und irgendetwas fehlte ihr bei diesem Anblick, aber Anke hätte nicht benennen können, worum es sich handelte.
Durch ein von zwei Säulen flankiertes Portal trat sie in eine holzvertäfelte Eingangshalle. Ebenso wie die Fassade war dieser Bereich bereits renoviert worden, und Ankes Befürchtungen verflüchtigten sich, im Nirgendwo eine Bruchbude auf Vordermann bringen zu müssen. Remigius hatte mit seinen düsteren Schilderungen heftig übertrieben. Zum Glück.
»Hallo? Zachy?«
Keine Antwort.
»Zacharias?«
Es waren Schritte zu hören, und nur wenige Augenblicke später kam der junge Galerist die mächtige Eichentreppe heruntergestolpert. Er trug eine Wollmütze und ein Flanellhemd in Ocker, dazu Hochwasserjeans mit Hosenträgern, offenbar seine Interpretation eines Hipsters.
»Anke! So eine Freude! Was machst du denn schon ... Wolltest du nicht erst in einem Monat ...?«
Die Überrumpelung war ihr gelungen.
»Auch schön, dich zu sehen, Kollege«, sagte sie grinsend. »Ich muss mich wohl bei der Terminabsprache im Kalender verguckt haben.«
Sein Stirnrunzeln zeigte, dass er ihr die Lüge nicht abkaufte. Anke hatte ihn bewusst über ihre Ankunft im Unklaren gelassen, um den wahren Zustand des Projekts ohne eilig angebrachte Beschönigungen kennenzulernen.
»Ja ... na klar.« Er kratzte sich im zauseligen Vollbart, den er sich neuerdings stehen ließ. Dann breitete er die Arme aus und drückte Anke kurz an sich. Küsschen links, Küsschen rechts. Der Gesichtsbewuchs kratzte.
»Na dann ... herzlich willkommen und so.«
Er wirkte extrem angespannt.
»Wie findest du es?« Mit einer ausladenden Geste deutete er herum und hüstelte, ganz offensichtlich, um ein Geräusch zu übertönen, das aus dem oberen Stockwerk kam.
»Bist du nicht allein?«
»Ich? Doch ... klar. Wieso?« Er hüstelte abermals und deutete an die Holzdecke: »Hier knarzt immer irgendwo etwas. Aber das macht den Charme dieses Ortes aus, findest du nicht?«
Anke konnte Begeisterungsstürme verhindern.
»Es ist nett. Doch, doch.« Und das durfte es für einen Preis von knapp zwei Millionen Euro auch sein.
»Nett ist der kleine Bruder von Scheiße«, sagte Zachy, der offenbar mehr Enthusiasmus erwartet hatte.
»Nein, es ist wirklich ... hübsch.«
Über ihnen knarzte wieder die Decke.
»Sicher, dass du nicht mal nachsehen möchtest, was da vor sich geht?«
»Iwo. Da ist nichts. Wie gesagt, das Holz arbeitet. Wo sind deine beiden Schätzchen?«
Die Situation war ihm peinlich. Er versuchte ohne Zweifel davon abzulenken, dass noch jemand im Haus war, dem Anke nicht begegnen sollte. Dabei stellte er sich jedoch so miserabel an, dass die Unwahrheit ihm aus allen Poren kroch.
»Die Kinder sind bei meiner Freundin Marlis. Dort können wir bleiben, bis wir uns hier häuslich eingerichtet haben.«
»Verstehe. Die Wohnung im zweiten Stock ist nicht riesig, müsste für euch aber locker reichen«, sagte Zachy. »Möbel bräuchtet ihr halt noch.«
»Gut. Führst du mich herum?«
Er zögerte.
»Logisch, gerne. Ehrlich gesagt, ist mir nicht klar, warum Remigius dich eigentlich schickt. Es ist alles in bester Ordnung hier, wie du siehst.«
»Ist es das?«
Anke war bei dem zweiten Geräusch klargeworden, warum ihr der Anblick des Schlosses vorhin so seltsam vorgekommen war. Es fehlten die Handwerker. Außer Zachys Moped und einem roten Nissan stand im Hof kein weiteres Gefährt. Kein Lieferwagen, kein Transporter, nicht einmal ein Fahrrad. Folglich waren keine Arbeiter vor Ort, um die Renovierungsarbeiten voranzubringen. Das erklärte auch die Ruhe. Sie hörte kein Klopfen, kein Bohren. Nichts. Und das, obwohl das Innere des Schlosses noch völlig kahl und die ursprünglich geplante Eröffnung des Museums nur wenige Wochen entfernt war.
»Wo sind die Arbeiter? Maler, Elektriker?«
»Die ... nun ja, weißt du ... es ist momentan schwer, welche zu bekommen.«
Eine weitere Unwahrheit.
»Aha. Gut, dann zeig mir mal dein Reich.«
»Ja, okay. Ich müsste nur noch schnell was erledigen. Einen Anruf. Möchtest du vielleicht erst was trinken? Kannst dir in der Zwischenzeit auch schon mal das Erdgeschoss ansehen.«
Er schob sie durch eine Tür in einen großen Raum - vermutlich das Empfangszimmer des Barons, der das Anwesen einst gebaut hatte - und verschwand. Die Wände des kleinen Saals bestanden aus unverputzten, grob behauenen Steinen. Der Holzboden war unbehandelt und es gab noch keine Beleuchtung. In der Ecke stand lediglich ein uralter Kachelofen. Um diesen Raum in eine moderne Ausstellungsfläche zu verwandeln, bedurfte es noch einer Menge Arbeit.
Noch während Anke darüber nachdachte, wie man den Saal gestalten konnte, erklangen im Obergeschoss laute Stimmen. Dann lief jemand die Treppe herunter und Sekunden später schlug im Hof eine Autotür zu. Durch eines der großen Fenster sah Anke den roten Nissan aus dem Hof fahren.
9. Kapitel
»Warum bist du gar nicht traurig?«, fragte ich ihn.
Ich erntete einen leeren Blick.
»Sie hat mich im Stich gelassen.«
Ich verstand es nicht.
»Und dich auch.«
*
Ein Jahr später brachte mein Vater SIE mit nach Hause. Sie und ihre vierjährige Tochter Eva.
Die neue Freundin meines Vaters musterte mich von oben bis unten, dann setzte sie ein Lächeln auf, das mehr für ihn bestimmt war als für mich. Es erstarb unterhalb ihrer schönen Augen.
Sie reichte mir die Hand.
»Du darfst mich Mutter nennen«, sagte sie. An der Wand hinter ihr zeichnete sich ihr großer, dunkler Schatten ab.
Bald zogen sie bei uns ein.
Sie backte die beste Pizza der Welt, mit einem krossen Rand. Den hob ich mir eines Tages als Leckerbissen bis zum Schluss auf. Sorgfältig abgetrennt lagerte die Delikatesse am Tellerrand, damit ich sie als Höhepunkt genießen konnte.
Bevor ich mich jedoch über den Rand hermachen konnte, kassierte sie ihn und legte ihn bei Eva auf den Teller.
Die schlang ihn mit einem Freudenschrei hinunter.
»Den wollte ich mir bis zuletzt aufbewahren«, protestierte ich unter Tränen und sah meinen Vater an.
»Du hättest ihn doch ohnehin weggeworfen«, sagte sie.
Mein Vater sah zur Seite.
»Ich wollte ihn essen! Wirklich«, sagte ich heulend.
»Unsinn! Schau doch, wie Eva sich darüber freut. Gönnst du es ihr etwa nicht?«
Ich schüttelte den Kopf.
Eva hatte ihren eigenen Knusperrand bereits zu Beginn weggeputzt und danach gelangweilt im erkalteten Wrack der Pizza herumgestochert.
»Sei nicht so missgünstig«, sagte mein Vater, schien mit seinen Gedanken aber schon wieder ganz weit weg zu sein, bei der Arbeit. Er streichelte Eva über den Kopf, sie streckte mir die Zunge heraus.
»Von mir hast du das nicht«, sagte er.
Währenddessen nahm Evas Mutter mir den Teller weg, noch bevor ich den Rest aufessen konnte.
An solchen Tagen flüchtete ich zu Großvater, um mich bei ihm auszuweinen, und er machte seine Späße, um mich wieder aufzumuntern. Ein schlechtes Wort über die neue Frau seines Sohnes verlor er nicht.
»Opa, von wem ist dieses Bild?«, fragte ich.
In seiner Wohnung gab es kaum einen Fleck, an dem nicht ein buntes Gemälde hing.
»Das ist von Matisse«, sagte er.
»Und hier, die Seerosen, das ist Claude Monet. Dort hängt Marc Chagall, und daneben natürlich Picasso. Und das hier hat mein Lieblingsmaler gemacht, der verrückte Vincent.«
Nur in einer Ecke hing das Foto einer ernst dreinblickenden, dunkelhaarigen Frau in einem weißen Kleid. Meine Großmutter, die schon lange tot war.
Großvater kochte uns Kakao, und wir übten zu zeichnen oder schmökerten in den Bildbänden seiner Lieblinge, allen voran des verrückten Vincent.
»Der hat sich ein Ohr abgeschnitten«, sagte er.
»Das hast du gerade erfunden, stimmt’s?«
Er schmunzelte.
Ich beschloss, auch einmal ein verrückter Maler zu werden, sollte es mit dem Indianerdasein nicht klappen. »Beamter« landete auf der Liste meiner Lieblingsberufe auf Platz drei.
Großvater hat laut gelacht, als ich das sagte. Ich habe nicht verstanden, warum, aber das war auch egal. Es zählte nur, dass in seiner Wohnung der dunkle Schatten keinen Zutritt hatte.
*
Ankes Kopf fühlte sich an, als ob darin eine Herde wilder Mustangs im Kreis galoppierte. Sie hatte viel Zeit damit verbracht, die Wohnung im zweiten Stock des Schlosses so weit herzurichten, dass sie mit Cora und Mara dort einziehen konnte, und erst heute die Muße gefunden, sich mit ihrer eigentlichen Aufgabe auseinanderzusetzen.
Sie kniete in dem großen Raum, den Zachy im ersten Obergeschoss der Jagdresidenz als Büro eingerichtet hatte. Schreibtisch und Fußboden waren übersät mit Bauplänen, Aktenordnern und losen Blättern, in die sie Ordnung zu bringen versuchte. Der Verursacher des Chaos hatte ihr einen Stapel mit Papieren übergeben und gemurmelt, sie solle sich keine Sorgen machen, er habe bereits einen Plan, wie es weitergehen könne. Dann war Zachy auf seine alte Zündapp gestiegen und seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Das war jetzt zwei Wochen her. Seitdem ging Zachy weder an sein Telefon noch beantwortete er SMS-Nachrichten.
Anke stand auf, ging zu einem der Fenster und ließ frische Luft herein, um die Wildpferde im Kopf etwas zu beruhigen.
Draußen riss gerade der Himmel auf, ein fetter Mond kam zum Vorschein und streichelte Schloss und Anhöhe mit einem bläulichen Licht, das vom Schnee millionenfach reflektiert wurde. Die Welt war eingefroren, nichts rührte sich.
Oder doch? War dort nicht soeben ein Schatten aus dem kleinen Buchenwald gehuscht? Anke sah genauer hin, konnte aber keine Bewegung mehr erkennen. Was sollte hier draußen auch sein? Ein Fuchs oder ein Reh vielleicht.
Es war unwahrscheinlich, dass es sich um Zachy handelte. Sein Moped gab wegen seines kaputten Auspuffs ein hässliches Geräusch von sich, das Anke von aller Weite gehört hätte.
Sie schloss das Fenster wieder.
Wo steckte er bloß?
Anke hatte überhaupt nicht verstanden, was er gemeint hatte, als er im Weggehen rief, er werde die Kuh schon wieder vom Eis holen. Dann hatte sie heute den ersten Aktendeckel aufgeschlagen und war in ein Labyrinth von Rätseln eingetaucht.
Sie kniete sich wieder vor die Papiere.
»Was hast du dir dabei gedacht?«, flüsterte sie. »Über zweihunderttausend! Wofür hast du das ganze Geld ausgegeben, verdammt nochmal?«
Ankes Armbanduhr zeigte halb zwölf. Sie fasste sich an die Stirn und massierte ihre Schläfen, während sie weiter den Ordner mit den Zahlen des Geschäftskontos anstarrte. Remigius hatte für das Museum sein Privatvermögen angezapft und Zachy offenbar blind vertraut, dass er das Geld sinnvoll einsetzen würde. Aber allem Anschein nach hatte der Armleuchter nicht im Traum daran gedacht. Wenn man die Summen aller Rechnungen überschlug und mit den Kontoauszügen verglich, ergaben sich erhebliche Differenzen. Große Summen fehlten, deren Verwendung Zachy nirgends dokumentiert hatte.
Wie sollte Anke mit diesem Debakel umgehen? Am liebsten wäre sie sofort wieder abgereist. Zurück nach Köln. Heim in die Komfortzone.
Unsinn.
Beim Umblättern blitzte an ihrem kleinen Finger ein Ring auf. Ein feines Schmuckstück aus Silber, das ihre Mutter am Ringfinger getragen hatte, mit einem Rubin, kaum größer als ein Stecknadelkopf.
Nicht verzagen, du kriegst das schon hin. Alles wird sich aufklären.
Die letzte Rechnung, die Zachy abgeheftet hatte, stammte vom Oktober. Es war die vierstellige Forderung eines Klempners. Danach schien Zachy jegliche Tätigkeit in dem Jagdschloss eingestellt zu haben. Etwa zur selben Zeit hatte er von dem üppig ausgestatteten Geschäftskonto innerhalb weniger Wochen über zweihunderttausend Euro abgehoben.
Warum hatte Remigius ihm bloß - ganz entgegen seiner sonstigen Art - uneingeschränkte Vollmacht gewährt?
Anke stöhnte leise. Die Aufgabe, auf die sie sich eingelassen hatte, war unter diesen Umständen unlösbar. Hoffentlich tauchte der Idiot bald wieder auf. Es gab dringenden Redebedarf.
Sie versuchte, das keckernde Lachen auszublenden, das wie ein leises Echo durch ihr Gehirn geisterte, kleinlaut und krächzend nur, aber doch deutlich vernehmbar.
»Sei still!«, flüsterte sie und drehte an dem Ring mit dem roten Edelstein. Äitis Erbe.
Das Gelächter verstummte wieder.
Gottseidank.
Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Baustelle hatte Anke bereits gesehen, dass Zachy das Schlösschen im Grundriss so umgestaltet hatte, dass es Ausstellungs- und Verkaufsräume beherbergen konnte, die einem modernen Museums- und Galeriebetrieb gerecht wurden. Leider waren die neu geschaffenen Flächen noch völlig kahl und unbeleuchtet, abgesehen von einigen Provisorien. Außerdem fehlte die komplette Inneneinrichtung, für die die Restsumme vorgesehen gewesen war. Zu seiner Entschuldigung hatte Zachy unablässig irgendwas von unzuverlässigen Handwerkern gestottert.
Das hämische Kichern in ihrem Kopf hob erneut an.
Du weißt, was zu tun ist, krächzte die verhasste Koboldstimme.
Alles wird einfach, wenn du mir vertraust, flüsterte sie.
Ja, alles würde leicht werden, wenn sie dem Vorschlag des hässlichen Kobolds folgte. Alle Sorgen wären mit einem Schlag vergessen. Nur um einen Tag später mit doppelter Macht zurückzukehren.
Anke begann zu zittern. Äitis Ring blitzte erneut.
Nein. Sie würde dem widerlichen Sucht-Gnom nicht abermals Gewalt über ihr Leben geben, selbst wenn er sie anbrüllte wie ein Höhlentroll. Schlechte Nachrichten waren sein Labsal, und davon bekam er gerade reichlich. Aber: nein. Dieses Mal nicht! Nie wieder.
Anke schüttelte sich, und die Stimme verstummte.
Warum hatte Zachy so kurz vor dem Ziel aufgegeben? Und was war mit dem ganzen Geld geschehen? Sofern Anke es beurteilen konnte, hätte die veruntreute Summe locker ausgereicht, um damit die Arbeiten am Gebäude zu beenden und die Eröffnung des Museums durchzuführen, mit all dem luxuriösen Understatement, das ihre Branche so liebte.
Ankes Herz zog sich zusammen. Daraus würde angesichts dieser Sachlage so schnell nichts werden. Was war also der nächste Schritt?
Remigius.
Ich muss ihn informieren, aber wie bringe ich ihm das nur alles bei?
Anke wusste, wie bedeutsam Geld für den Galeristen war. Es würde ein sehr unangenehmes Gespräch werden. Aber was blieb ihr anderes übrig?
»Es muss sein«, murmelte sie. Jedoch nicht mehr heute, dafür war es bereits zu spät. Es würde das Erste sein, was sie morgen tat.
Aus dem Erdgeschoss drang ein Geräusch nach oben.
Anke lauschte. War Zachy vielleicht doch unbemerkt zurückgekehrt und hatte eine ihrer Umzugskisten umgestoßen, die sie vorhin achtlos in der Eingangshalle aufeinandergestapelt hatte?
»Zachy?«
»Zachy? Bist du das?«
Was, wenn es nicht ihr Kollege war, der durch das Schloss geisterte? Sie war ganz allein hier draußen, und niemand würde ihr im Notfall zu Hilfe eilen. Die Kinder waren bei Marlis, wo ein Zimmer für sie freigeräumt worden war, bis die Wohnung im Schloss bezugsfertig war.
Anke erhob sich, ging zur Tür und lauschte durch den Spalt in die Schwärze des Treppenhauses.
Bitte keine Ratten, schoss ihr durch den Kopf. Alles, nur das nicht! Allein die Vorstellung dieser ekligen Viecher erzeugte eine Gänsehaut. Aber ein Einbrecher wäre wohl noch schlimmer.
Alles dummes Zeug. Was gab es in dieser trostlosen Bude schon zu stehlen? Außerdem hatte sie alle Türen fest verschlossen. Hatte sie doch, oder? Jetzt war jedenfalls nicht der Zeitpunkt, um das zu überprüfen.
Nichts war zu hören. Sie musste sich getäuscht haben. Oder knarzte gerade die Holztreppe, die nach oben führte?
Sie stellte sich Jack Nicholson aus The Shining vor, wie er mit der riesigen Axt die Treppe heraufschlich, um ihr den Schädel zu spalten. Verdammter Stephen King.
Angestrengt lauschte sie, hörte aber nur Stille. Als sie die Tür zum Büro schloss, dachte sie kurz darüber nach, den Schlüssel umzudrehen, verwarf diesen albernen Gedanken aber. Welchen Grund gab es, sich hier einzuschließen?
Nu krieg dich mal wieder ein. Ist ein altes Gemäuer, gewöhn dich dran.
Sie nahm das Handy aus der Tasche ihrer Fleecejacke und überprüfte, ob es noch funktionstüchtig war. Fünf Balken, so wie vor zehn Minuten. Alles gut.
Ihr Blick fiel auf die Tür.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739457345
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (Juni)
- Schlagworte
- Rache Psychothriller Tod Entführung Krimi Spannung Suspense Mörder Vergangenheit