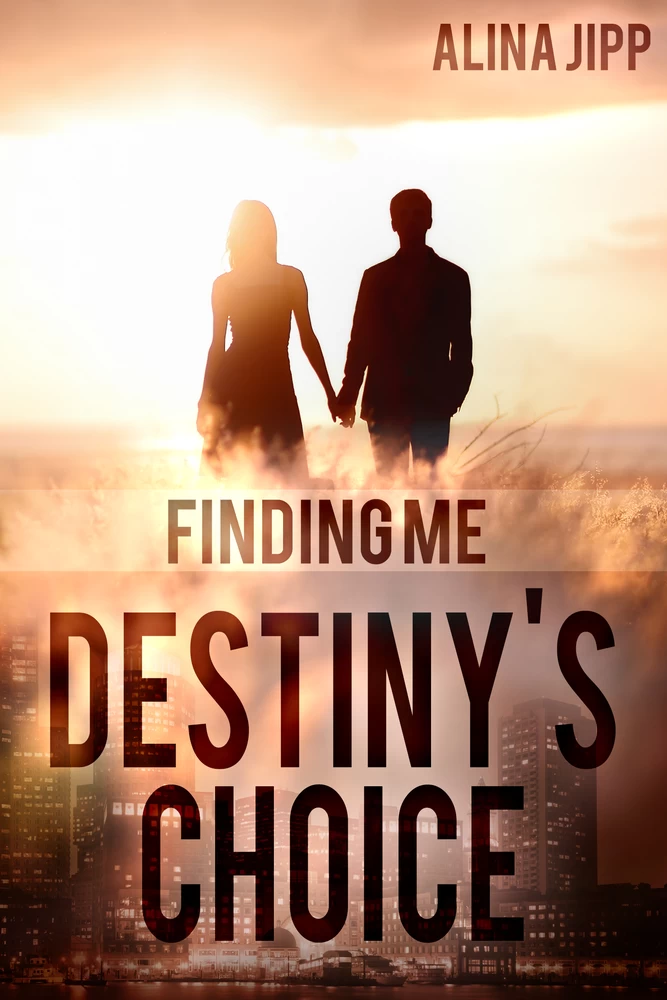Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Alina Jipp
Destiny’s Choice – Finding me
Dean
Springbreak
Springbreak bedeutete feiern ohne Ende und genau das wollte ich tun. Auch wenn die Art, auf die meine Kommilitonen das machten, nicht unbedingt meinen Vorstellungen entsprach. Oder zumindest das, was sich meine Kommilitonen darunter vorstellten. Bierpong war nicht wirklich mein Ding, aber die Musik war ganz in Ordnung, und die Stimmung spitze. Dennoch wollte ich mehr. Ich hatte meine eigene Art, um die Party zu verbessern. Zwei heiße Weiber - Zwillinge noch dazu - und eine Flasche Schampus. Was brauchte es mehr, um den perfekten Abend zu erleben? Na ja, das war vielleicht etwas übertrieben, aber gut war er auf jeden Fall, und er hatte obendrein noch Möglichkeiten, sich zu steigern. Daisy - oder war es Tiffany? - eigentlich egal, eine kicherte jedenfalls und setzte die Flasche gleich an den Mund. Dabei legte sie ihren Kopf extra nach hinten, um besser schlucken zu können. Im Grunde konnte ich dieses alberne Gehabe nicht ausstehen, doch heute hatte ich bereits so viel getrunken, dass mir sogar das sympathisch war. Eventuell gefielen mir auch einfach die Blicke der anderen, denen sehr wohl klar war, dass sie gegen mich keine Chance hatten. Selbst meine Kumpels wussten das, nahmen es aber mit Humor. Der Name Kennedy und das Geld meiner Familie zogen die Weiber an wie die Motten das Licht.
Springbreak - das Ende des Wintersemesters, und ich hatte es noch einmal geschafft, nicht von der Uni zu fliegen. Zum Teil lag das wahrscheinlich ebenfalls an meinem Namen. Obwohl ich nicht mit den Kennedys verwandt war, oder zumindest nur um zwanzig Ecken, so öffnete dieser Name in der Tat viele Türen. »Nomen est omen«, wie man so schön sagt. Die Kohle meines Vaters störte dabei natürlich auch nicht. Immerhin spendete er der Universität jedes Jahr beträchtliche Summen. Die Profs hatten jedenfalls beide Augen zugedrückt und mich trotz diverser Fehlzeiten nicht überall durchfallen lassen. Das musste ich einfach feiern, bis die Schwarte krachte. Was sollte ich auch sonst tun? Zu Hause hocken und mich langweilen? Meine Eltern hielten sich nicht in der Stadt auf - wann waren sie auch mal hier? Ich hatte also sturmfrei, und vielleicht konnte ich die Zwillinge zum Nacktbaden in unserem Pool überreden. Das wäre noch besser als diese Party hier im Haus von irgendwem.
Allein bei dem Gedanken an die beiden neunzehnjährigen Cheerleader ohne Klamotten, lief mir das Wasser im Mund zusammen. Ich konnte fast jede haben. Also warum zögern, wenn die Auswahl so gut war? Zudem waren Zwillinge etwas Besonderes, sozusagen das Sahnehäubchen, ein solches Vergnügen hatte ich bisher noch nicht gehabt. Das wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen.
»Kommt, Ladys, wir machen eine Spritztour mit meinem Porsche und fahren zu mir. Die Party ist doch ziemlich lahm.« Das stimmte so zwar nicht, aber Sex war besser als saufen, und auf Zuschauer stand ich nicht so. Jemand könnte Bilder machen oder mich filmen, dann wäre es garantiert aus mit der Großzügigkeit meiner Eltern. Sie machten viel mit, duldeten auch, dass ich im vierten Studienjahr noch immer kein Hauptfach gewählt hatte, nur wenn es um ihren Ruf ging, da hörte der Spaß auf. Der Schein war schon immer wichtiger gewesen als alles andere. Was man hinter verschlossenen Türen tat, war dagegen völlig egal. Hauptsache, die Öffentlichkeit bekam nichts davon mit. Mein Vater vögelte seine Sekretärin - bedeutungslos. Meine Mutter trank bereits morgens um sieben Uhr Wodka - ging keinen etwas an. Wichtig war nur, dass sie auf Veranstaltungen nüchtern war, sich Hand in Hand mit ihrem - sie liebenden - Ehemann zeigte und lächelte, lächelte und noch einmal lächelte. Damit am nächsten Tag in allen Zeitungen etwas Positives über das Vorzeigepaar Theodor und Valeria Kennedy stand und Kennedy Enterprises in der Folge noch lukrativere Geschäfte abschloss. Später sollte ich genauso sein und in Dads Fußstapfen treten. Glücklicherweise zwang er mich nicht dazu, das schon jetzt zu tun. Seiner Meinung nach durfte ich mir ruhig die Hörner zuerst richtig abstoßen, solange es niemand erfuhr. Irgendwann würde ich dann sicher so weit sein, um in die Firma einzusteigen. Viel Sinn sah ich darin allerdings nicht. Ich konnte doch einen Geschäftsführer einstellen und einfach das Geld kassieren, aber das musste ich Dad ja nicht auf die Nase binden.
Tiffany und Daisy folgten mir aufgeregt zum Parkplatz. Man, war der heute voll besetzt mit Edelkarossen. Hoffentlich hatte keiner meinen Wagen zerkratzt, sonst würde ich ausrasten. Den 911-Turbo hatte ich erst zu Weihnachten bekommen, und der war mein Heiligtum. Zum Glück war alles in Ordnung, wie mir ein Rundumblick zeigte.
»Der hat ja nur zwei Sitze.« Tiffany - oder war es Daisy? Ich sollte die beiden irgendwie markieren - schmollte.
»Ach, das macht doch nichts. Mit eurer Hammerfigur passt ihr doch locker zu zweit auf den Sitz, und wir haben es ja nicht weit.« Das stimmte zwar nicht so ganz, von diesem Haus bis zum Wohnsitz meiner Familie musste man schon zwanzig Minuten fahren, aber darüber wollte ich jetzt nicht diskutieren. Wenn die Zwillinge erst einmal im Wagen saßen, wäre die Entfernung sicher bald zweitrangig. Morgen früh konnte ich ihnen ja ein Taxi bestellen. Tagsüber gab es ständig Polizeikontrollen. Jetzt, um ein Uhr nachts, war es dunkel genug, um nicht gleich gesehen zu werden, zumal die Cops während des Springbreaks sowieso oft beide Augen zudrückten. Angehalten zu werden wäre so oder so eine Katastrophe. Mein Alkoholpegel war viel zu hoch und die Mädchen erst neunzehn, also zu jung, um Alkohol überhaupt konsumieren zu dürfen. Aber das interessierte mich heute nicht, ich war ein Sonntagskind, und auch hier würde mir nichts passieren. Nach drei Minuten Diskussion zwischen den Zwillingen stiegen sie schließlich ein.
»Na geht doch«, murmelte ich, schwang meinen Arsch auf den Fahrersitz und ließ das Verdeck herunter. Natürlich war mein 911er ein Cabrio, immerhin lebten wir im Sonnenstaat Florida, und obwohl es erst März war, sanken die Temperaturen in dieser Nacht kaum unter zwanzig Grad. Ich drehte die Musik laut auf und fuhr los. Anfangs für meinen Geschmack viel zu langsam, denn sowohl der Parkplatz als auch die Straße waren völlig zugeparkt. Endlich hatte ich die nähere Umgebung der Party verlassen und gab Gas. Der Wagen flog nur so über die Fahrbahn, und die langen, blonden Haare der Zwillinge wehten im Wind. Konnte es etwas Schöneres geben?
Wir hörten Musik, lachten und redeten. So dämlich, wie ich vermutet hatte, waren die beiden gar nicht. Sie studierten in Harvard, während ich es nur in der Stadt zur Uni geschafft hatte. Aber wen interessierte das schon? Ich brauchte keinen Abschluss einer Elite-Uni, denn auch ohne würde mir das Geld nie ausgehen. Ich sah gar nicht ein, mich wie mein Vater abzurackern und dabei meine Familie zu vernachlässigen. Mein Leben gehörte nur mir, und ich wollte nichts anderes, als mich zu amüsieren. Arbeiten war etwas für arme Schlucker und Idioten, die nicht wussten, wie schön das Leben sein konnte. Seit mir bekannt war, dass die Zwillinge nur zu Besuch in der Stadt weilten, gefielen sie mir noch besser. So erwarteten sie wenigstens keine Beziehung mit mir und waren offen, sonst wären sie wohl kaum zu mir in den Wagen gestiegen. Hoffentlich so offen, dass wir später zu dritt das Bett teilen konnten.
Das Lied wechselte zu Highway To Hell, und ich trat automatisch fester aufs Gas. Dass wir uns noch immer innerhalb der Stadt befanden, interessierte mich nicht. In dieser Gegend hatten die Cops Besseres zu tun, als auf Raser zu achten. Hier lebte der Abschaum von Miami. Die Siedlungen, in denen die Sozialfälle hausten, standen dicht an dicht. Nur die zum Stadtrand angrenzenden Trailer-Parks waren noch schlimmer. Dort liefen wahrscheinlich um diese Uhrzeit nur Gauner, Verbrecher, Alkoholiker und Drogensüchtige herum. Mit meinem 911er war es besser, so schnell wie möglich zu verschwinden, ehe sich noch jemand an meinem Baby vergreifen konnte. Gerade dachte ich darüber nach, als ich abgelenkt wurde. Eines der Mädel hatte mit einem Mal eine Zigarette in der Hand.
»Hey, in meinem Wagen wird nicht geraucht!« Nicht auszudenken wenn sie mir ein Loch ins Leder der Sitze brennen würde. Einen winzigen Moment lang - es konnten nicht mehr als zwei Sekunden gewesen sein - war ich nicht bei der Sache, und schon nahm das Unglück seinen Lauf. Es ging alles so schnell, dass ich nur Bruchstücke vor meinen Augen sah.
Ein Wagen mit defekten Rücklichtern tauchte direkt vor mir auf. Mit voller Kraft trat ich auf die Bremse. Der Wagen brach aus. Wir schleuderten direkt auf ein Haus zu, durchbrachen die großen Fensterscheiben und einen Teil der Mauer. Überall war Staub. Steine und Scherben prasselten auf uns herab. Ein schriller Schrei drang an meine Ohren, als eine der Zwillinge aus dem Wagen geschleudert wurde. Dann war alles still, und es wurde dunkel.
Destiny Arizona
Hoffnung?
Als der Wecker klingelte, stand ich nur widerwillig auf. Heute war ich so müde wie schon ewig nicht mehr. In der Nacht musste sich Virginia vor Husten zweimal übergeben. Dadurch hatte auch ich so gut wie gar nicht geschlafen, da ich unbedingt verhindern wollte, dass unsere Mutter oder die anderen Kinder geweckt wurden. Im Trailer eine fast unmögliche Aufgabe, immerhin waren die Wände kaum dicker als Papier. Aber ich hatte es trotzdem irgendwie geschafft. Außer der Kleinen und mir konnten alle durchschlafen. Sie müsste dringend zum Arzt, aber wie sollten wir das bezahlen? Obwohl wir, dank Obama Care, jetzt wenigstens einen Versicherungsschutz hatten, so übernahm diese Versicherung doch längst nicht alle Kosten. Moms letzte Behandlung hatte jeden Cent, den wir vorher vom Mund absparen mussten, verschlungen, sodass wir uns im Moment einfach keine weitere Arztrechnung leisten konnten.
»Gott wird schon alles richten, Ari. Mach dir keine Sorgen.« Moms Gottvertrauen hätte ich gern. Wenn es nicht so traurig gewesen wäre, hätte ich sogar lachen müssen. Ich glaubte schon lange nicht mehr an Gott oder Gerechtigkeit oder sonst an irgendjemanden außer mich selbst. Wenn ich Virginia zu einem Arzt bringen wollte, musste ich versuchen, mehr zu arbeiten, um das Geld zusammenzubekommen. So einfach war das. Natürlich gab es eine Praxis, in der Leute ohne richtige Krankenversicherung in Notfällen umsonst behandelt wurden. Aber die definierten Notfall anders als ich. Ansonsten konnte man sich auf dieser Welt nur darauf verlassen, dass man im Stich gelassen wurde. Meinen Erzeuger kannte ich nicht, die Väter von Georgia, Savannah, Virginia, Dakota und Maine kannten wir zwar, aber sie kümmerten sich trotzdem nicht um ihre Töchter, selbst jetzt nicht, da Mom so krank war. Es interessierte sie einfach nicht. Auf Männer konnte man sich halt noch weniger verlassen als auf Frauen. Das sah man ja auch an meinem Bruder ... Aber vor ihm hatten wir noch mindestens zwei Jahre Ruhe. Denn er saß im Knast, ohne Chance auf Bewährung.
Nachdem ich die Kleinen, außer Virginia, die inzwischen ganz fröhlich vorm Fernseher saß, zum Schulbus gebracht, meiner Mutter und der Kleinen alles für den Tag bereitgestellt hatte, ging auch ich zur Schule. Allerdings konnte ich mich heute nicht wirklich konzentrieren, meine Gedanken schweiften während des Unterrichts immer wieder zur Jobsuche ab. Erst ein Kichern riss mich aus den Gedanken an meine Geldprobleme. Verunsichert sah ich auf und erblickte rundherum nur feixende Klassenkameraden sowie das erwartungsvolle Gesicht meines Mathelehrers. Ich hatte völlig vergessen, dass ich ja im Mathekurs saß, und wahrscheinlich hatte Mr. Davidson mich gerade etwas gefragt.
»Destiny Arizona Clark. Geh endlich an die Tafel und zeig uns den Rechenweg.« Seufzend stand ich auf und schlich nach vorn. Das konnte noch heiter werden. Ich hatte keine Ahnung, um welche Aufgabe es gerade ging, und weder einer meiner Mitschüler noch Mr. Davidson dachten daran, mir zu helfen. Sie genossen es viel zu sehr, mich zu demütigen. Niemand unterstützte den Freak der Klasse. Die anderen Lehrer nicht und Mr. Davidson – der sadistische Mathelehrer – schon gar nicht, das zeigte ja schon, dass er mich bei meinem vollen Namen rief. Konnte er nicht Ari zu mir sagen? Das klang nicht ganz so furchtbar. Viele Schüler hatten Spitznamen, die er auch benutzte, nur mich musste er immer bei meinem richtigen Namen nennen. Er hasste mich regelrecht. Normalerweise war ich ein Ass in Mathe und hatte ihn schon mehr als einmal auf Fehler aufmerksam gemacht. Aber heute war ich zu abgelenkt gewesen, um überhaupt zu wissen, was er von mir wollte. Alle Mathekünste halfen nicht, wenn man die Aufgabe nicht kannte.
»Na wird es bald, Miss Clark? Die Rechnung bitte.« Er grinste mich so hämisch an, dass ich ihn am liebsten geschlagen hätte. Aber das kam natürlich nicht infrage.
»Tut mir leid, Mr. Davidson. Ich war kurz in Gedanken und habe die Aufgabenstellung verpasst.« Schuldbewusst sah ich nach unten und hoffte, er hatte Erbarmen mit mir. Ich brauchte einfach gute Noten, um mir nicht alle Chancen auf ein Collegestipendium zu verbauen, und wenn ich dafür ab und zu arschkriechen müsste, dann war das halt so. Stolz wäre in dieser Situation völlig unangebracht. Wer nichts hatte, konnte sich das nicht leisten. Doch Mr. Davidson kannte keine Gnade.
»Setzen, sechs.« Mehr sagte er nicht, und die halbe Klasse fing an zu lachen, während ich zurück zu meinem Platz schlich. Wie gern hätte ich diesem Arschloch die Meinung gesagt, aber ich schluckte es - wie so oft - herunter. Jetzt aufzubegehren würde alles nur noch schlimmer machen. Wen interessierten schon die Collegeträume eines Mädchens aus dem Trailerpark? Für die meisten stand sowieso fest, dass aus mir nie etwas werden würde.
Ich gehörte zum Abschaum der Gesellschaft, und so sehr ich meine Mutter liebte, mit den Namen, die sie meinen Geschwistern und mir gegeben hatte, war es nicht leichter, dagegen anzukämpfen. Wer außer ihr benannte seine Kinder denn auch nach Bundesstaaten und Städten, in die sie einmal reisen wollte, es aber doch nie schaffen würde?
Geschmack hatte sie nicht. Weder bei Männern noch bei Namen, aber sonst war sie wirklich eine gute Mutter. Sie riss sich den Arsch für uns Kinder auf, wenn sie gesund und dazu in der Lage war. Nur war sie zurzeit so schwach, dass sie kaum arbeiten konnte. Die letzte Chemo hatte sie richtig ausgeknockt, und außerdem musste jemand die Kinder betreuen, wenn ich in der Schule war. Das »Hope for Kids« - eine karitative Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote bekamen – war derzeit geschlossen. Mom war nicht zu stolz, um diese Hilfe anzunehmen. Ein Idiot war mit seiner Luxuskarre in das Haus gerast. Natürlich betrunken. Nun musste das Gebäude erst in Teilen wieder aufgebaut und der Rest renoviert werden, ehe die Kids wieder hinkonnten. Leider fehlte das Geld an allen Ecken und Enden, da der Verein nur von Spendengeldern lebte. Wenn wir Pech hatten, würde es Monate oder gar Jahre dauern, bis es erneut eröffnen konnte. Ich hatte mich selbstredend gleich als Helferin für die Renovierung gemeldet, aber die musste noch warten, zuerst waren die Schäden am Gemäuer dran. Bereits seit Tagen fragte ich mich auch, weshalb sich das so hinzog. Der Unfall war einige Wochen her und der Typ doch ganz bestimmt versichert, warum zahlte seine Versicherung dann nicht einfach alles? Wozu bezahlte man die sonst? Doch wenn ich so etwas sagte, lachten die Erwachsen mich nur aus. Dabei war ich selbst eigentlich schon erwachsen. Immerhin war ich achtzehn. Und nur noch nicht im Abschlussjahr der Highschool, weil ich ein Jahr pausiert hatte, um mich um meine Mutter und die Kleinen zu kümmern, als es ihr richtig schlecht ging.
Die Vertrauenslehrerin hatte mir deswegen ins Gewissen geredet. Ihrer Meinung nach machte sich die Pause nicht gut im Zeugnis und würde mir bei dem Versuch, ein Stipendium zu bekommen, Probleme bereiten. Aber was hätte ich tun sollen? Sie waren meine Familie und brauchten mich, also gab es gar keine andere Lösung. Sollte ich meine - an Leukämie erkrankte - Mutter einfach im Stich lassen? Oder meine Geschwister? Den leisen Gedanken, dass ich auch gar nicht weggehen konnte zum Studieren, verdrängte ich immer wieder schnell, wenn er kam. Ein Jahr blieb mir noch bis zum Highschoolabschluss. Bis dahin hatte sich bestimmt ein Stammzellenspender gefunden und Mom wurde endlich wieder gesund. Dann konnte ich ganz ohne schlechtes Gewissen an eine gute Uni gehen und Medizin studieren. Mein Traum, Ärztin zu werden und Familien wie uns zu helfen, begleitete mich bereits seit Jahren. Viele hielten die Menschen im Trailerpark für Abschaum und sicherlich stimmte das auch teilweise. Ein paar Leute, die hier lebten, hatten ihre Situation selbst verschuldet, aber bei vielen war es einfach Pech. Das Leben in den USA war hart und der Traum vom Tellerwäscher zum Millionär erfüllte sich nur selten. Eher landeten Menschen aus der Mittelschicht wegen Arbeitslosigkeit oder Krankheit hier und mussten plötzlich in einem Wohnwagen hausen. Bei uns war es ja auch so. Bis Mom krank wurde, hatten wir noch in einer Fünfzimmerwohnung mit einem Minigärtchen gelebt. Derrik, der Vater von Maine, Virginia und Dakota, hatte bei uns gelebt und seinen Anteil zum Unterhalt der Familie geleistet. Er hatte einen guten Job, Mom war halbtags arbeiten gegangen. Bis sich mit der Diagnose Leukämie von einem Tag auf den anderen alles geändert hatte. Derrik hatte angefangen zu saufen und seinen Job verloren, Mom war immer öfter zu schwach gewesen, um ihren Job ausführen zu können ... Dadurch waren wir hier gelandet und gezwungen gewesen, das Beste daraus zu machen. Wenn ich eins von meiner Mutter gelernt hatte, dann nie aufzugeben. Deshalb brachte ich auch den Rest des Schultages bestmöglich herum, ignorierte die dämlichen Sprüche meiner Klassenkameraden und beeilte mich, nach Schulschluss nach Hause zu laufen. Unterwegs kaufte ich noch schnell ein. Viel Geld hatte ich zwar nicht, aber für Nudeln mit Tomatensoße reichte es gerade so. Mr. Prayer, der Besitzer des Gemüseladens, in dem ich manchmal aushalf, winkte mich zu sich heran.
»Guten Tag, Mr. Prayer, kann ich Ihnen helfen?« Ich drückte heimlich die Daumen. Nicht nur, dass er gut bezahlte, er gab mir auch noch manchmal Obst und Gemüse extra mit. Vitamine waren so wichtig für Mom und auch für die Kinder.
»Hast du am Samstag Zeit? Ich muss zum Großmarkt, und meine Frau schafft es nicht allein im Laden.« Natürlich hatte ich da Zeit, begeistert sagte ich zu. Ganze acht Stunden Arbeit warteten auf mich, für die er mir achtzig Dollar versprach. Wer - außer ihm - zahlte einem Schulmädchen schon zehn Dollar pro Stunde? Die meisten versuchten sogar, unter dem Mindestlohn zu bleiben, schließlich gab es genug Menschen, die dringend einen Job suchten. Die Arbeitgeber waren nicht auf ein junges Mädchen wie mich angewiesen.
Ich verabschiedete mich und lief schnell weiter Richtung Trailerpark. Ich beeilte mich, damit die Kleinen Mom nicht zu sehr belasteten. Etwa hundert Meter vor dem Gebäude von ›Hope vor Kids‹ blieb ich staunend stehen. Hier tat sich etwas. Mehrere Baumaschinen standen bereit, und es sah so aus, als wollten sie das Haus abreißen. Das durfte doch nicht wahr sein. Eine ganze Traube von Menschen hatte sich auf der Straße versammelt, und ein Mann mit Bauhelm, der vor dem Eingang auf einer Art provisorischer Bühne stand, erklärte irgendetwas. Ich musste unbedingt näher heran, um zu erfahren, was hier los war. Sie konnten das ›Hope‹, wie viele es nur nannten, doch nicht einfach abreißen. Für viele Kinder im Viertel würde das den endgültigen Absturz bedeuten. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, dass die Kleinen wie Utah - mein Bruder - enden könnten. Er hatte sich mit den falschen Leuten eingelassen und krumme Dinger gedreht. Nun saß er deswegen im Knast und war dort auch noch einer Gang beigetreten. Seine Zukunft sah ich klar vor mir, und sie war alles andere als das, was ich für meine anderen Geschwister erhoffte.
So schnell es ging, drängelte ich mich nach vorne. Hoffentlich bekam ich das Wichtigste noch mit. Sonst musste ich mich auf den Klatsch der Leute verlassen, und ich wusste genau, dass da vieles verfälscht wurde. Der eine ließ etwas weg, der nächste übertrieb ein wenig und am Ende wurde etwas völlig anderes erzählt als die ursprüngliche Geschichte.
»... Der Neubau wird etwa vier Wochen dauern. Also kann ›Hope for Kids‹ in spätestens sechs Wochen - besser als jemals zuvor - neu eröffnet werden. Ich hoffe, damit die Schuld meines Sohnes ein bisschen wiedergutmachen zu können. Um seine Reue zu zeigen, wird er außerdem ein Jahr lang in den Semesterferien und an den Wochenenden hier mitarbeiten. Das ist viel sinnvoller als ihn ins Gefängnis zu schicken.« Die Menschen um mich herum fingen zu klatschen an, und der Mann, der gesprochen hatte, schob einen Jüngeren - wahrscheinlich seinen Sohn - nach vorne. Ich stand inzwischen fast vor ihnen und sah genau, wie der Sprecher dem anderen etwas zuflüsterte. Dieser nickte und lächelte gequält. Irgendwie sah er aus, als würde er sich ganz weit weg wünschen. Doch ich hatte kein Mitleid mit ihm. Was war ein Jahr hier aushelfen gegen den Schaden, den er angerichtet hatte? Ich half oft freiwillig im ›Hope‹ mit, einfach weil es eine gute Sache war.
Dean
Veränderungen
Mein Vater stand neben mir und musste sich - wie immer - aufspielen. Wenn er so weitermachte, würden mich die Leute noch für meinen Fehler feiern. Schließlich versprach er ihnen gerade nicht nur einen Neubau dieser Baracke, sondern ein größeres, moderneres Gebäude. Beinahe wäre mir ein Lachen entwichen, unterdrückte es aber schnell, denn das wäre jetzt wohl absolut unangebracht. Dad hatte mir extra eingetrichtert, zerknirscht auszusehen, um allen zu zeigen, wie sehr ich den Unfall bedauerte. Dabei beobachtete ich unauffällig die Menschen vor der improvisierten Bühne, die nur aus ein paar notdürftig zusammengebauten Brettern bestand. Hoffentlich brach das Ding nicht noch unter uns zusammen. Auf keinen Fall wollte ich schon wieder ins Krankenhaus. Da hatte ich in den letzten Wochen für meinen Geschmack bereits viel zu viel Zeit verbracht, wenn auch nur als Besucher. Eine von Dads Anordnungen, um mein Bedauern zu zeigen. Immerhin hatte Tiffany, die bei dem Zusammenprall aus dem Wagen geschleudert worden war, fast vier Wochen dort gelegen, und er hatte mich gezwungen, sie täglich aufzusuchen. Egal wie unwohl wir beide uns in der Besuchszeit gefühlt hatten.
Noch nie hatte ich solche Probleme mit meinem Vater gehabt wie nach diesem dämlichen Unfall. Er hatte mich sogar enterben wollen, und wenn ich nicht absolut nach seiner Pfeife tanzte, würde er es wirklich tun. Vorbei war es mit dem Gammeln an der Uni. Plötzlich erwartete er Leistung von mir. Außerdem hatte er mir angedroht, dass ich zukünftig nicht mehr herumhängen konnte, denn meine Freizeit wollte er mir streichen. Er hatte da auch etwas mit dem Richter, der meinen Prozess leitete, ausgehandelt. Was, wusste ich bisher nicht, aber ich fürchtete, es noch früh genug zu erfahren. Nächste Woche Freitag musste ich vor Gericht erscheinen, und auch wenn ich nicht glaubte, ins Gefängnis zu müssen - das würde David Kennedy schon zu verhindern wissen -, würde ich ganz ohne Strafe nicht davonkommen. Die Frage war nur, wie diese aussah.
Ein Mädchen drängelte sich durch die Menschen nach vorn und zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Keine Ahnung, wie sie das machte, sie war klein - höchstens einen Meter fünfundsechzig - fast knabenhaft schlank, hatte langweilig strohfarbenes Haar, und ihrer Kleidung sah man an, dass sie billig war. Dazu war sie nicht einmal geschminkt, trotzdem war da irgendetwas an ihr, das mich zweimal hinsehen ließ. Sie schlängelte sich immer weiter, bis sie direkt vor uns stand, das schaffte sie, ohne jemanden anzustoßen oder dass sich irgendeiner daran störte. Was war nur an diesem Mädchen?
Ich war so auf sie konzentriert, dass ich den Worten meines Vaters kaum noch folgte. Zumindest bis er etwas sagte, was mir den Atem verschlug. Hatte er gerade wirklich angekündigt, dass ich jedes Wochenende und in allen Semesterferien für den Abschaum der Gesellschaft kostenlos arbeiten sollte? Das konnte doch nicht sein Ernst sein! Ich war schon kurz davor, lautstark zu protestieren, aber ein Blick von meinem Vater ließ mich stumm bleiben. In seinen Augen las ich, wie sauer er auf mich war, und wenn ich nicht genau tat, was er von mir forderte, würde ich es bereuen. Vielleicht stimmte ich ihn milde, indem ich meinen Mund hielt. Um wenigstens eine kleine Chance, auf einen neuen Wagen zu bewahren. Mein geliebter Porsche war ja hinüber, und im Moment weigerte Dad sich standhaft, mir einen neuen zu kaufen. Allerdings brauchte ich ein Auto, um ständig hier herauszufahren. Wenn ich mich dann nur blöd genug anstellte, würden die wahrscheinlich freiwillig auf mich verzichten.
»... Wir hoffen, den Schaden damit wettmachen zu können. Mein Sohn ist jung, und er hat eine Riesendummheit begangen, aber wir Kennedys laufen nicht weg, sondern stehen zu unseren Fehlern und sorgen für Wiedergutmachung. Nicht wahr, Dean?« Sein Blick bedeutete mir, nun ja, nichts Falsches zu sagen. Warum erwartete er überhaupt von mir, zu sprechen? Er hatte doch schon alles verkündet. Dennoch ließ er mir keine Wahl. Also trat ich nach vorn ans Mikrofon.
»Ich möchte mich noch einmal bei jedem Einzelnen von Ihnen entschuldigen. Aber ich habe daraus gelernt und werde nie wieder unter Alkoholeinfluss Auto fahren. Hoffentlich kann ich den Schaden mit beheben, indem ich hier helfe.« Möglichst unauffällig versuchte ich, die Gesichtsausdrücke der Menschen zu deuten. Einige wirkten wirklich erfreut über meine Worte. Aber das Mädchen in der ersten Reihe schnaufte regelrecht, zumindest sie schien mir meine Reue nicht abzukaufen. Aber was interessierte mich ihre Meinung? Wahrscheinlich würde ich sie sowieso nie wiedersehen. Den Blick weiter gesenkt trat ich zurück und hob ihn auch nicht wieder, während mein Vater ein paar abschließende Sätze sprach. Kaum war das erledigt, schob er mich schon von der improvisierten Bühne und bedeutete mir, James - seinem Fahrer - zu folgen. Ohne ein Wort mit mir zu wechseln, stiegen wir ein, und James fuhr vorsichtig an. Die Menge hatte sich noch nicht wieder völlig verteilt, und er musste aufpassen, niemanden anzufahren. Dad seufzte.
»Ich könnte jetzt einen Drink gebrauchen, aber hierher konnten wir ja nicht mit der Limousine fahren.« Im Gegenteil, er hatte diesmal allen Ernstes den Wagen der Köchin genommen - einen Kombi. Als würde ein Kennedy so ein Gefährt im Alltag auch nur eines Blickes würdigen. »Du kannst dir nicht vorstellen, was mich das ganze Theater kosten wird, und alles nur, damit du nicht vorbestraft wirst. Weißt du überhaupt, wie viele Gefallen ich einfordern musste, um das hinzubekommen? Wehe, du nutzt die Chance nicht! Wenn doch, lasse ich dich knallhart in den Knast wandern und enterbe dich.« Diese Drohung musste ja kommen, und ich musste wirklich an mich halten, um nicht genervt die Augen zu verdrehen. Wenn ihm nichts mehr einfiel, kam er mit dem Erbe. Aber gut. Dieses Mal hatte ich wahrhaftig Mist gebaut.
»Ich werde mein Bestes geben, Dad«, rang ich mir ab. Das war zwar nicht das, was ich sagen wollte, aber im Moment wagte ich es nicht, ihm zu widersprechen. Wie lange würde ich wohl den braven Sohn spielen müssen, bis er mir vergab? Sollte ich etwa tatsächlich hier für diesen Abschaum unserer Gesellschaft schuften? Immerhin war ich ein Kennedy! Hätte ich eigene Kinder, würden sich Angestellte um diese kümmern, und nun sollte ICH auf fremde Bälger aufpassen? Warum ließ man die nicht einfach auf der Straße, wo sie hingehörten? Eine Chance gab es für die doch sowieso nicht.
»Das wirst du, wenn du nämlich auch nur einen Tag fehlst, oder ich erfahre, dass du dich vor der Arbeit drückst, dann sind sämtliche Vergünstigungen gestrichen.« Er blickte mich finster an. »Mal sehen, wie du, ohne dass ich deine Studiengebühr übernehme, deine Wohnung, das Zimmer im Verbindungshaus - wer außer dir braucht überhaupt beides? -, Lebensunterhalt und Auto finanzieren willst, damit du dein Studium fortsetzen kannst.« Nun musste ich wahrhaftig schlucken. Meinte er das tatsächlich so, wie er es sagte? »Und in meiner Firma gibt es dann ebenfalls keinen Platz für dich. Vielleicht merkst du dann, wie das wirkliche Leben ist, und siehst nicht mehr auf die Menschen herab, die es nicht so gut haben wie du. Denk ja nicht, ich hätte deine abfälligen Blicke nicht gesehen ...« Die Ansprache ging den kompletten Rest der Fahrt so weiter. Immer wieder musste er mir vorhalten, was ich in den letzten Jahren alles falsch gemacht hatte. Einundzwanzig Jahre lang war ich ihm mehr oder weniger egal, aber jetzt wollte er mich plötzlich erziehen? Irgendwas war hier doch im Busch. Allerdings, was das sein konnte, ahnte ich nicht. Nach einiger Zeit reichte es mir endgültig, und ich blendete seinen Vortrag, so gut es ging, aus, ohne dass er es bemerkte. Dennoch sagte er dann etwas, das mich wieder aufhorchen ließ.
»… deine Mutter kann absolut keine weitere Aufregung vertragen, sonst trinkt sie zu viel. Sie darf nicht wegen dir in der Entzugsklinik landen.« Einen Moment lang glaubte ich wirklich, er würde sich um sie sorgen, aber diesen Eindruck relativierte er schnell. Außerdem war ich sicher nicht der einzige Grund, aus dem sie trank. Mein Vater mochte seine letzte Affäre, die schwanger bei uns im Haus aufgetaucht war, verdrängt haben. Mom hatte sie jedoch garantiert nicht vergessen. Er hatte ihr viel Geld bezahlt, damit sie abtrieb und den Mund hielt. Aber wer wusste schon, wie viele er zuvor bereits geschwängert hatte, obwohl er es doch eigentlich besser wissen sollte. »Die Familie kann keine weiteren schlechten Schlagzeilen gebrauchen. Wir sind Kennedys, verdammt noch mal.« Das war wieder so typisch, man durfte jeden Mist bauen, solange die Presse keinen Wind davon bekam. Zum Glück kamen wir jetzt am Anwesen meiner Eltern an.
»Das Wochenende wirst du hier verbringen und dich um deine Mutter kümmern, und am Montag fährt James dich zur Universität. Du wohnst im Verbindungshaus, verpasst keine Vorlesung, und Freitagmittag wird der Fahrer dir einen Kleinwagen übergeben, mit dem du zur ›Hope for Kids‹-Baustelle kommst. Dort arbeitest du bis zum Feierabend mit und Samstag und Sonntag stehst du wieder pünktlich zum Arbeitsbeginn auf der Matte und bleibst bis zum Ende. In nächster Zeit gibt es keine Partys für dich.« Ohne eine Antwort abzuwarten oder sich zu verabschieden, stieg er aus. Stattdessen kletterte er in seinen Sportwagen und brauste davon, wahrscheinlich zu einer seiner Geliebten, und ich durfte mich jetzt das ganze Wochenende meiner Mutter annehmen. Was für Aussichten, aber vielleicht konnte ich von ihr wenigstens ein paar Dollar bekommen, solange mein Vater mir nichts gab.
Doch dafür musste ich sie erst einmal finden. Sie war nicht in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich sonst meist um diese Uhrzeit aufhielt. Ebenso waren der Salon, ihr Ankleidezimmer und das Familienwohnzimmer leer. Langsam machte ich mir Sorgen. Wo konnte sie nur sein? Natürlich war das Anwesen riesig, aber normalerweise hielt sie sich immer in diesen Räumen auf. Während ich von Zimmer zu Zimmer lief, rief ich immer wieder nach ihr. Komischerweise traf ich auch niemanden vom Personal. Was war hier nur los? Wenn es jemand wusste, dann Fran. Sie war seit über zwanzig Jahren nicht nur die Köchin hier im Haus, sondern leitete den gesamten Haushalt. Als ich ihr Refugium betrat, fand ich auch meine Mutter, sie saß neben Fran am großen Küchentisch. Was war hier nur los? In diesem Raum hatte ich meine Mutter noch nie gesehen. Es war, als wäre durch den Unfall plötzlich die ganze Welt aus den Fugen geraten.
Destiny Arizona
Im ›Hope‹
Meine Schwester stand zappelnd neben mir.
»Ari, bringst du uns heute wieder ins ›Hope?‹« Leise seufzend schob ich mein Matheheft zur Seite und sah Virginia an. Jeden Tag stellte sie diese Frage, und jeden Tag erklärte ich ihr, warum es nicht ging.
»Ernsthaft?« Ich hob eine Augenbraue, um ihr zu zeigen, was ich von der Sache hielt.
»Ja, die müssen doch langsam mal aufmachen. Das Haus ist ja schon da. Die wollen uns wohl nur nicht reinlassen.« Zum zweiten Mal seufzte ich. Für eine Achtjährige fühlten sich zwölf Wochen wie eine Ewigkeit an, das musste ich mir erst einmal begreiflich machen. Für mich war diese Zeit kurz, um ein komplettes Gebäude zu errichten. Nach acht Wochen Bauzeit sah das Objekt von außen wirklich bereits fertig aus. Allerdings dauerte der Innenausbau noch, da Kennedy zwar viel versprach, aber nicht genug Arbeiter stellte, um seine Versprechen einzuhalten, deshalb halfen längst einige Freiwillige, um den Termin halten zu können. Nur wenn die Presse kam, waren nicht nur Kennedy und sein Sohn da, sondern auch unzählige Bauarbeiter.
»Die Eröffnung ist erst in vier Wochen geplant, Virginia. Und vorher wird das garantiert nichts, im Moment werden gerade erst die Wände für die Toilettenräume und die Küche gebaut.« Virginia schmollte, und auch Savannah sah mich böse an. Als könnte ich etwas für die vorübergehende Schließung des Zentrums. Dabei war nur dieser Kennedy Junior schuld. Wahrscheinlich bildete er sich ein, er könnte sich mit diesem Namen alles erlauben. Aber eigentlich war das auch so. Eine Geldstrafe hatte der reiche Pinkel für den Unfall unter Alkohol bekommen. Als interessierte ihn das, sein Vater hatte ja genug Kohle. Sein Hilfseinsatz tat ihm vermutlich mehr weh, indessen glaubte ich sowieso noch nicht daran, dass er die Zeit ableisten würde.
Heute war Samstag, vielleicht sollte ich mich selbst für ein paar Stunden als freiwillige Helferin melden, nur um zu sehen, ob der Schnösel auch kam. Mom schlief gerade, aber unter Umständen konnte ich Georgia überreden, auf die Kleinen aufzupassen. Ideal war das zwar nicht, sie war dreizehn und mitten in der Pubertät, aber ich würde es ihr schon schmackhaft machen. Unsere Mutter ruhte sicher auch nicht mehr lange.
»Georgi?« Sofort bekam ich ein Kissen von ihr an den Kopf geworfen. Sie konnte es nicht leiden, wenn ich ihren Namen verniedlichte.
»Vergiss es. Egal, was du möchtest. Ich muss Mathe pauken, wir schreiben am Montag eine Arbeit.« Trotz ihrer altersbedingten Zickerei war sie genauso ehrgeizig wie ich. Auch die Kleinen waren gute Schüler, uns allen war klar, wie wichtig eine Ausbildung war, um dem Trailerpark endgültig den Rücken zukehren zu können. Der Einzige, der es nie verstanden hatte, war Utah, und dafür hatte er die Quittung bekommen.
»Wenn du jetzt auf die Knirpse aufpasst, bis Mom aufwacht, dann frage ich dich heute und morgen Abend ab. Deal? Ich will ins ›Hope‹ und meine Hilfe anbieten.« Georgia nickte ergeben.
Sie lernte im Gegensatz zu mir nicht gern allein und ließ sich lieber abfragen.
Nachdem das geklärt war, machte ich mich auf den Weg ins ›Hope‹. Faktisch hätte ich ja auch lernen müssen, denn ich hatte heute früh schon im Gemüsegeschäft gearbeitet, doch das würde ich morgen nachholen. Länger als bis sechs Uhr konnte ich sowieso nie schlafen, denn irgendwer von den Kleinen weckte mich um die Zeit meistens. Und wenn nicht, wurde ich wach, weil ich mich sorgte, ob alles in Ordnung war. Total bekloppt eigentlich. Manchmal fühlte ich mich, als wäre ich die Mutter. Mom sagte immer, sie könne das nie wiedergutmachen. Aber ich wollte auch gar nicht, dass sie es tat. Sie sollte nur die Hoffnung nicht aufgeben, wieder gesund zu werden. An alles andere wollte ich gar nicht denken. Niemand würde mir die Kleinen überlassen, falls sie es nicht schaffte. Ich war zu jung, hatte keine Ausbildung und nur Aushilfsjobs ...
Zum Glück war ich jetzt am neuen Gebäude des Zentrums angekommen und konnte mich von den negativen Gedanken ablenken, die mich oft überkamen. Am zukünftigen Hintereingang befand sich eine Koordinationsstelle, an die ich mich nun wendete. Dort stand gerade Kim, eine Erzieherin, die sonst die Kinder betreute, und empfing mich lächelnd. Wir kannten uns schon seit Längerem.
»Willst du helfen, Ari? Das ist ja lieb von dir. Geht das denn mit den Kindern?« Natürlich wusste sie von unserer Situation, ab und zu war sie sogar zu uns in den Trailer gekommen, um nach uns zu sehen, als meine Mutter ständig liegen musste.
»Georgi passt auf, und Mom geht es langsam wieder besser. Sobald sie aufwacht, übernimmt sie die Wichte. Essen müssen sie nur aufwärmen, ich habe vorgekocht.«
»Du bist wirklich großartig, Ari. Wenn alle Familien wie eure wären, würde unsere Arbeit noch mehr Spaß machen.« De facto wusste ich genau, was sie meinte. Nicht alle Kinder, die hierher kamen, hatten es so gut wie wir. Oft bekamen sie zu Hause gar nichts zu essen, während die Eltern das Geld lieber versoffen, als es für Lebensmittel auszugeben. Auch Misshandlungen gehörten leider zum Alltag einiger. Viele von ihnen benahmen sich dadurch absolut unmöglich, was auch kein Wunder war, weil ihnen niemand Regeln beibrachte. Solche Kids wurden schnell abgeschoben, da sie den Menschen zu anstrengend waren oder Sachen zerstörten. Dabei konnten sie im Grunde gar nichts dafür, sie lernten es ja nicht. Im Zentrum gaben sie ihr Bestes, um solche Kinder auf den richtigen Weg zurückzubringen. Manchmal gelang es ihnen sogar, aber manchen Kindern mussten sie dann wirklich Hausverbot erteilen. Von Kim wusste ich, wie schwer ihr das fiel. Aber wenn Drogen, Alkohol, Gewalt oder gar Waffen ins Spiel kamen, gab es keine andere Möglichkeit für sie.
Bei meinem Bruder Utah hatte alle Erziehung nichts genutzt. Er lernte falsche Freunde kennen und war einer dieser Fälle, die auf die schiefe Bahn geraten war. Einige der älteren Kids, die im Zentrum bereits vor ihm Hausverbot erhalten hatten, waren in einer Gang gelandet, und da sein bester Kumpel dabei gewesen war, schloss auch Utah sich ihnen an. Vielleicht konnte man es auf Moms Erkrankung schieben, doch eigentlich war diese keine Entschuldigung für seine Taten. Das sah auch der Richter so und verurteilte ihn zu vier Jahren wegen bewaffneten Raubüberfalls. Nach der Hälfte der Zeit würde er die Chance auf Bewährung erhalten, aber ob er diese nutzen würde? Den Kontakt zu uns hatte er völlig abgebrochen, er weigerte sich sogar, Mom oder mich auf die Besucherliste setzen zu lassen, und wir hatten keine Ahnung, ob er unsere Briefe las. Antwort bekamen wir jedenfalls nicht.
Oh Mann, heute war ich wahrhaftig nur am Grübeln. Ich hoffte auf eine Arbeit, die mich davon ablenken konnte. Sonst würde ich heute Nacht auch wieder kein Auge zubekommen, weil sich das Gedankenkarussell ununterbrochen drehte. Wenn ich mich körperlich richtig auspowerte, brachte ich die Gedanken leichter zum Schweigen. Hoffentlich hatte Kim etwas Entsprechendes für mich zu tun und nicht nur Bürokram.
»Du hast doch schon einmal eine Trockenbauwand aufgestellt?«, fragte Kim und sah mich erwartungsvoll an. Das hatte ich wirklich bereits getan, allerdings nur bei uns im Wohnwagen, da hatten zwei Rigipsplatten und eine Falttür ausgereicht, um meiner Mutter ein eigenes Reich zu zaubern. Hundertprozentig gerade sah sie gewiss nicht aus, aber für unsere Bedürfnisse reichte es aus. Hier im Zentrum waren die Wände sicher größer und die Ansprüche höher. Kim lachte und führte mich weiter.
»Na dein Gesichtsausdruck sagt alles, aber Mr. Miller kann es, da wird er Dean und dich ohne Frage einweisen.« Zwar kannte ich weder diesen Dean noch Mr. Miller, dennoch traute ich es mir unter fachkundiger Anweisung zu.
»Irgendwie wird das schon funktionieren.« Was sollte ich auch sonst sagen? Für den Innenausbau waren nun einmal fast nur Laien da. Mr. Kennedy dachte wohl, ein hallenartiges Gebäude würde völlig ausreichen. Dabei kam es schlichtweg auf die Raumaufteilung an. Die Kinder brauchten Platz zum Toben, aber auch Räume, in denen sie in Ruhe Hausaufgaben machen oder sich einfach mal zurückziehen konnten. Hier in der Gegend hatte kaum ein Kind ein eigenes Zimmer, gerade deshalb war ein Ort, an dem man mal allein sein durfte, so wichtig.
»Mr. Miller, ich habe hier noch eine Helferin für Sie. Mit Trockenbau hat sie zwar ebenfalls kaum Erfahrung, dafür ist sie unglaublich geschickt mit den Händen und kann fast alles.« Nicht nur der Angesprochene blickte mich erwartungsvoll an, sondern auch dieser Kennedytrottel. Half er also wirklich? Wow, das hätte ich nicht gedacht.
»Guten Tag, Mr. Miller, Mr. Kennedy, ich bin Ari«, stellte ich mich selbst vor.
»Freut mich«, gab Mr. Miller zurück, während Mr. Eingebildet mich nur abfällig musterte.
»Was kann ich tun?« Während Mr. Miller uns erst einmal erklärte, wo wir das Material fanden, welches er als Nächstes brauchte, starrte Kennedy mich weiter an, und dann rümpfte er sogar seine Nase. Was für ein arroganter Arsch, aber dem würde ich schon zeigen, was ein Mädchen aus dem Trailerpark alles konnte, garantiert mehr als er.
Dean
Ein Scheißtag
Ari? Was sollte das überhaupt für ein Name sein? Wahrscheinlich war es eine Abkürzung oder so, bloß kam ich nicht darauf, wofür. Fragen wollte ich keinesfalls, die Kleine glaubte sonst womöglich, ich könnte Interesse an ihr haben. So gern ich flirtete und so oft ich meine Begleitung wechselte, so dachte ich doch nicht daran, meine Ansprüche so weit herunterzuschrauben, damit dieses Mädchen aus der Gosse sie erfüllte. Allein schon, wie sie herumlief. Wo war ihr Sinn für Mode? Eine verwaschene Jeans, ein dunkelgraues, viel zu großes T-Shirt und billige Turnschuhe, außerdem war sie absolut ungeschminkt. Welche Frau lief heutzutage noch so herum? Wenn sie mehr aus sich machen würde, hätte sie möglicherweise Chancen, hier herauszukommen, aber so? Nicht einmal einen zweiten Blick war sie wert.
»Hey, Kennedy!« Dieses Biest stand plötzlich direkt vor mir und wedelte mit ihrer Hand vor meinem Gesicht hin und her. Dabei sah sie mich an, als wäre ich geistesgestört, dabei war sie es doch eher, die nicht ganz normal war.
»Was soll das?« Ich war echt angepisst und ließ sie es merken.
»Du hast jetzt fast drei Minuten wie erstarrt hier gestanden und mich nur anglotzt, statt anzupacken. Nun komm schon, reicher Schnösel, ich bin zum Arbeiten hier und nicht zum Rumstehen.« Was bildete dieses Gör sich eigentlich ein? So hatte bisher nie ein Mensch mit mir gesprochen, und ich hatte es wahrhaftig nicht nötig, mir das bieten zu lassen. Allerdings hob sie einen Stapel dieser ekelhaft staubigen Platten an, noch ehe ich ihr das sagen konnte, und wies mich an, die andere Seite zu nehmen. Wenn sie sich einbildete, sie könne mich herumkommandieren, ohne dass ich etwas dagegen sagte, hatte sie sich jedoch geschnitten.
»Du bist hier nicht der Boss, Kleines.« Irgendwie klang meine Stimme bockiger, als ich wollte.
»Wenn du einfach deinen Job hier erledigen würdest, müsste ich dir keine Anweisungen geben. Du kannst dich ja beim Vorarbeiter beschweren, aber auf dem Weg dorthin können wir die Rigipsplatten gleich mitnehmen.« Nur zu gern wollte ich ihr widersprechen - schon aus Prinzip -, blöderweise fiel mir kein plausibler Grund ein. Daher beschloss ich, mit anzufassen, sie dafür allerdings mit Schweigen zu strafen. Weiber konnten es doch nicht leiden, ignoriert zu werden. Nur schien ich es hier mit einer besonderen Sorte Mädchen zu tun zu haben, sie schwieg nämlich ebenfalls, während wir die Gipskartonplatten zu ihrem Bestimmungsort schleppten. Kaum waren wir angekommen, legte sie ihre Seite ab und ging wieder los. Wollte sie etwa sofort weiterschuften?
»Worauf wartest du, Junge? Hopp, hopp, hol die nächsten Platten.« Nun wies mich zudem dieser Mr. Miller zurecht. Hatte hier denn niemand auch nur einen Funken Respekt vor mir? Normalerweise fragte mich jeder nach meiner Meinung, und die Menschen machten das, was ich ihnen sagte. Was mir sehr zusagte. Plötzlich Befehlsempfänger zu sein, gefiel mir dagegen so gar nicht. Wozu gab es eigentlich Personal?
»Willst du jetzt hier Wurzeln schlagen? Ich wusste ja gleich, dass so ein verwöhntes Bürschlein nicht für wirkliche Knochenarbeit geeignet ist. Dein Vater hätte besser noch ein paar Arbeiter bezahlen sollen, als deine Hilfe anzubieten.« Obwohl er damit tatsächlich meine eigenen Gedanken aussprach, ärgerten mich seine Worte und vor allem die abfällige Art, mit der er über mich sprach. Die Leute hier waren völlig respektlos.
»Ich gehe ja schon.« Damit er die Klappe hielt, ging ich lieber dieser Ari hinterher. Doch nach nur wenigen Schritten kam sie mir mit einem anderen jungen Mädchen bereits wieder mit Platten entgegen. Sie ignorierten mich und die beiden legten ihre Ladung auf die andere ab.
»Ich muss jetzt aber drüben weitermachen. Tut mir leid.« Die Unbekannte band sich die blonden Haare neu zusammen und lächelte mich dabei sexy an, währenddessen zog sie mich mit den Augen regelrecht aus. Das steigerte mein Selbstbewusstsein, das durch Aris Verhalten einen kleinen Dämpfer erhalten hatte, zum Glück etwas. Warum arbeitete ich nicht mit ihr gemeinsam statt mit dieser Zicke?
»Danke, Sarah. Vielleicht packt der Schnösel ja beim nächsten Stapel mit an.« Mein Blut fing an zu kochen. So sprach man nicht über Dean Kennedy, aber noch ehe ich etwas sagen konnte, brachte ein Blick von Mr. Miller mich dazu, mich lieber hinter dieser Ari her zu bewegen. Sie war nämlich erneut auf dem Weg, um den nächsten Stoß zu holen. Während Mr. Miller eine der Platten nahm und sie mithilfe einer anderen Frau anbrachte.
Fest entschlossen, dieser Ari begreiflich zu machen, wie man mit mir umzugehen hatte, folgte ich ihr. Zweimal sah ich mich um, ob niemand in der Nähe war. Als ich mir dessen ganz sicher war, schnappte ich mir die Kleine und drängte sie an die Wand. Sie war so klein und zierlich, da war das gar kein Problem. Sie mochte zwar eine große Klappe haben, dabei hatte sie mir körperlich kaum etwas entgegenzusetzen. Sie probierte tatsächlich, mich zu treten, was ich nicht zuließ. Stattdessen hielt ich ihre Beine problemlos mit meinen in Schach und ihre Hände hatte ich mit einer meiner gepackt und platzierte sie über ihren Kopf. Mit der anderen Hand griff ich nach ihrem Kinn und zwang sie so, mir in die Augen zu sehen.
»Du hörst sofort auf, mich zu provozieren. Ansonsten wirst du mich kennenlernen. Ich bin zugegebenermaßen gezwungen, hier zu arbeiten, aber deshalb lasse ich mich trotzdem nicht so von dir behandeln. In Zukunft benimmst du dich, haben wir uns verstanden?« Mein Gesicht näherte sich ihrem, bis sich unsere Nasen fast berührten. Sie versuchte, ihres wegzudrehen, doch ich ließ ihr keine Chance dazu. Ein Kennedy ließ sich so ein Benehmen nicht gefallen. Sie spannte sich immer mehr an, kam aber trotz allem nicht gegen mich an. Warum gab sie nicht endlich nach? Einen kurzen Moment schloss ich die Augen und atmete ihren Duft ein. Irgendwie roch sie richtig gut, nicht nach teurem Parfum, wie ich es von meinen Begleiterinnen gewohnt war, aber trotzdem angenehm nach Vanille. Schnell musste ich an etwas anderes denken, um nicht laut zu stöhnen. Viel zu viel Blut schoss in meine unteren Regionen, und ich rückte einige Millimeter von ihr ab, damit sie meine Erektion nicht bemerkte.
»Ich habe dich etwas gefragt, ARI.« Dabei interessierte mich so was sonst absolut nicht. Aber von ihr wollte ich mehr wissen.
»Ja.« Ich lockerte den Griff etwas, als sie das sagte. Bloß das sollte ich schnell bereuen. Kaum hatte ihr Kopf auch nur einen Hauch Spielraum, schlug sie ihre Stirn mit voller Wucht gegen meine Nase, sodass es richtig darin krachte. Ich sah Sterne und ließ sie vollends los.
»Ja, ich habe verstanden, dass du ein Oberarschloch bist. Nur weil du größer und stärker bist als ich, bildest du dir ein, mich einschüchtern zu können. Aber du hast vergessen, wo ich herkomme.« Sie spuckte mir ins Gesicht, sodass mir augenblicklich schlecht wurde und sich das Problem in meiner Hose von allein erledigte. Wieso tat sie das? So etwas Ekelhaftes hatte ich ihr nun nicht zugetraut. »Wage es ja nie wieder, mich anzurühren, oder du kommst nicht mehr so glimpflich davon. Der Kennedyspross, der ein Mädchen aus dem Trailerpark bedrängt. Was meinst du, wie sich die Presse darauf stürzen würde?« So blöd, wie ich gedacht hatte, war sie gar nicht. Sie hatte sofort meinen Schwachpunkt gefunden, natürlich konnte ich nicht riskieren, dass so eine Story in den Medien landete. Trotzdem musste ich mir deshalb nicht alles von ihr gefallen lassen. Wahrscheinlich genoss sie es, mich vor sich am Boden sitzen zu sehen. Sie überraschte mich jedoch und nutzte die Situation nicht aus, sondern streckte mir sogar die Hand hin, um mir aufzuhelfen.
»Vielleicht solltest du dir überlegen, ob du entweder von hier abzischst und deinen Unfall anders wieder in Ordnung bringst oder ob du deine Einstellung überdenken willst. So machst du dir hier jedenfalls keine Freunde.« Als hätte ich das vor. Ausgerechnet hier, bei diesen Versagern. Auf solche Kumpel verzichtete ich nur zu gern. Dennoch sagte ich ihr das lieber nicht so direkt. Nachher drehte sie mir daraus auch noch einen Strick.
»Ich arbeite meine Strafe hier ab und dann seht ihr mich nie wieder. Freunde habe ich genug, ich suche keine Neuen.«
»Und keiner deiner tollen Kameraden kommt auf die Idee, dir hier zu helfen? Je eher das Zentrum fertig ist, umso schneller kannst du verschwinden. Stattdessen legst du dich hier mit freiwilligen Hilfskräften wie mir an? Sehr logisch, Mister Superreich. Aber nun ran ans Werk, oder benötigst du einen Arzt für deine Nase?« Wahrscheinlich konnte ich den wirklich brauchen, indessen würde ich einen Teufel tun und das einräumen. Dafür ignorierte ich ihre dargebotene Hand weiterhin und rappelte mich allein hoch. Dieses törichte Mädchen schaffte es nicht, mich kleinzubekommen.
»Lass uns weitermachen, Ari. Was ist das eigentlich für ein dämlicher Name? Klingt so nach Schäferhund oder Papagei.« Statt mir zu antworten, lachte sie nur.
»Mein Name kann dir egal sein, Kennedy. Spätestens fünf Minuten, nachdem du heute weg bist, hast du ihn sowieso wieder vergessen.« Ihre Meinung über mich traf mich etwas, auch wenn ich das nicht unter Folter zugeben würde. Ganz so schlimm war ich nun wirklich nicht.
»Aber ich bin nächstes Wochenende wieder hier und vielleicht fällt er mir dann wieder ein.« Doch sie sagte ihn mir trotzdem nicht.
»Ob ich dann ebenfalls hier bin, weiß ich noch nicht. Eventuell finde ich einen bezahlten Job oder muss babysitten. Dann kann ich nicht.« Sie drehte sich um und ging zum Stapel Rigipsplatten. Für sie war das Thema damit wohl erledigt, nur gab ein Kennedy nicht so schnell auf. Solange ich hier sein musste, wollte ich mehr über sie erfahren. Allerdings wies sie den Rest des Tages alle persönlichen Fragen zurück, und als wir die Wand am Abend endlich fertig hatten, verschwand sie innerhalb weniger Sekunden. Was war sie nur für ein seltsames Mädchen? Eigentlich nahm ich mir vor, nicht weiter über sie nachzudenken, aber das war gar nicht so einfach.
Destiny Arizona
Immer dieser Kennedy
Die ganze Woche über ging mir Dean Kennedy kaum aus dem Kopf. Dabei war es egal, ob ich in der Schule, auf der Arbeit oder zu Hause war, ständig geisterte dieser verdammte reiche Schnösel durch meine Gedanken, und das nicht unbedingt positiv. Immer wieder schalt ich mich deshalb selbst, aber es half nicht wirklich. Gerade jene Situation, in der er mich an die Wand gedrückt hatte, lief in meinem Hirn in Endlosschleife ab. Wie konnte er es nur wagen? Eigentlich müsste ich ihn einfach mit Ignoranz strafen, das würde ihn am meisten treffen, doch aus irgendeinem Grund wollte es mir nicht gelingen. Innerlich fieberte ich trotz seiner beschissenen Aktion unserer nächsten Begegnung entgegen.
Während ich am Freitag an den Hausaufgaben saß, dachte ich einmal mehr nur an ihn und kam dadurch mit den Aufgaben kaum voran. Dabei war es auch ungewöhnlich ruhig hier. Da es Mom heute ausgesprochen gut ging, machte sie mit den Kleinen ein Picknick im Park. Nur Georgia und ich hielten uns im Augenblick hier auf und lernten. Oder halt nicht, weil Mr. Kennedy mich ablenkte, obwohl er nicht mal in meiner Nähe war.
»Meinst du, es geht jetzt aufwärts, oder ist es wieder nur ein Aufbäumen vor dem nächsten Rückfall?« Georgis besorgte Stimme schaffte das, was ich die ganze Zeit schon versuchte. Dean war zumindest für den Moment vergessen.
»Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste sie bald erneut zur Kontrolle, aber wie wollen wir sie dazu bringen? Du weißt, wie sie ist.« Mom weigerte sich, mein Geld für sich zu benutzen. Dabei ging ich doch genau deswegen arbeiten. Sobald die Arbeiten im Zentrum abgeschlossen waren und es wieder eröffnet werden konnte, sollte dort einmal wöchentlich eine kostenlose Sprechstunde stattfinden, die sie in Anspruch nehmen möchte, aber ob das reicht? Sie gehörte zu einem Spezialisten. Was sollte ich bloß tun, wenn sie aufgrund falscher Behandlung sterben würde? Sie war meine Mom, ich brauchte sie. Wir alle brauchten sie.
»Ich habe Angst.« Ich auch, wollte ich rufen, blieb allerdings lieber stumm. Ich durfte ihre Befürchtungen nicht noch schüren, indem ich meine ebenfalls eingestand. Schnell stand ich auf und ging zu Georgi, um sie in den Arm zu nehmen.
»Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Mom muss einfach wieder gesund werden.« Meine Stimme klang absolut überzeugend, obwohl ich es gar nicht war, doch sie schien wirklich ein klein wenig Zuversicht zu fassen, und darauf kam es ja an.
»Danke, dass du dich immer um uns kümmerst. Du bist die beste große Schwester, die es gibt, Ari.« Mit diesen Worten wusste ich nun gar nicht umzugehen, deshalb ließ ich sie los und verkündete, noch ins Center zu wollen, um ein bisschen zu helfen. Zu meinem Erstaunen schloss sie sich mir an. Normalerweise drückte sie sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit darum, aber heute war wohl kein normaler Tag. Sonst ging sie am liebsten raus, um unserer engen Welt zu entfliehen. Sie liebte es, stundenlang ohne einen Cent in der Tasche durch das Einkaufszentrum zu schlendern und sich schöne Sachen anzusehen. Manchmal überkam mich Angst, weil sie sich so oft dort aufhielt. Einige Mädchen in ihrem Alter fingen mit Ladendiebstahl an, aber bisher gab es glücklicherweise keinerlei Anzeichen dafür, dass sie etwas einsteckte.
Hoffentlich würde es so bleiben. Hier geriet eine Vielzahl der Kinder auf die schiefe Bahn. Wir hatten bereits Utah verloren, ich wollte nicht noch ein Mitglied meiner Familie im Knast wissen. Wenn man aus dem Trailerpark kam, landete man wegen schlechter Sozialprognose sehr schnell direkt hinter Gittern. Hätte jemand aus unserem Viertel den Unfall verursacht, wäre er sehr viel härter bestraft worden als Dean Kennedy. Mich regte diese Ungerechtigkeit auf, doch was sollte ich dagegen tun? Ich fühlte mich, wie so oft, absolut machtlos. Lange schwankte mein Studienziel zwischen Medizin und Jura. Als Anwältin könnte ich die Menschen hier kostenlos unterstützen, allerdings wurden Ärzte einfach noch um einiges dringender gebraucht. Und so stand mein Entschluss inzwischen bombenfest.
Georgia und ich gingen die Strecke zum ›Hope‹ schweigend. Im Moment wusste ich nicht, was ich noch sagen sollte, ohne ihre Stimmung wieder vollständig zu zerstören. Wie so oft begrüßte Kim uns auch dieses Mal, als wir am Zentrum ankamen.
»Ari, Georgi, schön, dass ihr da seid. Habt ihr Lust, den Pinsel zu schwingen? Wir können jede helfende Hand gebrauchen.«
»Klar, wo sollen wir hin?«, fragte ich sofort.
»Du hast unseren Zwangshelfer ja letztes Mal ganz gut zum Arbeiten bekommen. Deshalb schließt ihr euch am besten Kennedy an, um die Zwischenwände der Toiletten zu streichen.« Beinahe konnte ich ein Stöhnen nicht unterdrücken, doch dann schaffte ich es gerade so. Was hatte ich denn verbrochen? Allerdings half Jammern nicht, und wenn die sanitären Anlagen bald fertig waren, durfte es bis zur Eröffnung eigentlich nicht mehr lange dauern, und zudem wurden wir ihn endlich wieder los.
»Kennedy? Hat der was mit dem ehemaligen Präsidenten zu tun? Ein Enkel oder so?« Georgia klang beeindruckt, was mir gar nicht gefiel. Aus irgendeinem Grund störte es mich, dass sie so über ihn sprach.
»Nein, mit denen ist er nicht verwandt. Allerdings gehört seinem Vater eine riesige Firma und er ist mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Das merkt man ihm auch an, aber das hindert die Mädels nicht daran, ihn anzuhimmeln. Einigen scheint seine eingebildete Art sogar zu gefallen.« Kim verdrehte die Augen und mein Blick wanderte besorgt zu Georgia. Warum sollte sie ausgerechnet mit ihm zusammenarbeiten? Sie schien Feuer und Flamme zu sein, bei der Aussicht ihn kennenzulernen, und je besser ihre Laune wurde, umso schlechter wurde die meinige. Sie lief so beschwingt vor mir her, dass ich Mühe hatte, ihr zu folgen. Freilich war sie mit ihren dreizehn auch schon gute fünfzehn Zentimeter größer als ich. Ihr Erzeuger war über zwei Meter groß, während meiner nur einen Meter siebzig maß. Anscheinend hatte das für ihren Wachstumsschub gesorgt, derweil ich nie wirklich einen hatte. Überhaupt war sie viel weiter entwickelt als ich. Ich träumte nur von einem schönen Busen, wohingegen sie bereits eine üppige Oberweite hatte. Wenn sie sich noch dazu schminkte, was ich nicht mochte, dann konnte man sie für die ältere Schwester halten. Mehrfach hatte ich in letzter Zeit jungen und auch älteren Männern erklären müssen, wie jung sie war. Georgia vergaß das nämlich gern und flirtete für meinen Geschmack viel zu viel und mit völlig unpassenden Kerlen. Was wollte sie mit Typen, die zehn oder mehr Jahre älter als sie waren? Manchmal fragte ich mich, ob es an der fehlenden Vaterfigur in unserem Leben lag. Hoffentlich würde sie nun nicht mit Kennedy flirten.
Diesen fanden wir im zukünftigen Toilettenraum, doch statt zu streichen, saß er in einer Ecke und spielte mit seinem Handy herum. Er sah nicht einmal auf, als wir den Raum betraten. Zuerst wollte ich meine Klappe halten, ich wusste ja nicht, wie lange er heute bereits gearbeitet hatte, und jeder Mensch hatte eine Pause verdient - selbst er. Georgi sah ihm interessiert zu, was er aber zum Glück nicht zu bemerken schien. Daher drückte ich ihr schnell eine Rolle Klebeband in die Hand.
»Hier, laut Plan sollen die Seitenwände bis zur Mitte dunkelrot gestrichen werden und der obere Teil weiß. Wir müssen das erst ausmessen und dann abkleben, damit alle Wände gleich aussehen.« Sie warf mir zwar böse Blicke zu, fing aber brav an zu messen und abzukleben, während ich den Fußboden mit Malervlies auslegte. Nachdem wir fertig waren, rührte ich die Farbe an.
»Hey, Kennedy.« Georgia stellte sich vor ihm und stemmte die Hände in ihre Hüften. »Ich dachte, du bist zum Arbeiten hier.«
»So, dachtest du das? Allerdings sage ich dir eines, ich habe langsam keinen Bock mehr darauf, mich hier abzurackern. Deshalb meine Onlinerecherche nach einer Firma, die das Streichen übernimmt.« Er erhob sich mit einer geschmeidigen Bewegung und lächelte sie betörend an. »Und ich bin fündig geworden. Ab morgen machen Fachkräfte den Rest der Arbeit. Dann wird es wenigstens schnell und vernünftig erledigt.« Nun ging sein Blick zu Georgia. »Wir beide haben doch Besseres zu tun, als hier zu schuften, oder? Mir würde da jedenfalls so einiges einfallen, was ich mit dir tun möchte.« Georgi lag ihm natürlich - bildlich gesprochen - zu Füßen. Aber das konnte er vergessen.
»Stopp!«, mischte ich mich lautstark ein. »Kennedy, du lässt deine dreckigen Pfoten von meiner kleinen Schwester, oder du bekommst eine Anzeige an den Hals.« Seine Augen wurden groß, und fast meinte ich, die Fragezeichen in ihnen zu sehen.
»Kleine Schwester?«
»Sie ist dreizehn!« Das letzte Wort betonte ich extra, damit selbst dieser Idiot begriff, dass sie tabu war.
»Sorry, das wusste ich nicht. Sie sieht viel älter aus, und wie alt bist du, Ari-Zicke? Vierzehn?« Hatte er mich gerade wirklich Zicke genannt? Dieses Arschloch hatte sie doch nicht mehr alle. Der sollte mich kennenlernen. Die Kopfnuss beim letzten Mal hatte wohl nicht ausgereicht.
»Es kann dir eigentlich egal sein, weil ich dich nicht einmal mit der Kneifzange anfassen würde, aber ich bin achtzehn. Und im Gegensatz zu dir weiß ich, was Arbeit bedeutet. Aber wenn du lieber Leute bezahlst, als mit eigenen Händen etwas zu erschaffen, dann können wir ja gehen. Komm, Georgia.« Allerdings dachte diese gar nicht daran, mir zu folgen.
»Destiny Arizona Clark, du bist so eine dämliche Kuh! Warum siehst du nicht, dass ich kein kleines Mädchen mehr bin, und gönnst mir wenigstens ein bisschen Spaß? Manchmal hasse ich dich.« Sie versuchte, mich zu ohrfeigen, doch ich konnte ihre Hand gerade noch abfangen. Schließlich kannte ich das aufbrausende Temperament meiner Schwester, sie hatte schon von klein auf oft die Beherrschung verloren und um sich geschlagen. Am besten war es, wenn man sie einfach in Ruhe ließ, bis sie sich von allein beruhigte. Dann war es auch wieder möglich, mit ihr zu sprechen, aber jetzt gab es dafür keine Chance. Seufzend sah ich ihr nach, wie sie die Toilettenräume verließ. Hoffentlich ging sie nur nach Hause und baute nicht irgendwelchen Mist, solange sie so aufgewühlt war.
»Destiny Arizona?« Dean, dessen Anwesenheit ich völlig vergessen hatte, stellte sich vor mich. »Wer zum Teufel heißt denn bitte Destiny Arizona? Bist du Hellseherin und sagst mir die Zukunft voraus? Oder warum heißt du ›Schicksal?‹« Oh Mann, wie ich diese dämlichen Fragen hasste. Wahrscheinlich käme als Nächstes die, ob mein Schicksal in Arizona liegen würde oder etwas ähnlich Witziges. Und wirklich musste er wahrhaftig genau das fragen? Ich gähnte demonstrativ.
»Glaubst du ernsthaft, es gibt einen Witz über meinen Namen, den ich noch nicht gehört habe? Ja, meine Mutter hat einen ausgesprochen schlechten Geschmack, wenn es um die Namenswahl für ihre Kinder geht, aber sonst ist sie ein herzensguter Mensch, und ich liebe sie trotzdem. Also lach ruhig, und wenn du dich wieder eingekriegt hast, zieh Leine.« Leider dachte er gar nicht daran.
»Ich mag Frauen mit Temperament. Ohne ist der Sex nicht halb so gut. Da deine Schwester ja tabu ist, könnten wir zwei Hübschen uns doch einen schönen Abend machen. Ich wusste wirklich nicht, dass sie noch so jung ist, ansonsten hätte ich sie nicht angebaggert.« Und das sollte ich ihm glauben?
Dean
Provokationen
Destiny Arizona - ich konnte immer noch kaum glauben, dass sie wirklich so hieß. Warum straften Eltern ihre Kinder nur mit solchen Namen? Hassten sie das Baby so sehr? Jeder wusste doch, wie schwer es war, aus derartigen Assischubladen, in denen man automatisch landete, wieder herauszukommen. Wenn Personalchefs eine Bewerbung mit so einem Namen erhielten, sortierten sie diese unter Garantie sofort aus. Die angeblich so offenen Amerikaner unterschieden sich in dieser Hinsicht nämlich nicht von den Menschen in anderen Ländern. Vorurteile gab es überall. So wenig ich mich fürs Geschäftsleben interessierte, das begriff sogar ich. Mein Name öffnete mir jede Tür, aber ihrer würde die Türen schließen, noch bevor sie überhaupt die Gelegenheit bekam, sich zu beweisen. Hinzu kam ihr Aussehen, mit dem sie auch nicht punkten konnte. Sie hatte ja weder Arsch noch Titten, um die Aufmerksamkeit von ihrem Namen darauf zu lenken. Trotzdem war da irgendetwas an ihr, das mich ansprach. Was das war, wusste ich selbst nicht. Zum Teil war es vermutlich ihr Temperament und dass sie keinerlei Respekt vor mir hatte. Das war ich wirklich nicht gewohnt. Normalerweise lagen mir die Frauen schon zu Füßen, wenn sie nur den Namen Kennedy hörten. Wahrscheinlich verflog das Interesse an ihr sowieso schnell, sobald ich sie erst einmal im Bett hatte, aber bis dahin war mein Jagdtrieb geweckt.
Optisch sagte ihre Schwester mir eindeutig eher zu, nur sie war natürlich tabu. Warum sah dieses Früchtchen mit ihren dreizehn Jahren eigentlich so erwachsen aus? Fast müsste ich Ari dankbar sein, dass sie mich gewarnt hatte. Das hätte richtig Ärger geben können, wenn ich mit der Kleinen erwischt worden wäre. Um mich erkenntlich zu zeigen, lud ich sie ein, etwas mit mir zu unternehmen. Das würde wenigstens mehr Spaß machen, als hier mit der stinkenden Farbe zu streichen. Meine Mutter hatte mir heute eine größere Summe auf mein Konto überwiesen, um anschließend mit gutem Gewissen in den Urlaub abzudampfen. Wahrscheinlich wollte sie nur meinen Vater provozieren, indem sie seine Taschengeldstreichung sabotierte. Mir sollte es egal sein. Hauptsache, ich konnte mich hier freikaufen. Die paar tausend Dollar juckten mich da nicht wirklich. Ich würde mich dann noch einmal bei der Eröffnung des Zentrums blicken lassen und danach einen weiten Bogen um diesen armseligen Stadtteil machen.
»Also, was ist? Gehen wir jetzt?«, fragte ich noch einmal nach, da sie auf meine Einladung nicht reagierte. Konnte sie nicht einfach Ja sagen? Das wäre doch die normale Reaktion auf meine Frage. Okay, etwas provokant klang es vielleicht, andererseits wurde sie sicher nicht so oft eingeladen, also sollte sie sich gefälligst freuen. Dennoch sah ihr Gesichtsausdruck eher angeekelt als freudig aus.
»Mit dir gehe ich nirgendwo hin. Du glaubst möglicherweise, alles im Leben wäre käuflich, aber dann wirst du heute zum ersten Mal enttäuscht werden. Mich kannst du jedenfalls mit deinem Geld nicht beeindrucken.« Sie verschränkte die Arme trotzig vor der Brust und warf mir verächtliche Blicke zu. So leicht gab ich nicht auf, bisher hatte ich jede bekommen, die ich haben wollte. Diesen kleinen Kaktus würde ich auch noch knacken, ich musste nur erst ihren Schwachpunkt finden.
»Du traust dich wohl nicht? Hast du Angst davor, etwas zu tun, das du später bereust? Die brauchst du nicht haben, wenn du mit mir zusammen bist, gibt es hinterher nichts zu bereuen.«
»Man, man, man, dein Selbstbewusstsein hätte ich gern. Du musst dich ja wirklich für ein Geschenk an die Welt halten. Dabei kennst du doch gar kein normales Leben mit normalen Menschen.« Nun lachte sie mich tatsächlich aus. Sie musste völlig den Verstand verloren haben. Ich hatte garantiert mehr Ahnung vom Leben, als dieses Mädchen aus der Gosse.
»Du bist hier doch diejenige, die keinen Schimmer vom richtigen Leben hat. Ich wette mit dir, dass du keine Woche in der besseren Gesellschaft von Miami überstehen würdest, ohne zusammenzubrechen. Die fressen dich mit Haut und Haaren, kleines Mädchen.« Davon war ich felsenfest überzeugt. Gerade die Frauen in meinen Kreisen neigten dazu, sich gegenseitig fertigzumachen. Wahrscheinlich griffen deshalb so viele zu Alkohol oder Drogen. So wie auch meine Mutter, die der Druck der High Society und das ständige Desinteresse meines Vaters schwach gemacht hatten. Von all diesen Dingen hatte dieses kleine Mädchen doch gar keine Ahnung. Das ging schon in der Junior High los und endete vermutlich nie. Wer nicht die Beste, Schönste und Reichste war, blieb unweigerlich auf der Strecke. Aber was verstand so ein kleines Mädchen schon davon?
»Was interessiert mich deine bessere Gesellschaft?« Letzteres sprach sie richtig abfällig aus. »Meinst du tatsächlich, das wäre es, worum es im Leben geht? Selbst wenn ich das Geld hätte, das du so gern mit beiden Händen auszugeben scheinst, wäre mir die Meinung dieser Lackaffen egal. Was wirklich zählt, sind Freunde und Familie, ohne die bist du gar nichts.« Sie redete sich richtig in Rage.
»Ich habe Freunde und eine Familie. Worauf willst du hinaus?« Irgendwie vermochte ich ihren Gedankengängen nicht zu folgen.
»Du wolltest mit mir wetten, dass ich keine Woche bei euch aushalte. Das mag sein, aber das will ich auch gar nicht. Allerdings wette ich, dass du hier im Trailerpark diese Zeit ebenfalls nicht durchhalten würdest, zumindest nicht ohne deine Kohle und ohne dieses ganze Schickimickizeug. Dann wärst du ein Niemand, und ob du damit leben könntest? Sofern dich kein Mensch anbetet, gehst du doch ein wie eine Primel.« Sie klang viel zu sehr davon überzeugt. Selbstverständlich wäre es eine Umstellung für mich, so hausen zu müssen, trotzdem würde ich das schon schaffen. Ein paar Tage ohne Luxus war ja quasi so wie Camping, und dazu hatte meine Mutter mich vor zehn Jahren bereits drei Wochen lang gezwungen.
»Natürlich würde ich es aushalten, besser als du in meiner Welt. Selbst wenn ich dir alles bezahlen würde, wärst du dort aufgeschmissen. Du könntest dich ja nicht einmal über wichtige Themen wie Politik, Wirtschaft oder wenigstens Mode unterhalten.« Nun fing sie wahrhaftig an, lautstark zu lachen. Irgendwie war das eine surreale Situation, wir standen hier in dieser Baustelle, die einmal ein Mädchenklo werden sollte, und sie lachte mich aus. »Was gibt es da zu lachen?« Es dauerte noch fast eine Minute, bis sie sich wieder einkriegte und mir antworten konnte.
»Du hältst tatsächlich Mode für ein wichtiges Thema? Politik - ja. Wirtschaft - natürlich. Aber Mode? Was für ein Schwachsinn, als würden Klamotten irgendetwas in der Welt verändern. Mit dem Geld, das du im Monat für überteuerte Kleidungsstücke ausgibst, bekomme ich die ganze Familie ernährt. Und von Politik und Wirtschaft verstehe ich schon etwas, logischerweise bin ich kein Experte, immerhin besuche ich erst die Highschool, deshalb solltest du mich trotzdem nicht unterschätzen. Ich bin kein blödes Blondchen, das nur als schmückendes Beiwerk dienen kann, sondern eine Frau, die einmal etwas erreichen wird.« Sie war so unglaublich naiv, aber möglicherweise musste man das sein, wenn man hier draußen nicht nur überleben, sondern auch noch zufrieden sein wollte. Nur zu gern würde ich ihr zeigen, wie es in der echten Welt zuging. Da kam mir eine Idee, wie ich sie dazu bringen konnte, Zeit mit mir zu verbringen.
»Unsere Welten sind Lichtjahre voneinander entfernt. Du würdest dich dort gar nicht zurechtfinden.« Wenn ich sie noch etwas provozierte, würde sie eventuell zustimmen. »Was hältst du von einer Wette? Bald sind doch Schulferien. Lebe diese Zeit mit mir, und ich zeige dir, wie schwer man es in unseren Kreisen hat. Vielleicht redest du dann anders. Natürlich komme ich für sämtliche Ausgaben auf.« Sobald das beknackte Zentrum fertig war, bekam ich ja endlich auch wieder Zugriff auf meine Kreditkarten, dann konnte ich ihr auch zeigen, wie es in der High Society zuging. Allerdings lachte Arizona nur. War dieses Mädchen völlig verrückt?
»Du glaubst ernsthaft, dass du in der wirklichen Welt lebst? Das ist nicht die reale Welt. Stell dir vor, ihr würdet alles einbüßen und im Trailerpark landen, daraufhin würde dich keiner deiner sogenannten Freunde und Bekannten noch kennen.« Da könnte sie sogar recht haben, aber zum Glück war es unmöglich, alles zu verlieren. Mein Vater war schließlich nicht dämlich, wir würden niemals so tief fallen, und selbst wenn, käme ich da schnell wieder heraus.
»Man muss nur hart genug arbeiten, dann kann man alles erreichen. Wir leben in den USA, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Vom Tellerwäscher zum Millionär und so. Doch wenn man sich mit dem zufrieden gibt, was man hat, kommt man natürlich auch aus dem Trailerpark nicht heraus und träumt naiverweise von einer besseren Welt.«
»Du hältst mich für naiv und dabei bist du es selbst. Falls es so leicht ist, aus dem Trailerpark wieder herauszukommen, probiere es mal am eigenen Leib aus. Allerdings ohne das Geld deines Vaters im Hintergrund.« Nun war es an mir, zu lachen. Was hätte das für einen Sinn? Selbstverständlich würde ich da irgendwie herauskommen, jedoch sah ich keinen Grund, warum ich mir das überhaupt antun sollte.
»Du bist nur zu feige und könntest ohne Daddys Kohle keine Woche überstehen.« Provozierend sah sie mich an. Was wagte sich dieses kleine Mädchen eigentlich? Noch nie hatte jemand so mit mir gesprochen! Aber das würde ich ihr austreiben. Auf einmal kam mir auch die Idee, wie ich das anstellen könnte. Die Idee mit der Wette war mir zwar ganz spontan gekommen, aber warum nicht das Ganze in die Tat umsetzen?
»Geld ist nur ein kleiner Teil meines Lebens, da gehört schon noch einiges mehr dazu. Uns werden die Regeln von klein auf eingebläut. Du wärst hierdurch völlig überfordert. Wenn du es vier Wochen in der High Society von Miami aushältst, ohne dass dich jemand durchschaut, ziehe ich im Anschluss vier Wochen in den Trailerpark. Aber das traust du dich wahrscheinlich nicht.«
Ob sie darauf eingehen würde? Ich glaubte es ja nicht, hoffte es aber gleichzeitig. Sie sah mich an, als hätte ich völlig den Verstand verloren, und sagte erst einmal gar nichts. Vielleicht sollte ich sie noch etwas herausfordern, damit sie endlich zustimmte.
»Also? Du traust dich wohl nicht.« Aus meinem Psychologiekurs, den ich im letzten Semester versehentlich gewählt hatte, wusste ich, dass die meisten Menschen sich mit solchen Aussagen sehr leicht provozieren ließen. Nur Destiny war anscheinend anders. Sie funkelte mich an und begann, mir einen Vortrag zu halten.
»Du hast doch absolut keine Ahnung, Kennedy. Für dich bedeuten Ferien wohl Freizeit und Party, aber das ist nicht überall so. Stell dir vor, es soll Personen geben, die ihre Ferienzeiten zum Arbeiten nutzen. Ich kann weder auf das Geld noch auf die Zeit zum Lernen verzichten, denn ich brauche meinen Durchschnitt, um ein Stipendium fürs College zu bekommen.« Sie sprach so abfällig über mich, dass ich vor Wut kochte. Was bildete sie sich nur ein? Sie konnte einfach nicht nachvollziehen, wie es war, in meiner Haut zu stecken. »Nicht jeder hat einen reichen Daddy, der ihm die Kohle in den Hintern bläst.« Nun reichte es wirklich! Ich drehte mich um, rief ihr dennoch noch über die Schulter zu: »Du bist doch nur neidisch, weil dein Vater das nicht tut.« Wahrscheinlich wusste sie nicht einmal, wer ihr Erzeuger war. Dämliche Göre.
Destiny Arizona
Verzweiflung
In den nächsten Tagen hatte ich viel zu tun, und gar keine Zeit, über Dean Kennedy nachzudenken, auch wenn er sich immer wieder in meine Gedanken schlich. Mehr als einmal überlegte ich, wie er wohl mit der Situation umgehen würde, in der ich jetzt steckte. Mir war klar, er wäre hoffnungslos überfordert. Okay, das war ich auch, doch mir blieb ja keine andere Wahl, als alles zu schaffen.
Vor drei Tagen verschlechterte sich Moms Zustand dramatisch. Er war plötzlich so schlecht, dass sie nun tatsächlich ins Krankenhaus musste, obgleich sie sich immer noch mit Händen und Füßen dagegen wehrte. Aber dieses Mal gab es keine andere Lösung, nachdem sie vor Schmerzen nicht einmal mehr aufstehen konnte. Zum Glück half Kim aus dem ›Hope‹ mir dabei, sie dorthin zu bringen. Sie leitete alles bei einer Stiftung in die Wege, damit diese die Kosten für den Aufenthalt übernahmen. Außerdem versprach sie mir, mich bei der Fürsorge zu unterstützen, sodass ich mich in der Zeit um meine Geschwister kümmern durfte und sie nicht in irgendwelche Heime oder Pflegefamilien abgeschoben wurden, bis Mom wieder gesund war. Ungeachtet dessen, dass es genau das war, was ich wollte, wurden die Stunden doch sehr anstrengend, und ich ging immer mehr auf dem Zahnfleisch.
Schon um halb sechs klingelte mein Wecker, stöhnend stand ich auf und schleppte mich unter die Dusche. Obwohl ich sie zum Ende hin auf eiskalt stellte, wurde ich nicht richtig wach. Zum Glück war heute wenigstens Freitag, und ich musste nur noch diesen Schultag überstehen, dann war endlich Wochenende. Für die nächste Woche war ich von der Schule beurlaubt. Mein Englischkurs fuhr auf Studienfahrt, und die Direktorin - Mrs. Peters - hatte genehmigt, dass ich zu Hause bleiben durfte und auch nicht in andere Kurse musste. Sie war wirklich spitze und hatte mir auch einige Infos über diese Stiftung gegeben, die sie unterstützte. Diese kümmerte sich um Fälle wie meine Mom. Mrs. Peters hatte mir sogar angeboten, mit mir zusammen einen Antrag zu stellen, aber das wollte ich nicht. Irgendwie hinderte mein Stolz mich daran, noch mehr Hilfe zu akzeptieren. Mom würde sowieso schon deswegen mit mir schimpfen. Ihr fiel es noch viel schwerer, Hilfe von außen anzunehmen. Für die Zeit, in der die Kleinen am Montag in der Schule waren, plante ich zum Sitz der Stiftung zu fahren und dort vorzusprechen, egal, was meine Mutter dazu sagte. Es ging so einfach nicht mehr weiter. Zumal mein Abschluss immer näher rückte, und im Moment sah ich meine Träume von einem Studium schon in Rauch aufgehen. Selbst wenn ich nur das Community College besuchen und zu Hause wohnen blieb, wäre es für mich mit den Kleinen allein nicht zu schaffen. An der Highschool hatte ich wenigstens ähnliche Schulzeiten wie sie, aber an der Uni gab es auch abends noch Kurse, und ich wüsste niemanden, der die Kids währenddessen betreuen könnte. Es gab nur eine Lösung: Mom musste innerhalb des nächsten Jahres wieder soweit gesund werden, dass sie zumindest den Haushalt und die Kinderbetreuung wieder übernehmen konnte. Irgendeinen Job würde ich dann schon finden, den ich neben dem Studium übernehmen konnte, um sie finanziell zu unterstützen, doch diese Chance war wirklich gering.
Während ich über all diese Dinge nachdachte, bereitete ich das Frühstück vor und weckte im Anschluss meine Geschwister. Sowie alle wach waren, fehlte mir glücklicherweise die Zeit zum Grübeln. Die Lautstärke im Trailer war viel zu hoch, als sich alle anzogen, ihre Schulsachen zusammensuchten - eigentlich sollten die Taschen ja am Abend gepackt werden, aber irgendwie funktionierte das nie.
»Wer hat mein Geodreieck geklaut? Das lag gestern neben dem Fernseher.« Savannah sah mich so vorwurfsvoll an, als hätte ich es weggelegt, um sie zu ärgern.
»Savannah, hier klaut keiner. Hast du es vielleicht doch eingesteckt? Sieh bitte nach, ehe du solche Anschuldigungen aussprichst«, ermahnte ich sie. Trotzdem war sie felsenfest davon überzeugt, dass es ihr jemand gestohlen hatte, und schimpfte herum, bis wir losgehen mussten. Zum Glück fuhr der Bus zur Highschool erst fünf Minuten nach dem für die Kleinen, ansonsten hätte ich ihn heute wohl verpasst. Erst als ich im Kurs auf meinen Platz plumpste, konnte ich etwas aufatmen. Wenn ich meine Geschwister an manchen Tagen erlebte, schwor ich mir, niemals eigene Kinder in die Welt zu setzen.
In den Unterrichtsstunden gab ich mir alle Mühe, um alles mitzubekommen, leider konnte ich es trotz alledem nicht verhindern, dass ich in Gedanken immer wieder abschweifte. Die Sorge um Mom und die Aufgaben, die nach Schulschluss noch im Haushalt auf mich warteten, nahmen einen Großteil meines Denkens ein. Egal wie sehr ich versuchte, sie aus dem Kopf zu bekommen.
»Ari, geht es dir gut?« Mrs. Jackson - die Englischlehrerin - fing mich nach dem Unterricht an der Tür ab. Selbstverständlich wusste auch sie von unserer Situation.
»Ja, es geht schon.« Keinesfalls würde ich jetzt klagen, sonst bekamen wir doch noch das Jugendamt auf den Hals gehetzt.
»Habt ihr ein gutes soziales Netz? Menschen, die dir helfen? Du musst nicht alles allein schaffen.« Soziales Netz? Dass ich nicht lachte. Natürlich gab es das ›Hope‹, und das war eine riesen Unterstützung, aber ansonsten lebten im Trailerpark eigentlich alle nebeneinander her. Obwohl die Mobilheime dort dicht an dicht standen, interessierte sich kaum einer für den Nachbarn, solange man sich nicht gegenseitig auf die Nerven ging. Üblen Nachbarschaftsstreit, der auch mal in Gewalt endete, den gab es öfter, aber Beistand? Davon konnte ich nur träumen.
»Das ›Hope‹ wird offiziell zwar erst in ein paar Wochen wiedereröffnet, aber meine Geschwister dürfen trotzdem nach der Schule dorthin kommen. Sie werden mit Mittagessen versorgt und betreut.« Dass die Betreuung im Moment allerdings keine Hausaufgaben umfasste und ich die abends noch mit den Kindern machen musste, erwähnte ich nicht. Manches blieb einfach besser ungesagt. So ganz schien sie mir nicht zu glauben, wenn ich ihren Blick richtig deutete, doch zumindest sagte sie kein weiteres Wort dazu.
»Okay, es ist nämlich wichtig, dass du den Stoff verinnerlichst und möglichst noch ein paar Bücher extra liest. Bald gehen die Prüfungen los, und du brauchst gute Noten, um eine Chance auf ein Stipendium zu haben.« Als wüsste ich das nicht selbst. Am liebsten wäre ich davongestampft, aber ich riss mich zusammen und nickte nur.
»Hier, diese Bücher werden dir bei der Vorbereitung helfen. Ich leihe sie dir, dann musst du nicht extra in die Bibliothek. Du kannst sie bis nach dem Examen behalten.« Das war wirklich eine riesen Erleichterung für mich, denn beide Exemplare durften nur in der Bücherei gelesen und nicht ausgeliehen werden. Außerdem war die Warteliste lang, und ich hätte irgendwann Zeiten zugeteilt bekommen. Nun konnte ich sie zu Hause ganz in Ruhe durcharbeiten. Beinahe hätte ich vor Rührung angefangen zu weinen, aber das durfte ich keinesfalls zulassen. Wenn ich erst einmal damit anfangen würde, könnte ich es wahrscheinlich so schnell auch nicht wieder stoppen.
»Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.« Das waren Bücher, die über hundert Dollar pro Stück kosteten. Dass sie mir die einfach so auslieh, war unglaublich. Ein Vertrauensbeweis, den ich eigentlich gar nicht verdient hatte.
»Gib dein Leben und deine Träume nicht auf, egal was passiert. Du hast eine harte Zeit hinter dir und musst schon wieder eine überstehen. Aber du bist stark und schaffst das. Ich glaube fest an dich.« Sie hatte gut reden. Wenn ich ganz ehrlich war, sah ich meine Zukunftspläne bereits jetzt den Bach hinuntergehen. Bald endete das Schuljahr, und dann hatte ich nur noch eins vor mir bis zum Highschoolabschluss. Falls nicht bald ein Wunder geschah und es meiner Mutter schlagartig besser ging, konnte ich sämtliche Pläne vergessen. Mit einem Abschluss am Community College - falls ich den neben Job und die Kinderbetreuung schaffte - würde ich nie das erreichen können, wie mit einem erfolgreichen Studium an einer renommierten Universität. Natürlich gab es Abkommen, die einem nach dem Community College den Wechsel an eine der großen Universitäten ermöglichten. Aber das bedeutete dann noch vier Semester mehr, bis ich irgendwann mit der Ausbildung fertig wäre. Neun Jahre mit Stipendien zu studieren war so gut wie unmöglich, und das Geld würde ich selbst nie zusammenbekommen. Außerdem waren die Anforderungen an Stipendiaten hoch, wie sollte ich die je erfüllen, neben der Betreuung meiner Geschwister und diversen Nebenjobs? Vermutlich musste ich eher nach den zwei Jahren in irgendeinem Büro versauern. Selbst die Chance auf einen Job als Sekretärin in einer Rechtsanwaltskanzlei erschien mir gering.
»Ich versuche es.« Es klang total halbherzig, wie ich es sagte, aber meine Lehrerin gab sich für den Moment damit zufrieden und verabschiedete sich von mir. Wahrscheinlich fielen ihr auch keine aufbauenden Sprüche mehr ein. Während ich die Bücher in meiner Tasche verstaute, brodelte es in mir. Am liebsten hätte ich sie an die nächste Wand gepfeffert, weil alles keinen Sinn machte. Ich war so wütend auf das Schicksal, meinen Bruder, der den falschen Weg wählen musste und mir damit die Verantwortung überließ, aber auch auf meine Mutter. Dabei konnte sie ja nichts dafür, krank zu sein. Aber sie hatte so viele Kinder in die Welt gesetzt und keinen der Väter halten können. Warum konnte sie nicht nach zwei oder drei aufhören? Nein, es mussten ja sieben werden, und wer weiß schon, ob sie nicht noch weiter Babys bekommen hätte, wenn sie nicht krank geworden wäre. Nur auf die Kleinen konnte ich nicht böse sein, denn sie waren an der Situation genauso unschuldig wie ich. Daher beeilte ich mich, jetzt nach Hause zu gehen, damit ich mich um sie kümmern konnte.
Dean
Ein Unglück kommt selten allein
Nachdem ich die Arbeit in diesem dämlichen Zentrum delegiert hatte, konnte ich endlich ein bisschen abschalten. Meine Mutter war noch im Urlaub und mein Vater auf Geschäftsreise, daher schwänzte ich in den nächsten Tagen die Uni, um mich zu erholen. Die ganze Woche verbrachte ich allein im Haus meiner Eltern und ließ mich von der Köchin verwöhnen, chillte im Pool oder auf den Liegen und tat einfach mal gar nichts.
Nicht einmal auf Gesellschaft hatte ich Lust. Bei der Schufterei in diesem Scheißcenter hatte ich täglich Menschen um mich gehabt, die ich nicht mochte. Da war es doch nur verständlich, dass ich nun etwas Ruhe brauchte. Das Personal zählte ich da natürlich nicht zu. Erst am Freitag erwachte ich wieder richtig zum Leben. Es war nun wirklich Zeit zum Feiern und meine Freunde - obwohl ich auf die eigentlich sauer sein müsste. In den letzten Wochen, in denen ich zur Strafarbeit verdonnert war und nicht Party machen konnte, hatte sich keiner von den Ärschen gemeldet. Trotzdem galt der erste Anruf jetzt Toby. Er war einer meiner besten Freunde an der Uni. Sein Vater war Politiker und wollte unser nächster Senator werden, wie ich heute gelesen hatte. Doch Toby ging nicht ans Handy, deswegen ging nach dem fünften Klingeln seine Mobilbox an. Auf die Dinger sprach ich grundsätzlich nicht. Deshalb öffnete ich nun den Messenger und schrieb einfach eine Gruppennachricht an Toby, Daniel, Mark und Ted.
Hey, Leute. Ich bin wieder frei. Was geht heute Abend ab?
Komischerweise kam nicht gleich eine Antwort. Daher beschloss ich, zuerst duschen zu gehen und mich zu stylen. Bis ich damit fertig war, hatten sie bestimmt geantwortet, und ich wusste, wo ich hinmusste. Immerhin war Freitag, da saß garantiert niemand blöd zu Hause herum. Doch auch als ich vierzig Minuten später fertig war, zeigte mein Telefon mir keine Nachricht an. Was sollte denn der Mist? Die würden wohl kaum alle büffeln. Die Prüfungen gingen zwar bald los, aber keiner meiner Kumpels war ein Streber, der Freitagabend lernte.
Zuerst versuchte ich noch einmal, Toby zu erreichen, aber wieder klingelte es nur, und er hob nicht ab. Okay, das konnte ich vergessen, somit musste ich mich halt an Jeremia wenden. Wenn jemand wusste, wo die Party abging, dann er, denn er versorgte die Partypeople mit Ecstasy und Koks. Da gehörte es zu seinem Job, zu wissen, wo gerade gefeiert wurde. Und wirklich, drei Minuten nachdem ich ihn angeschrieben hatte, kam auch schon die Antwort. Die Adresse sagte mir nichts, zum Glück gab es ein Navi für diesen Fall. Bisher fehlte mir zwar noch ein neues Auto - mein Dad zickte da echt herum - aber in der Garage stand ja genug Auswahl. Solange ich keinen Strafzettel bekam und den Wagen nicht zerkratzte oder vollgesaut wurde, würde er nie mitbekommen, dass ich einen ausgeliehen hatte. Am liebsten hätte ich ja Dads Jaguar genommen, aber das würde vermutlich der Chauffeur bemerken, der dieses Auto mehr liebte als seine Frau. Deshalb gab ich mich mit dem SUV zufrieden, der war auch nicht so auffällig wie der Sportwagen meines Vaters.
Zwanzig Minuten später kam ich an der Adresse an, die Jeremia mir gegeben hatte. Typisch für die Partys unseres Jahrgangs standen hier wie immer Wagen an Wagen am Straßenrand. Bereits vor dem Haus waren laute Musik zu hören und das Wummern der Bässe zu spüren. Außerdem standen einige Gruppen draußen, tranken, lachten und unterhielten sich. Der Spaß musste schon in vollem Gange sein. Wahrscheinlich hatte Toby meinen Anruf deshalb nicht gehört.
Wie immer schlenderte ich zuerst ins Haus, um mir einen Überblick über die Anwesenden zu verschaffen. Es dauerte auch nicht lange, bis ich Toby und den Rest unserer Clique entdeckte. Sie standen mit einigen anderen an einem Tisch und spielten mal wieder Bierpong. Das war eines der beliebtesten Trinkspiele hier auf dem Campus, bei dem man Tischtennisbälle in Becher versenken musste. Der Verlierer musste dann auf Ex trinken. Normalerweise hatte ich darauf nie Lust, aber heute war alles anders. Endlich wieder Zeit für Party, da würde mich selbst dieses eklige Gesöff nicht schrecken. Schnell schlängelte ich mich durch die Menge bis zu ihnen hinüber.
»Hey, Leute. Ich bin wieder da.« Eigentlich rechnete ich als Antwort mit Johlen oder zumindest großer Freude, doch stattdessen verstummten alle und sahen mehr oder weniger betreten zu Boden. Was war denn mit denen los? Freuten sie sich etwa nicht, mich nach der Zeit wiederzusehen? Sie konnten doch nicht sauer sein, weil ich in letzter Zeit diese Sozialstunden ableisten musste.
»Toby, ich hab schon seit Stunden versucht, dich zu erreichen.« Jedoch statt eines Spruchs oder einer Entschuldigung verdrehte Toby nur die Augen. Was sollte das denn?
»Ein Zaunpfahl reicht bei dem wohl nicht.« Das Mädchen, das an Tobys Arm hing, kicherte auch noch nach diesem dämlichen Spruch. Langsam dämmerte mir, was er zu bedeuten hatte. Konnte es echt sein, dass sie mich nicht dabeihaben wollten? Natürlich war ich jetzt einige Zeit nicht auf Partys gewesen, trotzdem waren letzte Woche in der Uni alle noch völlig normal zu mir. Warum behandelten sie mich dann jetzt wie einen Aussätzigen? Ich verstand das einfach nicht.
»Sorry, Mann. Aber ...« Ted brach mitten im Satz ab. Die Situation schien ihm genauso unangenehm zu sein wie mir.
»Was aber?«, fragte ich lauter, als ich eigentlich wollte. Super, nun fingen die Leute auch noch an zu gucken und mit dem Finger auf mich zu zeigen. Ich hasste es und musste mich wahrhaftig zusammenreißen, um nicht auf einen von den Arschlöchern loszugehen.
»Das müssen wir wirklich nicht hier in der Öffentlichkeit klären. Dean, fahr du schon einmal vor ins ›Lou‹, wir kommen in zehn Minuten nach, und dann sprechen wir über alles.« Was sollte denn der Scheiß? Noch ehe ich die Frage laut stellen konnte, drehten sich alle um und gingen davon. Klar, das ›Lou‹ war unsere Stammkneipe, aber die lag einige Meilen von dieser Party entfernt. Nachlaufen würde ich ihnen sicher nicht. Wütend griff ich nach einem Becher mit Bier und schüttete es auf ex hinunter. Brrrr, war das eklig. Warum konnten die Idioten hier nichts Anständiges trinken? Whiskey, Wodka oder etwas in der Art schmeckte doch viel besser und haute viel mehr rein. Sogar Champagner zog ich diesem Gesöff vor. Wobei ich jetzt gerade etwas Stärkeres brauchte, um dieses Verhalten meiner angeblichen Freunde zu verarbeiten, leider gab es das hier nicht. Zumindest nicht für jeden sichtbar, und ich hatte im Augenblick wahrhaftig keinen Bock, irgendjemanden zu fragen. Deshalb griff ich noch einmal zu und kippte in Windeseile drei weitere Becher Bier hinterher, bevor ich mich umwandte und in Richtung des Ausgangs strebte. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mich hier jeder beobachtete und hinter meinem Rücken über mich tuschelte. Was bildeten die sich eigentlich alle ein?
An der Tür traf ich auf Jeremia, der mich als einziger freundlich ansah.
»Hey, Kennedy. Hast du deine Kumpels verpasst? Die sind gerade weggefahren.« Er sah mich genauer an und kam dann ein bisschen näher, damit nicht jeder mithören konnte, was er sagte. »Oder lassen sie dich wegen der Schlagzeilen jetzt fallen? Tut mir echt leid mit deiner Mutter.« Nun verstand ich gar nichts mehr. Meine Mutter? Schlagzeilen? Was hatte ich da nur nicht mitbekommen? Doch noch ehe ich die Frage laut stellen konnte, fluchte Jeremia laut.
»Fuck, du weißt es gar nicht? Wo hast du denn die letzten Tage gesteckt, Mann?« Was sollte ich darauf sagen? Für meine Umwelt hatte ich mich jedenfalls nicht interessiert. Aber mein Vater hätte mir doch mitgeteilt, wenn etwas Schlimmes passiert wäre. Oder? Allerdings wollte ich auch nicht hier in der Öffentlichkeit zugeben, dass ich keine Ahnung hatte und noch peinlicher nachfragen. Daher winkte ich nur ab und versuchte, weiter zu meinem Wagen zu laufen. Das verhinderte jedoch Jeremia erst einmal, indem er mich mit einer Hand am Arm festhielt. Mit der anderen streckte er mir ein Beutelchen mit Tabletten hin.
»Hier, wenn du abschalten willst, aber nur eine, da du es nicht gewohnt bist. Sieh es als Geschenk.« Eigentlich hätte ich ablehnen sollen, ich nahm sonst nie Pillen oder Drogen, doch heute hatte ich irgendwie das Gefühl, ich würde es vielleicht brauchen.
»Danke«, rief ich im Gehen zu und beeilte mich, zu meinem Auto zu kommen. Bloß weg hier, war mein einziger Gedanke. Erst hatte Toby mich so stehen lassen und dann wohl auch noch belogen. Hatte er nicht eben noch gesagt, ich solle vorfahren ins ›Lou‹? Warum waren die Jungs dann doch schon vor mir aus dem Haus gegangen? So lange hatte ich für die paar Biere nun auch nicht gebraucht. So schnell ich konnte, startete ich mein Auto und fuhr davon. Doch nicht ins ›Lou‹, denn ich war mir sicher, dass dort sowieso niemand auftauchen würde, sondern erst einmal ein paar Straßen weiter, in eine Gegend, in der es ruhiger war. Dort parkte ich und holte mein Handy aus der Tasche, um mit zitternden Fingern den Namen meiner Mutter in die Suchmaschine einzugeben. Insgeheim hoffte ich noch immer, dort nichts außer dem üblichen Klatsch zu finden. Vielleicht einfach ein paar Berichte über Wohltätigkeitsgalas, die meine Mutter so gern ausrichtete. Leider sprangen mich die Schlagzeilen regelrecht an.
UNTERNEHMERGATTIN AUF ABWEGEN
ALKOHOLFAHRT ENDETE IM KRANKENHAUS
ERST DER SOHN UND NUN DIE MUTTER - SIND DIE KENNEDYS ALKOHOLIKER?
VERSUCHTER SELBSTMORD DER
UNTERNEHMERGATTIN?
DIE BETROGENE EHEFRAU ERTRÄNKT DEN KUMMER IM ALKOHOL?
Die Headlines waren nicht das Schlimmste, auch wenn ich mir anhand der Überschriften sicher war, dass sie noch lebte, erschreckte mich das Bild eines völlig zerstörten Autos sehr. Auf einem anderen Bild sah man, wie Mom in einen Krankenwagen geschoben wurde. Daneben ein kleines Bild meines Vaters mit einem Mädchen im Arm, das kaum älter als ich sein konnte. War den Medien denn gar nichts heilig? Das Handy flog wie von selbst auf den Beifahrersitz. Dass sie meinen alten Herren bloßstellten, störte mich weniger, aber meine Mutter in so einer Situation zu fotografieren? Das ging nun einmal gar nicht. Wieso unternahm Dad nichts, um diese Fotos verschwinden zu lassen? Ich kochte vor Wut. Warum, verdammt, hatte mich niemand informiert? Der Unfall war vor vier Tagen passiert. Zeit genug, damit mein Vater oder wenigstens einer vom Personal mir etwas hätte sagen können. Unsere Köchin gehörte fast zur Familie, und trotzdem hatte es kein Schwein für nötig befunden, mir etwas zu sagen. Nicht einmal, wie es Mom ging und wo sie sich derzeit aufhielt, wusste ich. In mir brodelte es, und am liebsten hätte ich laut geschrien oder auf irgendetwas eingeprügelt. Stattdessen griff ich nach dem Telefon, um meinen Vater zur Rede zu stellen. Doch statt ihm meldete sich - logisch - nur die Mobilbox. War ja klar, dass er mal wieder nicht für mich erreichbar war. Ich war ja auch nur sein Sohn, der konnte natürlich warten. Mit leicht zitternden Händen startete ich den Wagen und schoss mit Vollgas los, ohne so recht zu wissen, wo ich hinwollte. Sollte ich nach Hause fahren? Oder besser in die Firma? Irgendwann musste mein Vater dort doch auftauchen. Allerdings war es jetzt noch mitten in der Nacht, da war die Chance gering, ihn dort anzutreffen. Zumal ich keine Ahnung hatte, wann er genau von dieser angeblichen Geschäftsreise zurückerwartet wurde. Es war zum Haareausreißen.
Und ausgerechnet jetzt ließen mich zudem meine angeblichen Freunde im Stich. Das hätte ich von Toby wirklich nie erwartet. Bei den Gedanken an ihn fuhr ich wieder los und gab mehr und mehr Gas. Die Tachonadel zeigte schon knapp hundertzehn Meilen pro Stunde an. Aber mir reichte das trotzdem nicht. Inzwischen hatte ich die Stadt verlassen, und der Highway war zum Glück so gut wie leer um diese Zeit. Daher trat ich noch fester aufs Gas, wollte vor diesem Gefühl der Hilflosigkeit davonrasen, aber es klebte an mir wie Pech - genauso fühlte ich mich auch, vom Pech verfolgt. Vor allem als nun hinter mir auch noch Blaulicht auftauchte. Musste denn heute alles schiefgehen?
Dean
Eine höllische Nacht
Ein unsanfter Stoß in die Rippen verursachte, dass ich fast von der Bank fiel, auf der ich vor mich hin gedöst hatte. Am liebsten würde ich laut losschimpfen, aber allein das Aussehen des Kerls neben mir führte dazu, dass ich es unterließ. Der Typ war nicht nur mindestens zwei Meter groß, sondern mit Sicherheit zudem voller Anabolika, zumindest ließen seine unnatürlich wirkenden Muskelberge darauf schließen. Auch die Tätowierungen am Hals und im Gesicht erzielten die vermutlich beabsichtigte Wirkung. Er schüchterte mich ein. Jemand, der so aussah, war bestimmt ein Schläger, wenn nicht Schlimmeres.
»Du sabberst beim Schlafen«, teilte er mir fies grinsend mit. Wahrscheinlich, um mich zu provozieren. Erstens sabberte ich nie, und zweitens hatte ich bisher kein Auge zugemacht. Die Umgebung und meine Zellengenossen sorgten für eine Angespanntheit, die mich gar nicht abschalten ließ. Außerdem tat mein Hintern schon verdammt weh von dieser harten Holzbank. Ich hatte also nicht eine Minute wirklich geschlafen, obwohl ich bereits seit Stunden hier festsaß und die Nacht bald vorbei war. Zumindest wenn die Uhr, die gegenüber der Zellentür hing, richtig ging. Mein Handy und meine Armbanduhr hatte der Polizist, der mich vorhin wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren unter Alkoholeinfluss und Drogenbesitzes festgenommen hatte, abgenommen. Die Sachen würde ich wiederbekommen, wenn ich hier raus durfte, allerdings hatte ich keine Ahnung, wie lange das noch dauern konnte. Meinen Vater hatte ich natürlich wieder nicht erreicht, ihm dieses Mal aber auf die Mobilbox gesprochen. Nun blieb mir nichts anderes, als zu warten und zu hoffen, dass er diese schnell abhören und mir zur Hilfe eilen würde.
Doch bisher war keine Spur von ihm oder einem Anwalt zu sehen. Unterdessen müsste mein Vater längst aufgestanden sein. Vielleicht war das seine Art, mich zu bestrafen. Die wiederholte Alkoholfahrt, obwohl er mir ja verboten hatte, mich hinters Steuer zu setzen, und dann noch der Drogenbesitz würden ihn ausrasten lassen. Dabei hatte ich Jeremias Pillen gar nicht angerührt. In der Zwischenzeit wünschte ich mir aber auch, sie nie angenommen zu haben. Denn mit jeder Minute hier wuchs die Angst, wegen der Geschichte verurteilt zu werden und im Knast zu landen. Was Kerle wie dieser tätowierte Muskelberg dort mit mir anstellen könnten, wollte ich gar nicht wissen.
Sechs Stunden später saß ich noch immer, derweil allerdings ganz allein in der Zelle, alle anderen waren längst wieder auf freiem Fuß oder dem Haftrichter vorgeführt worden. Mittlerweile hielt ich es auf der Bank nicht mehr aus, sondern lief auf und ab. Die anwesenden Polizisten hatten bereits vor einiger Zeit gewechselt, und jedes Mal, wenn einer von ihnen hierher kam, hoffte ich, endlich hier rauszukommen. Doch genauso schnell, wie die Hoffnung kam, verflog sie auch wieder, wenn nur einer der anderen gehen durfte oder es etwas zu essen gab. Zwei Mahlzeiten hatte man mir schon gebracht, und ich konnte bisher keinen Bissen hinunterbekommen. Mir war kotzübel, wenn ich daran dachte, noch länger hierbleiben zu müssen. Die würden mich doch nicht in den richtigen Knast schicken, oder? So sehr ich die Arbeit in diesem dämlichen Sozialzentrum hasste, jetzt begriff ich langsam, wie gut ich davongekommen war nach dem Unfall. Zuerst lag ich im Krankenhaus, währenddessen hatte Dad dafür gesorgt, dass ich hinterher gleich nach Hause durfte. Es gab zwar eine Befragung durch zwei Polizisten, jedoch bei mir daheim, und dann kümmerte mein Vater sich darum, dass ich damit nicht weiter behelligt wurde. Was hatte ich mich über die erzwungenen Besuche bei den Zwillingen und später über die Arbeitsstunden im Zentrum geärgert, doch ohne das wäre ich wohl schon eher hier gelandet. Je mehr ich darüber nachdachte, umso schlechter fühlte ich mich. Mein Vater musste mich hier einfach noch einmal herausboxen. Ich könnte eine Haftstrafe nicht überstehen. Trotzdem wollte ich nicht auf ihn angewiesen sein. Insgeheim gab ich nämlich ihm die Schuld an allem. Würde er Mom nicht seit Jahren betrügen, wäre sie keine Alkoholikerin, und ich hätte vielleicht eine Familie gehabt. Aber was nutzte alles ›hätte‹, ›wäre‹ und ›wenn‹? Ich verhielt mich ja auch nicht wirklich besser als er, ich spielte mit den Frauen und ließ sie dann fallen. Dabei log ich zwar nicht und machte ihnen klar, dass ich keine Beziehung suchte, dessen ungeachtet hatte ich trotzdem einige Herzen gebrochen. Genau wie mein Vater das Herz meiner Mutter gebrochen hatte.
»Kennedy? Willst du nicht raus?« In meinen Grübeleien hatte ich gar nicht mitbekommen, dass ein Polizeibeamter in der geöffneten Tür stand, um mich hier heraus zu holen. Wobei noch zu klären war, wohin ich nun sollte. Wurde ich nur geholt, um dem Haftrichter vorgeführt zu werden, oder kam endlich Hilfe? Zu fragen traute ich mich nicht. Daher musste ich mich wirklich zusammenreißen, als ich meinen Vater und unseren Anwalt sah. Noch nie war ich so froh gewesen, meinen Dad zu sehen, auch wenn er sicherlich stinksauer auf mich war. Obwohl er im Moment eher genauso verzweifelt und erschöpft aussah, wie ich mich fühlte.
»Es tut mir leid, Dad. Ich …« Doch er winkte ab und fiel mir ins Wort.
»Spar dir den Atem, ich mag im Augenblick nichts hören. Komm, wir fahren.« Normalerweise hätte ich mich aufgeregt, wie er mit mir sprach, so eiskalt und völlig ohne Gefühl in der Stimme, aber ausnahmsweise tat ich es mal nicht. Dafür war ich viel zu froh, hier endlich verschwinden zu können.
Vor der Tür schüttelte er dem Anwalt die Hand und bedankte sich für seine schnelle Hilfe. Als ich das ebenfalls tun wollte, verbat er mir erneut den Mund und forderte mich stattdessen auf, in das Auto zu steigen, in dem schon sein Chauffeur saß. Langsam ging mir dieses Gehabe schon wieder auf die Nerven, doch ich bemühte mich, ruhig zu bleiben. Es war vermutlich klüger, erst einmal das Donnerwetter abzuwarten und so lange schön den Kopf einzuziehen und den Mund zu halten. Auch wenn ich faktisch jedes Recht hatte, ihm die Meinung zu sagen. Eine Vorwarnung von ihm, und ich hätte auf der Party nicht so scheiße dagestanden.
Mein Vater stieg ein und sofort fuhr der Wagen los und die Trennscheibe wurde geschlossen. Wahrscheinlich war der Fahrer froh, die folgende Unterredung nicht mitverfolgen zu müssen. Doch zu meiner Überraschung sagte Dad zunächst gar nichts, sondern lehnte den Kopf anscheinend erschöpft nach hinten und schloss die Augen. Eigentlich wollte ich das Gespräch nur möglichst schnell hinter mich bringen, aber irgendetwas an seiner Haltung hinderte mich daran, mit dem Sprechen zu beginnen. So fertig mit der Welt hatte ich ihn wirklich noch nie gesehen. Dabei hatte ich so viele Fragen im Kopf, die ich ihm stellen wollte. Wo war meine Mutter? Wie ging es ihr? Warum war er nicht eher gekommen? ... Doch ich hielt genau wie er den Mund, bis wir zu Hause ankamen.
Dad bedankte sich bei seinem Chauffeur und betrat durch die Garage das Haus. Wie ein Hund lief ich ihm wortlos hinterher bis ins Wohnzimmer, wo er an die große Bar schritt und sich einen Whiskey einschenkte.
»Auch einen?«, fragte er tatsächlich. Was war nur los? Noch nie hatte ich ihn tagsüber Alkohol trinken sehen, ganz im Gegenteil zu meiner Mutter, und nun bot er mir auch noch welchen an? Oder war das nur eine Falle? Wollte er mich testen, ob ich auch schon abhängig war, so wie meine Mutter? Allerdings trank Mom seit Jahren - eigentlich sogar so lange ich denken konnte - und es hatte ihn nie interessiert. Wieso dann bei mir?
»Nein, danke. Tagsüber trinke ich nicht.«
»Dafür abends umso mehr. Null Komma sechs Promille hattest du gestern, mein Lieber. Noch ein bisschen mehr, und du wärst jetzt nicht auf freiem Fuß. Das ist dir hoffentlich klar, und das gerade jetzt, wo deine Mutter in allen Schlagzeilen ist. Versuchst du, die Familie komplett in den Schmutz zu ziehen?« Seine Stimme wurde mit jedem Wort lauter, und am Ende schrie er regelrecht. »Und dann noch Drogen. Weshalb musst du mir das nur antun? Gleich morgen werde ich einen Platz in einer Entzugsklinik für dich suchen. Vielleicht gibt es dort ja Familienrabatt.« Seinen sarkastischen Unterton konnte er sich wirklich sparen. Ich war kein kleines Kind, und er durfte nicht so mit mir umgehen.
»Ich habe ...« Doch er ließ mich gar nicht aussprechen, sondern fiel mir direkt ins Wort.
»Es ist mir völlig egal, was du für Gründe für dein Verhalten hattest. Die Zeit der Ausreden ist jetzt endgültig vorbei. Deine Mutter ist bereits in der Klinik und du wirst ihr folgen. Ich dulde es nicht, dass ihr den Namen Kennedy in den Dreck zieht.« Seine selbstgefällige Art machte mich wahnsinnig. Wer war denn schuld an der ganzen Misere? Jetzt spielte er auf einmal das Familienoberhaupt, aber sonst kümmerten wir ihn einen feuchten Kehricht, wie ich heute Nacht erst wieder bemerken durfte. Wann war er schon einmal da, wenn ich ihn brauchte?
»Du duldest es nicht?« Ein weiteres Mal versuchte er, mich zu unterbrechen, aber dieses Mal ließ ich es nicht zu. »Hast du vielleicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht, warum Mom trinkt? Und wenn du die Gütigkeit gehabt hättest, mich über ihren Zustand zu unterrichten, dann hätte ich nicht erst gestern auf der Party vor allen Leuten davon erfahren. Denkst du, es gefällt mir, wenn meine Freunde mich auf einmal wie einen Aussätzigen behandeln?«
»Jetzt bin ich wohl schuld an allem? Trotzdem, diesen Schuh ziehe ich mir nicht an.« Dad kochte immer noch vor Wut, das konnte ich ihm ansehen, aber in mir sah es nicht besser aus. All der Frust der letzten Jahre kam nun mit einem Mal wieder hoch und wollte raus. Würde ich das unterdrücken, käme es wahrscheinlich irgendwann zu einer Explosion.
»Nicht an allem, Mom hätte dich ja auch einfach verlassen können, statt zu saufen, aber dennoch bist du an vielem schuld. Glaubst du etwa, wir wüssten nichts von deinen ständigen Affären? Und dass du nie Zeit für sie oder mich hattest, ist auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Aber dass du es nicht einmal für nötig befunden hast, mich über Moms Zustand zu informieren, sagt doch alles. In Familien tut man solche Dinge nicht, aber wir waren ja noch nie eine Familie, sondern eigentlich nur drei Personen, die zufällig unter einem Dach lebten.« Inzwischen zitterte ich am ganzen Körper vor Wut, und wann ich die Hände zu Fäusten geballt hatte, konnte ich auch nicht mehr sagen. Nur eins wusste ich, wenn ich mich nicht ganz fest zusammenriss, würde ich etwas tun, was ich vermutlich später bereuen würde. Ihm eine reinschlagen zum Beispiel.
»Du denkst, du wüsstest alles. Aber du hast überhaupt keine Ahnung, mein Sohn. In deiner Fantasie mag ich der Bösewicht sein, aber das bin ich nicht. Auch wenn das wahrscheinlich leichter für dich zu akzeptieren wäre als die Wahrheit. Denn die würdest du gar nicht vertragen.« Was für einen Scheiß laberte er nun wieder? Konnte er nicht einmal Klartext sprechen?
»Dann sag mir einfach die Wahrheit. Ich ertrage mehr, als du dir vorstellen kannst.«
»Nicht jetzt, Dean. Ich muss jetzt ins Büro zu einem bedeutsamen Meeting, und du solltest deinen Rausch ausschlafen. Danach bleibst du weiterhin im Haus, bis ich Zeit habe, mich mit dir zu unterhalten.« Mit offenem Mund sah ich ihm nach, wie er in sein Ankleidezimmer ging und mich einfach so stehen ließ. Am liebsten wäre ich ihm nachgelaufen und hätte ihn zur Rede gestellt, aber was sollte das bringen? Wie immer war seine Firma wichtiger als seine Familie. Da knallte er mir ein paar Andeutungen hin, mit denen ich nichts anfangen konnte, und verschwand. Das war so typisch mein Vater, doch wenn er sich einbildete, ich würde brav hier sitzen und auf seine Heimkehr warten, dann hatte er sich geschnitten.
Destiny Arizona
Unerwartetes Treffen
Gehetzt rannte ich hin und her und passte auf, dass keiner etwas vergaß.
»Vergiss deine Lunchbox nicht, Savannah.« Die Kids waren mittlerweile wirklich spät dran, aber jeder schien noch etwas vergessen zu haben. Chaos gab es hier ja jeden Morgen, jedoch heute erschien es mir besonders schlimm.
»Georgia, dein Matheheft liegt dort auf dem Sofa.« Während ich das letzte Brot schmierte, versuchte ich, alles im Blick zu behalten. Ich schloss die Brotdose und steckte sie in Dakis Tasche.
»Los, Dakota, der Bus wartet nicht.« Obwohl ich momentan eigentlich weniger Stress haben müsste als in der letzten Woche, weil ich ja schulfrei hatte, war ich kurz vorm Durchdrehen. Wenn ein Tag schon so hektisch anfing, konnte er doch nur in einer Katastrophe enden, oder?
Schließlich waren alle Kinder aus dem Haus und auf dem Weg zum Schulbus. Ich selbst würde von hier aus auch gleich den Bus nehmen, um Mom im Krankenhaus zu besuchen. Seit ihrer Einweisung hatte ich nur einige Male mit ihr telefonieren können, und jetzt wollte ich mich endlich selbst von ihrem Zustand überzeugen. Da die Stiftung den Aufenthalt bezahlte, lag meine Mutter dieses Mal nicht in der Klinik um die Ecke, sondern in einer Privatklinik in einem der vornehmen Bezirke von Miami. Am Telefon hatte sie mir von der tollen Aussicht vorgeschwärmt. Sie konnte von ihrem Bett aus direkt aufs Meer blicken. Und das freute sie umso mehr, da sie das Wasser so liebte und ich freute mich über alles, was sie glücklich machte..
Mit dem Bus war es gar nicht so einfach, zu dem Krankenhaus zu kommen. Viermal musste ich umsteigen, und am Ende war ich fast zwei Stunden unterwegs. Trotzdem machte es mir nichts aus, denn als ich die Haltestelle erreichte und den Bus verließ, wusste ich, wovon Mom gesprochen hatte. Der Ozean lag tatsächlich unmittelbar vor dem Klinikum, und alles hier war so sauber und gepflegt. Kein Müll, keine Landstreicher und sicher auch keine Junkies, die sich hier ihre Spritze in aller Öffentlichkeit setzten, wie ich es am Strand bei uns so oft gesehen hatte. Einer der Gründe, warum niemand von uns allein dorthin ging.
Am liebsten hätte ich noch ewig hier gestanden und die Menschen beobachtet, die in der Sonne lagen, mit ihren Kindern spielten oder zum Schwimmen ins Wasser liefen. Doch dafür war jetzt wirklich keine Zeit. Deshalb riss ich mich von dem Anblick los und betrat schnell die imposante Eingangshalle des Krankenhauses. Da angekommen, fragte ich den Pförtner, wo ich meine Mutter finden konnte.
Er erklärte mir den Weg genau, gab aber zu bedenken, dass ich wahrscheinlich nicht so einfach zu ihr durfte, da sie auf einer besonderen Station lag. Dort musste ich erst klingeln und dann warten, bis das Personal für mich Zeit hatte. Dennoch schreckte es mich nicht ab, ich hatte schon im Bus fleißig gelernt und würde damit inzwischen einfach weitermachen, bis ich zu Mom durfte. Die Kleinen waren in der Schule gut aufgehoben und würden hinterher ins ›Hope‹ gehen, falls ich sie nicht vom Bus abholen konnte. Also setzte ich mich brav auf einen der Besucherstühle neben der Tür und vertiefte mich in meine Lektüre, die ich für den Englischunterricht lesen musste. Die Schwester an der Sprechanlage hatte um Geduld gebeten, da es gerade einen Notfall auf der Station gab. Bevor ich mir Sorgen machen konnte, dass dieser meine Mutter betraf, betonte sie aber gleich, dass es nicht bei ihr war.
Nach einiger Zeit öffnete sich die Tür, und ich wollte schon aufspringen, als ich bemerkte, dass es keine Krankenschwester war, die dort herauskam, sondern Kennedy und sein Vater. Was machten die denn hier?
»Du bleibst hier, während ich mit dem Arzt spreche. Wage es nicht, das Gebäude zu verlassen. Haben wir uns verstanden, Dean?« Wie sprach Kennedy Senior nur mit seinem Sohn, und das vor mir? Wobei ich das Gefühl hatte, dass weder er noch Dean mich bisher wahrgenommen hatten.
»Ich warte hier, weil ich noch einmal zu Mom will, und nicht, weil du es sagst. Bilde dir bloß nichts ein.« Dean schien reichlich angefressen zu sein. Zugegeben, das konnte ich irgendwie sogar verstehen, so wie sein Vater ihn behandelte. Was seine Mutter wohl hatte? Hoffentlich nicht auch Krebs. Diese Scheißkrankheit wünschte ich wirklich niemandem. Kennedy Senior ging davon, währenddessen drehte Dean sich zu den Besucherstühlen und somit zu mir um.
»Was machst du denn hier?« Er ballte seine Hände zu Fäusten und kam näher und näher auf mich zu. Da ich saß und er stand, fühlte ich mich ihm völlig unterlegen. Aber er würde mir doch nichts tun, oder? Hundertprozentig sicher war ich mir dessen nicht. »Raus jetzt mit der Sprache. Warum bist du hier? Du wirst nicht auf die Station kommen, dafür werde ich sorgen.« Nun reichte es mir, ich schubste ihn etwas zurück und stand auf. Angriff war die beste Verteidigung. Ich war zwar auch im Stehen immer noch bedeutend kleiner als er, doch ich kochte vor Wut.
»Was stimmt nicht mit dir, du eingebildeter Fatzke? Ich will meine Mutter besuchen und niemanden ausspionieren. Du hast wohl zu viele schlechte Filme gesehen?« Nun lachte er tatsächlich. Was bitte schön war daran jetzt lustig? Ich musste mich wirklich zusammenreißen, um ihm nicht gegen das Schienbein oder lieber noch etwas höher zu treten.
»Als könnt ihr euch diese Klinik leisten. Das hier ist die Isolierstation einer teuren Privatklinik und nichts für Pack aus dem Trailerpark.« Mit diesem Satz übertrat er die Grenze des Erträglichen endgültig. Ohne groß darüber nachzudenken, hob ich die Hand, um ihn zu ohrfeigen, leider fing er sie ab und hielt sie schmerzhaft fest.
»Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zu Gewalt? Das ist ja wieder typisch für Leute wie dich.«