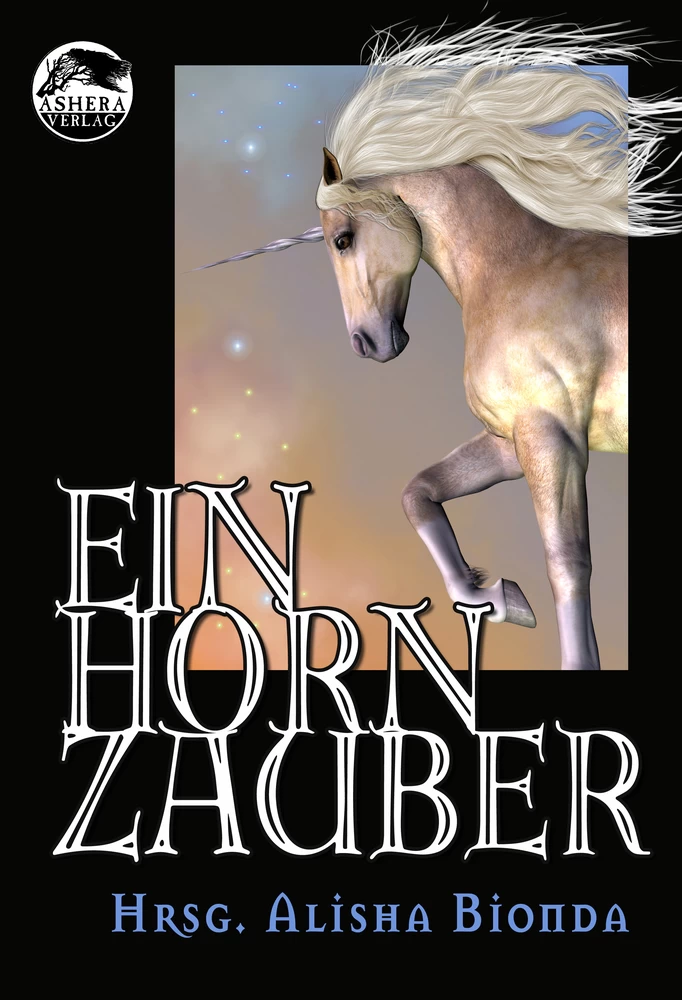Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
KUPFERHAARS DRACHE
Tanja Bern
Das Brüllen hallte durch das Tal. Verzweiflung überspülte die Wälder und Hügel von Drahgor. Claire blickte erschrocken auf. Für einen Augenblick war sie wie gelähmt. Der Wind trug Wortfetzen zu ihr hinüber und sie konnte kaum glauben, was die Luft ihr zuflüsterte.
Claire ließ den Korb mit den gesammelten Beeren fallen, lief den Hang hinauf. Sie verbarg sich hinter einigen Sträuchern und schaute bestürzt auf das Geschehen.
Sechs Männer umringten einen Drachen. Sein schlanker Körper überragte die Menschen bei Weitem, trotzdem hatten sie das Tier in ihren Fängen. Netze waren über ihn geworfen, Speere steckten in seinem Leib und sie prügelten auf ihn ein.
Claire schlug vor Schreck die Hand vor das Gesicht. Wie konnten sie diesem wertvollen Tier das antun? Drachen waren heilig!
Sie erkannte mit Bitterkeit, dass sie ihre Ansichten nur mit wenigen Menschen teilte.
Der Drache gab auf. Der Glanz seiner bernsteinfarbenen Schuppen erstarb und er ließ erschöpft den Kopf sinken.
Hass loderte in Claire auf, denn die Männer lachten und piesackten das Tier, das sich ihnen längst ergeben hatte. Sie jagten den Drachen vor sich her. Dieser konnte sich durch die engmaschigen Netze kaum bewegen und stolperte die Wiese entlang. Ein leiser Laut des Schmerzes drang aus seinem Maul, dann ergab er sich endgültig in sein Schicksal.
Hilflos musste Claire mit ansehen, wie die Männer den Drachen fortbrachten. Wo würden sie das Tier hinbringen?
Claire ahnte es. Nur einer konnte so grausam sein: Lord Fahlorn. Aber was wollte er mit einem Drachen?
Das Mädchen musste sichergehen und lief zum Kampfplatz hinunter. Schimmerndes Blut war in dem Gras zu sehen. Die Männer trieben den Drachen wirklich Richtung Burg Fahlorn.
Ein leiser Laut erklang aus einem Gestrüpp – wie das ängstliche Miauen einer Katze.
Claire hielt inne.
Was war das?
Wieder drang der gedämpfte Ton aus den Gebüschen. Vorsichtig näherte sich Claire und traute ihren Augen kaum. Zwei leuchtende Augen blickten sie voller Angst an. Der Körper schien wie getarnt in dem Grün der Sträucher.
»Oh nein!«, hauchte sie, fiel auf die Knie und streckte die Hand aus. »Komm her, Kleines.«
Das Tier wich zurück, doch Claire war geduldig. Fast eine halbe Stunde verharrte sie still und sprach mit ihm. Endlich kam es aus seinem Versteck.
Es war ein Drachenjunges.
Die Schuppen des Kleinen waren braunschwarz gefleckt und matt, damit es in seinen Schlupfwinkeln wie unsichtbar blieb. Claire sah, dass es noch sehr jung sein musste, auch wenn es schon die Größe eines Schäferhundes besaß.
»Oh gütige Mutter, was mache ich nur mit dir?«, flüsterte sie.
Wieder gab es diesen kläglichen Laut von sich, der Claire zu Tränen rührte. Kurzerhand nahm sie das Jungtier auf den Arm und ächzte aufgrund des Gewichtes. Der kleine Drache schmiegte sich an sie, als würde er genau spüren, dass Claire ihm helfen wollte. Seinen Korb ließ das Mädchen zurück, es würde sich später darum kümmern.
So schnell sie konnte, lief Claire zurück nach Hause. Das kleine Gehöft war bald in Sicht, weil sie sich nicht weit entfernt hatte. Sie wunderte sich, dass ein Drache so nah ans Dorf gekommen war. Denn auch wenn sie abseits wohnten, so konnte man von hier die ersten Giebeldächer von Asliaf sehen.
Claire näherte sich dem Haus und durchquerte den Garten, der überwuchert mit Kräutern und blühenden Wildblumen war. Der Geruch nach frischem Holz überlagerte den Duft des Grüns. Ihre Mutter schien Holz gehackt zu haben.
Claire stieß mit dem Fuß die Tür auf. »Mutter?«
Lucille kam aus der Küche in die Wohnstube. Ihr Haar war ein wenig aus dem Knoten gerutscht und ringelte sich wie zierliche schwarze Schlangen um ihr Gesicht. Sie trocknete sich die Hände an der Schürze ab und wollte etwas erwidern, als sie ihre Tochter genauer ansah. Für einen Augenblick wirkte sie völlig verblüfft.
»Gütige Mutter!«, entfuhr es ihr dann.
Claire schmerzte mittlerweile der Arm und sie setzte das Drachenjunge auf den Boden. Sorgfältig schloss sie die Tür. Das Kleine schmiegte sich Schutz suchend an ihr Bein.
»Man hat seine Mutter eingefangen!«
»Woher weißt du das, Claire?!«
»Weil ich’s gesehen habe!«
»Was ist passiert, Mädchen?« Lucille beugte sich herunter und streckte dem Drachen die Hand hin. Zaghaft schnupperte er daran.
Claire erzählte ausführlich von dem, was sie gesehen hatte. Sie konnte ihren Zorn darüber kaum zügeln.
Ihre Mutter hörte es sich schweigend an und schüttelte den Kopf. »Dann beginnt es wieder«, sagte sie. Kummer zeichnete sich auf ihren schönen Gesichtszügen ab.
Claire verstand nicht. »Es … beginnt wieder? Mutter, was meinst du damit?«
Lucille schüttelte den Kopf. »Es ist vielleicht besser, wenn du es nicht weißt.«
Claire presste die Lippen aufeinander. Sie kannte ihre Mutter. Das war ihr letztes Wort.
»Hol Milch von den Ziegen. Es ist schwach, aber vielleicht können wir das Kleine am Leben erhalten.«
Claire gehorchte, war froh, dass ihre Mutter bereit war, zu helfen und lief um den Hof herum, stieß das Gatter der Ziegen auf. Sie gurrte ihnen beruhigende Worte zu und die Tiere begrüßten Claire freudig. Rasch kniete sie sich hin, stellte einen Eimer unter eines der Muttertiere und molk etwas Milch ab.
Danach erhob sich Claire wieder und fuhr der Ziege durch das Fell. »Danke, Irra. Die gütige Mutter wird es dir vergelten.«
Lucille hatte bereits die alte Behelfsflasche hervorgeholt, die sie für die kleine Marri gebraucht hatten. Die Mutterziege war bei der Geburt gestorben und sie hatten das Kleine mühsam von Hand aufgezogen. Jetzt kam ihnen die Milchflasche zugute, obwohl sie ein wenig zu klein war.
Claire schüttete die Milch vorsichtig um. Das Drachenjunge quäkte kläglich.
»Ist ja gut«, sagte Lucille mit gedämpfter Stimme. »Wir helfen dir ja.«
Claire sah zu, wie ihre Mutter das Tier gekonnt dazu brachte, aus der Flasche zu trinken. Sie senkte den Kopf und dachte an das Drachenweibchen. Es war so unglaublich schön und edel, aber auch wild gewesen! Was wollte Fahlorn nur mit ihr?
»Mama?«
»Hm?«
»Ich gehe auf die Burg.«
Lucille blickte auf. »Was glaubst du, dort erreichen zu können?«
Claire schöpfte nach Atem. »Ich schleuse mich ein und vielleicht … vielleicht kann ich den Drachen befreien!«
»Das sind Mädchenträume! Halte dich fern von Fahlorn!«
Claire nickte betrübt. Sie wusste, dass sie sich ihrer Mutter widersetzen würde.

Spät in der Nacht, als Lucille fest in ihren Träumen versunken war, schlich sich Claire aus dem Haus. Der Jungdrache lag einsam und zusammengerollt in der Nähe des Feuers und gab leise Klagelaute von sich.
»Ich bringe dir deine Mutter zurück!«, wisperte Claire und huschte aus dem Haus.
Es war kalt draußen. Die Dunkelheit griff mit klammen Fingern nach ihr und schien sie verschlingen zu wollen. Claire ließ sich trotzdem nicht abhalten, ging durch den Garten und schaute auf das Sternenmeer, das sich wie ein funkelnder Teppich über ihr ausbreitete. In der Ferne sah sie vereinzelte Lichter aufleuchten. Nicht alle in Asliaf schliefen. Sie wusste, dass das Leben in den Wirts- und Hurenhäusern erst in der Nacht erwachte und ihr den Weg zeigen würde.
Claire ging auf die Schutzpalisade zu und der Wächter blickte sie verwundert an.
»Was läufst’n mitten in der Nacht hier herum?«, fragte er sie.
»Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Darf ich passieren?«
Der Mann näherte sich und Claire sah ängstlich in seine scharfen Vogelaugen.
»Bist ein bisschen jung, oder?«
»Ich bin fast zwanzig Sommer.«
Der Wächter brummte einige Worte und winkte sie durch. Die Häuserreihen ragten wie Riesen vor ihr auf. Sie nannten es Dorf, doch für Claire war Asliaf schon fast eine kleine Stadt. Die Häuser hier waren zweistöckig und schmiegten sich eng zusammen. Eine breite Straße, die tagsüber hauptsächlich von Fuhrwerken benutzt wurde, verlief quer hindurch, direkt zur Burg. Überall zweigten enge Gassen ab, in die Claire kaum hineinsehen konnte. Sie hüllte sich in ihren Mantel, zog die Kapuze über und machte sich rasch auf zur Burg.
Es dämmerte bereits, als sie der Festung näher kam. Ihr Herz blieb fast stehen, als sie einen lang gezogenen Schrei hörte, der wie der heisere Ruf eines Geistes über der Stadt schwebte.
Der Drache!
Dies fachte ihren Mut an!
Claire trat in den Burghof und sah sich um. Die ersten Knechte waren schon beschäftigt. Pferde wurden versorgt und aus den Ställen geführt, Wasser aus den Brunnen geschöpft. Und eine Mutter zog einen Jungen leise schimpfend am Ohr hinter sich her.
Claire verzog das Gesicht. Einmal hatte ihre Mutter ihr eine ähnliche Bestrafung angedeihen lassen. Ihr hatte das Ohr noch Tage später geschmerzt.
Ihr Blick fiel auf einen jungen Mann, der auf einem Mauervorsprung saß und seinen Esel sanft an der Stirn kraulte. Das Tier schmiegte sich in die Berührung. Einige Säcke waren neben dem Esel abgelegt und warteten wohl darauf abtransportiert zu werden.
Claire ging auf den Jungen zu. »Weißt du, ob ich hier Arbeit finden kann?«
Er hob den Kopf und begutachtete sie einen Moment. »Seitdem sie gestern den Drachen gebracht haben, bestimmt«, murrte er und konzentrierte sich wieder auf seinen Esel.
Claire gab sich ahnungslos. »Einen Drachen? Was wollen sie denn mit dem machen?«
»Er soll wohl ausgestellt werden – wie die anderen.«
Die anderen? »Ähm … ausgestellt?«
Der junge Mann schien ein wenig genervt zu sein. »Bist du eine der Schaulustigen?«
Claire schüttelte den Kopf.
»Weißt du nichts von den Kuriositäten in Fahlorns Verlies?«
Claire war so verblüfft, dass sie ihn sprachlos anstarrte.
Der Eselsführer lachte. »Komm setz dich, Mädel. Ich bin Jahson.«
Claire sah sich unsicher um. Konnte sie sich einfach zu ihm setzen? Andererseits war der Burghof belebt und der Mann schien kaum älter, als sie zu sein. Schließlich gab sie nach und ließ sich neben ihm nieder.
»Erzähl mir davon«, bat sie.
Jahson seufzte. »Du warst noch nie auf der Burg, oder?«
»Nein, ich bin nur manchmal in Asliaf auf dem Markt«, antwortete sie.
»Na ja, das ist auch hauptsächlich was für die hohe Gesellschaft – die Lords. Sie bezahlen gut, um Fahlorns Kuriositäten, wie er es nennt, sehen zu können.«
»Was ist noch da unten?«, wollte Claire ein wenig atemlos wissen. Was enthüllte sich hier nur? Warum hatte ihre Mutter nie davon gesprochen?
Jahson schnaubte. »Seh‘ ich aus wie’n Lord? Da kommt man nicht einfach rein. Es sei denn, du bist einer, der die Vorräte nach unten bringt.«
»Das wäre doch mal eine interessante Aufgabe!«
Lag hier ihre Chance?
»Mädchen, du kommst sicher nicht da hinein. Nur sehr ausgewählte Diener dürfen diese Arbeit verrichten.«
»Woher weißt du das alles, Jahson?«
»Bin hier geboren, ich kenn nix Anderes.«
»Danke für deine Auskünfte. Vielleicht sieht man sich ja hier in der Burg.«
Jahson nickte und fuhr fort seinen Esel zu streicheln.

Claire suchte fast zwei Stunden den Mann, der dafür zuständig war, den Leuten Arbeit zu vermitteln – sie brauchte einen Vorwand, um hierzubleiben. Nun stand sie mit Herzklopfen vor einem dicken Kerl, der sie an eine Kröte erinnerte, die darauf wartete, dass eine Fliege ihr zu nah kam. Sein verschwitztes Gesicht war rot gefleckt und er musterte Claire wie ein Stück Fleisch.
»Kannst in der Küche arbeiten. Meld dich bei Orlinda und sach du kommst von Joph.«
»Vielen Dank, guter Herr!«
Claire wagte nicht, ihn nach dem Weg in die Küche zu fragen, sondern erkundigte sich lieber bei einem Dienstmädchen, das ihr bereitwillig den Weg wies. Wenig später stand sie vor einer unglaublich dicken Frau, die derbe Befehle durch die Burgküche schrie.
»So, Joph schickt dich. Wurde auch Zeit! Hilf Betty beim Abwasch und füll dann das Wasser in den Krügen dort auf.«
Claire fügte sich und ging zu der jungen Frau, die Berge von Geschirr spülte. Betty antwortete nicht auf ihre Begrüßung, sondern ging in Gedanken versunken ihrer Arbeit nach. Mehrmals bemühte sich Claire um ein Gespräch, doch Betty blieb in sich zurückgezogen. Claire gab es auf, einen Kontakt zu knüpfen.
Der Tag verging ohne weitere Vorkommnisse. Sie arbeitete für Orlinda und ging spät abends in ihre Kammer, die man ihr zugewiesen hatte. Mehr als ein Strohbett war nicht vorhanden, aber sie hatte nicht vor, länger als nötig zu bleiben, deshalb störte sie sich nicht daran. Einen Augenblick verharrte sie erschöpft auf der Schlafstatt, dachte daran, was ihre Mutter wohl denken mochte. Würde sie nach ihr suchen?
Das Drachenweibchen begann mit seinen traurigen Rufen. Claires Blick verschleierte sich vor Tränen. Weinen nützt hier nichts!, schalt sie sich und raffte sich auf.
Sie spähte hinaus. Langsam verebbte das Treiben in der Burg. Claire wartete trotzdem noch eine Weile, bis sie ihr Zimmer verließ. Draußen brannten bereits die Fackeln und der Innenhof war schwach erleuchtet. Sie presste sich an die Wand, als zwei Männer, in ein Gespräch vertieft, näher kamen.
»Wenn der Drache nicht aufhört, nachts dieses Spektakel zu veranstalten, dann weiß ich auch nicht. Er will nicht fressen und hat sich schon die Beine wund gescheuert, weil er sie ständig an den Gittern reibt.«
»Wie der Elb damals«, sagte der Ältere. »Mann, der hat jahrelang versucht zu entkommen.«
Der Elb? Claire krauste verwundert die Stirn. Sie hatte gedacht, dieses Volk gäbe es in Drahgor nicht mehr! Und hier in den Verliesen war einer gefangen?
Claire sah ihre Chance und folgte den beiden. Sie war schon immer gut darin gewesen, unsichtbar zu sein, trotz ihrer kupferroten Haare, die sie meist zu einem Zopf geflochten trug. Die Diener – Claire vermutete, dass es welche waren – liefen in einen abgetrennten Bereich der Burg. Sie ging ihnen lautlos hinterher. Wenig später verließ der Ältere seinen Gefährten und wandte sich ins Innere der Festung, wohingegen der Andere ein Schlüsselbund hervorzog und ein Gitter aufschloss. Claire fluchte innerlich, doch der Mann zog es nur hinter sich zu, verschloss es nicht. Sie sah sich wachsam um, niemand war sonst in der Nähe, also schlüpfte sie durch die Öffnung und ging eine steinerne Treppe hinab. Die Geräusche des Drachen wurden lauter. Claire hörte den Diener leise schimpfen. Sie verbarg sich in einer dunklen Ecke und wartete. Der Mann verließ mit leisen Verwünschungen den Ort und zog das Gitter hinter sich zu, schloss sorgfältig ab.
Claire war gefangen!
Allerdings war sie jetzt dort, wo sie sein wollte. Langsam schlich sie die Treppe bis zum Ende hinunter. Vor ihr öffnete sich ein hoher Raum. Rechts war ein dunkler Bereich, den sie kaum durchblicken konnte. Links war der Drache in sein karges Gefängnis eingepfercht. Das Tier wandte sich ihr zu und starrte sie mit leerem Blick an.
Claire hatte keine Furcht und lief zum Gitter. »Ich werde dir helfen!«
Der Drache fuhr fort, leise zu weinen.
»Hörst du, Drache? Ich versuche, dir zu helfen. Ich habe dein Junges gefunden!«
Doch das so stolze Tier schien gebrochen und reagierte kaum.
Hinter ihr erklang eine melodische Stimme. Erschrocken fuhr Claire zurück und drehte sich in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Aus dem Dunkel sagte jemand etwas in einer ihr fremden Sprache. Diese klang wie der Wind, der in den Baumkronen rauschte – fühlte sich an, wie warmer Regen, der karges Land benetzt.
»Wer ist da?«, wisperte sie. Ihr Herz schien aus dem Takt geraten zu sein. War es der Elb?
Der Drache regte sich, richtete sich auf und kam nah an das Gitter. Nun waren seine Sinne wieder geweckt und er schien aufgeregt zu sein.
Claire war hin- und hergerissen. Worauf sollte sie ihre Aufmerksamkeit richten? Vorsichtshalber ging sie in die Mitte des Raumes und nahm von beiden Verliesen Abstand.
Die Stimme verstummte und ein heller Schemen trat an das rechte Gitter. Claire konnte ihn nicht richtig erkennen, nahm die Fackel, die sich in der Nähe des Drachen befand, und entzündete damit die anderen, die erloschen an den Wänden hingen.
Der Anblick des Mannes, den sie dann hinter den Gittern sehen konnte, raubte ihr den Atem. Er war in ein leuchtendes Gewand gehüllt, was an einigen Stellen durchlässig und schmutzig war. Sein weißes Haar floss wie Seide um seine Schultern, obwohl sie sah, dass es leicht verknotet war. Die Augen schimmerten wie aus Moos und sein Gesicht war makellos schön, bis auf eine Narbe, die sich quer über seine rechte Wange zog. Zwischen dem glatten Haar konnte sie deutlich die spitze Ohrenform erkennen, die dieses einstmals so mächtige Volk kennzeichnete.
»Ich habe dem Drachen übersetzt, was du gesagt hast. Er versteht die Menschensprache nicht«, erklärte er ruhig.
Claire fuhr ein Schauer über die Haut. Seine Stimme berührte sie in jeder Faser ihrer Seele.
»Wer bist du?«, hauchte sie.
»Mahyr de Leef – Prinz des Eichenvolkes.«
Claire war entsetzt. Hielt man dieses wunderschöne Geschöpf hier wirklich gefangen, um …
Mahyr seufzte. »Ich bin eine der Kuriositäten, die Fahlorn ausstellt. Der Zwerg und die Nymphe sind längst gestorben. Ich war der Letzte und brachte viel zu wenig Geld ein. Bis man vorgestern Lyssa herbrachte.«
»Lyssa? Ist das ihr Name?«
Mahyr nickte. Also konnten Elben wirklich, wie in den Legenden erzählt wurde, mit Tieren kommunizieren!
»Wie lange?« Mehr brachte Claire nicht heraus.
Mahyr blickte sich um. Sie sah, dass er Zeichen in die Wände geritzt hatte. Zählte er so die Jahre?
»Fast sieben Jahre. Vor vier Sommern habe ich aufgegeben, entkommen zu wollen.« Er sprach nüchtern, ohne Gefühl, doch sein Schmerz zeichnete sich in seinen Gesichtszügen ab.
Claire näherte sich ihm. Er war fast einen Kopf größer als sie und sah mit sanftem Blick auf sie hinab.
»Ich wusste, dass du kommst«, sagte er mit gesenkter Stimme. »Ich habe von dir geträumt.«
»Von mir?«
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. »Der Drache war das Zeichen. Ich wusste, dass dann das kleine Mädchen mit den Kupferlocken kommt und mir vielleicht Erlösung schenkt.«
»So klein bin ich nicht«, setzte sie dagegen.
»Tatsächlich bist du sicher zehn Jahre älter, als ich erwartet hatte.« Er holte tief Luft. »Und deshalb könnte es dir wirklich gelingen.« Hoffnung glomm in seinem Blick auf.
»Wieso kannst du von mir träumen?«
Er zuckte mit den Schultern. »Es ist so. Elben verfügen über diese Gabe.«
Mahyr ließ sich an dem Gitter heruntergleiten und setzte sich auf den Steinboden. Claire tat es ihm nach. Nun war sie so dicht bei ihm, dass sie weitere kleine Narben in seiner feinen Haut sehen konnte. So nah, dass sie seinen betörenden Geruch wahrnahm, der dem Kerkerdasein trotzte.
»Erzähl mir von dir«, bat er.
»Wird denn keiner kommen?«
»Nicht vor morgen früh. Aber wenn Hildar kommt, musst du versuchen, ihn zu überwältigen, um an den Schlüssel zu gelangen – für uns beide.« Mahyr deutete auf den Drachen. »Sie ist eines der letzten Muttertiere.«
»So ähnlich sieht wohl auch mein Plan aus«, sagte Claire und krauste über ihr verwegenes Vorhaben die Stirn.

Die halbe Nacht sprach sie mit dem Elben. Niemals zuvor hatte sie einen solchen Mann kennengelernt. Sein Blick brannte sich in ihr Herz, sein leises Lachen rührte etwas in ihrem Innern, seine Stimme war weich wie Samt und sie würde am liebsten nie wieder eine andere hören.
Der Drache hatte seine Klage aufgegeben und harrte nervös in seinem Verlies aus. Als die Sonne ihre ersten Strahlen durch ein Gitter in der Decke schickte, hörten sie einen Schlüssel klirren.
In der Nacht hatte Mahyr erzählt, dass sie ihm zutiefst misstrauten, nie nah an die Gitter kamen, sondern sein Essen mit einem Stab durch eine Vorrichtung schoben. Diese Stange musste Claire dem Mann abnehmen und ihn möglichst zu Mahyr an die Gitter drängen.
Claire presste sich an die Wand und wartete mit Herzklopfen auf Hildar, den Diener. Mahyr gab ihr ein Zeichen und sie stellte dem Mann ein Bein, sodass er samt des Essenstabletts nach vorn kippte. Rasch entwand sie ihm den Stab. Hildar war schneller, als sie angenommen hatte. Er rappelte sich auf, erholte sich blitzschnell von dem Überfall und griff nach dem Stecken. Claire schrie leise auf, trat nach ihm, doch er versetzte ihr eine Ohrfeige, sodass sie hart gegen das Drachenverlies stieß. Für einen Augenblick konnte sie nicht atmen. Sie sah, wie der Mann flüchten wollte.
»Feigling!«, schrie sie ihm hinterher.
Hildar stockte. Mit wütendem Gesicht sah er sich zu ihr um. Mit wenigen Schritten war er zurück.
»Du dummes Gör!« Er hob den Stock, um sie zu schlagen. Das Holz fuhr mit voller Wucht gegen ihren Arm und sie keuchte auf. Doch Mahyrs Blick war zu tief in ihre Gedanken gedrungen, um jetzt aufzugeben. Sie klammerte sich an den Stab, nahm alles an Kraft zusammen, was sie aufbringen konnte und stieß den Mann gegen das Verlies des Elben.
Danach ging alles rasend schnell. Der Elb umfasste durch die Gitter den Kopf des Mannes und drehte ihn mit einem Ruck herum. Es ertönte ein Knacken, als das Genick brach; Hildar stürzte mit einem schabenden Geräusch zu Boden.
Geschockt starrte Claire auf die Leiche. »Du hast …«
»Es tut mir leid, Claire, ich durfte nicht zögern. Glaub mir, dieser Mann ist boshaft von jeher. Er hat mich all die Jahre gequält.«
»Aber … er ist tot.« Übelkeit stieg in ihr auf.
»Ja, sie wussten, warum sie mir nie zu nah kamen. – Claire, die Schlüssel. Bitte! Mein Vater wird dich reich belohnen, denn du wirst mich retten! Das wirst du doch, oder?«
Claire nickte, nahm den Schlüssel an sich und befreite den Elben. Mahyr schloss kurz die Augen, dann trat er aus seinem Gefängnis. Er nahm den Schlüsselbund an sich und öffnete das große Tor des Drachenkäfigs. Er hatte Claire erzählt, dass Arbeiter fast zwei Jahre daran gebaut hatten.
»Wie sollen wir mit ihr entkommen?«, fragte Claire unsicher.
Mahyr lächelte. »Ist Lyssa in der Mitte des Verlieses, fern der Gitter, versagt der Zauber, der sie hier hält.«
»Der Zauber?«
»Kleines Kupferhaar … du weißt nicht viel von der Welt, nicht wahr?«
»Ich bin nicht klein.«
»Nein, das bist du nicht.« Seine Hand strich über ihre Wange. »Halte dich an den Auswüchsen des Halses fest, wenn sie sich zu uns beugt.« Mahyr wechselte die Sprache und redete zu dem Drachenweibchen.
Das große Tier duckte sich, kam langsam aus dem Kerker. Es krümmte sich so, dass der Elb und Claire auf seinen Rücken klettern konnten. Sie wusste kaum, wie ihr geschah. Mahyr leitete sie an. Eile war geboten, denn draußen wurden bereits Stimmen laut. Hatte man bemerkt, dass etwas nicht stimmte?
»Halte dich gut fest«, flüsterte er ihr zu und bog seinen Körper schützend über sie.
Der Drache brüllte und stieß sich vom Boden ab. Die Decke brach unter seiner Kraft und er kämpfte sich frei. Claire spürte nichts, nur Mahyr, der sie unerschütterlich festhielt. Er schien sie mit einer Kraft zu umgeben, die nichts durchdringen konnte. Dann erhob sich Lyssa in die Luft. Das Geschrei der Menschen in der Burg drang zu Claire durch. Sie sah, dass ein Teil des Wehrbaus zerstört war. Mahyr war verletzt und blutete leicht, aber er lachte. Die Flügel des Drachen zerteilten kraftvoll die Luft.
»Wo ist dein Zuhause?«, rief Mahyr gegen den Wind an.
»Östlich des Dorfes«, antwortete sie.
Mahyr sagte dem Drachen, wo sein Junges war, und das Tier flog eine Schleife. Die Landschaft raste unter Claire vorbei und das Mädchen schmiegte sich an den Elbenprinzen.
»Nimm mich mit zu deinem Volk!«, bat sie plötzlich voller Sehnsucht.
»Das war von jeher dein Schicksal, kleines Kupferhaar.« Mahyr lächelte und Claire wusste, dass er recht hatte. Sie spürte es tief in ihrem Innern.

Guido Krain
www.guido.krain.de
Guido Krain wurde 1970 in Köln geboren, wuchs dann aber in Hamburg auf. Nach dem Abitur studierte er Biologie, Japanologie und Medienkultur in Bochum und Hamburg und stieg dann mit einem Volontariat beim Hamburger Magazin-Verlag ins Berufsleben ein. Seither verdiente er seine Brötchen mit den Früchten seiner Tastatur. Guido Krain arbeitete als Online-Redakteur bei einem New-Media-Unternehmen, leitete eine Materndienstredaktion und veröffentlichte Computer-Fachbücher bei einem bekannten Verlag. Im Sommer 2000 gründete er die Autoreninitiative »Fantasy-Buch.de« und hat hier mehrere Bücher produziert. Mittlerweile arbeitet er als freier Autor und Journalist.
INDIGO
Guido Krain
Schicksal mein Freund? Schicksal ist etwas, über das man erst reden sollte, wenn man weiß, wovon man spricht. Wenn dir dein Schicksal begegnet, spürst du, wie die Welt dir entgleitet. Nichts wird danach je wieder so sein wie zuvor. Und du selbst ... du selbst wirst für immer etwas verloren haben, um etwas bekommen zu können. Du wirst ein Anderer sein. Wenn dir dein Schicksal begegnet, wird ein Teil von dir sterben. Und nur wenn du Glück hast, wird ein anderer Teil geboren werden.
Mir begegnete das Schicksal erst in mittleren Jahren. Voller Stolz und Ehrgeiz war ich damals. Ich führte das Wappen eines Siegelträgers, eines Ritters der Königin, auf meiner Brust und fühlte mich weit über die einfachen Bürger meines Landes erhaben. Ich verkündete das Wort meiner Herrin mit der Überzeugung eines Priesters, der die Gebote seiner Göttin verliest. Für mich war es vollkommen undenkbar, dass sich jemand oder etwas dem Willen der Krone widersetzen könne. Wenn die Königin es wollte, würden selbst die Flüsse stromaufwärts fließen und die Bienen Milch geben. Und ich, als einer ihrer Siegelträger, verkündete dem Land ihren Willen.
Meine Pflicht führte mich häufig allein durch einsame Landstriche. So auch an einem Herbstabend vor etwa zehn Jahren. Auf dem Weg von Yerakin nach Nabucco war ich den Tag über in der südlichen Ebene von Elstermoor unterwegs gewesen und stellte fest, dass ich mich offenbar erheblich in meiner Etappenplanung verschätzt hatte. In spätestens einer Stunde würde die Dämmerung einsetzen. Doch bis zu meinem heutigen Ziel, einem unbedeutenden Dorf mit dem lyrischen Namen „Wispersee”, würden noch beinahe vier Stunden Weg vor mir liegen. Eine unerfreuliche Situation. Besonders, weil ich ausdrücklich vor den aggressiven Wölfen in dieser Region gewarnt worden war. Doch wenn ich ehrlich bin, schreckte mich die Aussicht auf ein unbequemes Lager im Freien noch weit mehr als wilde Tiere. Vielleicht glaubte ich damals wirklich, dass es kein Wolf wagen würde, einen Siegelträger der Königin zu belästigen.
Ein Blick auf die Karte ließ mich neue Hoffnung schöpfen. Aus unerfindlichem Grund machte der gut ausgebaute Handelsweg einen weiten Bogen um den vor mir aufragenden Schattenlichterwald. Der pathetische Name ließ mich den Grund hierfür schon erahnen. Aberglaube war gerade bei der Landbevölkerung ein weitverbreitetes Übel. Direkt auf der anderen Seite des Waldes, keine Viertelkette entfernt, sollte nach der Karte Wispersee liegen. Selbst in dichtem Wald würde diese Strecke wohl in gut einer Stunde zu bewältigen sein. Zugegeben, der Forst machte selbst bei hellem Tageslicht einen düsteren und bedrohlichen Eindruck. Dafür aber fast eine halbe Tagesreise Umweg in Kauf zu nehmen, schien mir etwas übertrieben. Abergläubische Menschen mussten offenbar gutes Schuhwerk besitzen.
Selbstsicher lenkte ich meinen Rappen von der Straße und ritt hoch aufgerichtet in den offenbar so gefürchteten Wald hinein. Keine zwei Meter waren mein treues Ross und ich in das düstere Bäumemeer eingetaucht, als ich auch schon spürte, wie meine vertraute Welt hinter mir zurückblieb, als hätten wir eine unsichtbare Grenze überschritten, an der die Wirklichkeit aufhört und der Aberglaube jede Lächerlichkeit verliert. Gewaltige dunkle Stämme umringten uns, schienen uns zu beobachten und mit ihrer gespenstischen Gegenwart in einer unerklärlichen Weise zu berühren. Fast schwarz waren sie und ihre großen, vom Herbst völlig unbeeindruckten Blätter hatten beinahe die Farbe von schwarzen Oliven. Sanfter Wind fuhr wie ein dunkles Wispern durch sie hindurch und trug den Geruch von faulendem Holz und feuchter Erde zu mir heran.
Lange Augenblicke saß ich einfach nur da und versuchte, die Fassung zurückzugewinnen. Ich ertappte mich dabei, den Atem angehalten zu haben und spürte den starken Pferderücken unter mir vor Anspannung hart werden. Etwas Vergleichbares hatte ich noch nie erlebt. Wütend über mich selbst zwang ich meinen Verstand, die unerwartete Aufwallung niederzukämpfen. Wenn der Wald wirklich gefährlich wäre, hätten sich die Hofmagier schon lange darum gekümmert. Schließlich lebte ich in einem zivilisierten Königreich! Schattenlichter. Was sollte das überhaupt sein? Entweder es gab Licht oder Schatten, aber bestimmt keine Schattenlichter. Dieser Wald musste etwas an sich haben, auf das Menschen mit kreatürlicher Angst reagieren. Ein Rassegedächtnis? Vielleicht war einem unserer Urahnen in einem solchen Wald etwas Schreckliches geschehen, und alle Menschen hatten seitdem in derartigen Wäldern Angst. Die fehlende Überzeugung, mit der ich mir diese Erklärung konstruierte, beunruhigte mich beinahe ebenso sehr, wie der Wald selbst. Aber mein treues Ross zeigte sich noch weit mehr beunruhigt, als ich es war. Immer zögerlicher wurden die Schritte des stolzen Tieres, bis es endlich stehen blieb. Obwohl ich Derartiges noch nie bei ihm erlebt hatte, kannte ich meinen vierbeinigen Gefährten gut genug, um zu wissen, dass er mich keinen Meter weiter tragen würde. Als wäre es nie ausgebildet worden, tänzelte das Schlachtross unruhig auf der Stelle. Mir blieb nichts anderes übrig als abzusteigen, um das Tier zu führen. Doch als ich Anstalten machte, das Pferd mit einem energischen Zug an den Zügeln zum Gehen zu bewegen, stieg es wie von der Tarantel gebissen auf und riss sich los. Mit irr aufgerissenen Augen und Schaum vor dem Maul galoppierte mein treuer Gefährte in den Wald hinein. Wie gelähmt starrte ich ihm hinterher und ertappte mich dabei, dass eine merkwürdig lauernde Furcht mich nicht einmal fluchen ließ. Ein seltsames Gefühl von Verlorenheit und Verzweiflung machte sich in mir breit. An diesem Ort allein gelassen zu sein, war wie ein wahrgewordener Albtraum, wie Kinder ihn oft haben mögen.
Der Geist des königlichen Ritters befreite mich aus den spitzen Fingern der Panik und schenkte mir ein morbides Lächeln. Ein Siegelträger der Königin würde sich nicht von einigen Bäumen einschüchtern lassen. Und sollte hier tatsächlich eine schreckliche Bedrohung zu Hause sein, so würde sie mit dem Stahl meines Schwertes Bekanntschaft machen. Und auch mein Pferd wollte ich dem düsteren Wald nicht überlassen. Mit seiner bisherigen Treue hatte es sich verdient, nicht beim ersten Anzeichen von Schwäche im Stich gelassen zu werden. Entschlossen, mit dem Schwert in der Hand, machte ich mich daran, den Hufspuren im weichen Waldboden zu folgen.

Der Weg war nicht besonders anstrengend und auch wilde Tiere schien es im Schattenlichterwald nicht zu geben. Dennoch war dieser Wald offensichtlich für einfache Leute nicht zu durchqueren. Es würde nötig sein, zumindest eine breite Schneise in ihn hineinzuschlagen. Ein Holz dieser dunklen Farbe würde zweifellos ein unvergleichliches Baumaterial abgeben. Der Gedanke erstarb wie ein Lachen in einer Beerdigungszeremonie. Gegen meinen Willen ließ die Scham für diese Idee meine Wangen heiß werden und erneut mit der bedrohlichen Natur des Waldes kämpfen. Allein die Absicht, diese Bäume fällen zu wollen, war ein unfassbares Sakrileg – gegen wen oder was auch immer. In diesem Moment war diese Erkenntnis für mich ebenso selbstverständlich, wie, dass auch morgen wieder die Sonne aufgehen würde. Es war einfach ein Naturgesetz. Instinktiv entschuldigte ich mich laut und in aller Form für meinen Frevel.
Doch kaum war meine Stimme verklungen, stahl sich ein erleichterndes Lächeln in mein Gesicht. Die Vorstellung, meine Ordensbrüder oder gar einer der Herzöge könne mir jetzt zuschauen, war befreiend amüsant. Die Freiheit währte nur kurz und wurde schnell von neuen Sorgen überdeckt. Die Sonne würde bald untergehen und das ohnehin trübe Licht zu völliger Dunkelheit werden lassen. Die Fährte meines Pferdes war kaum noch auszumachen und es bestand die Gefahr, sie vollends zu verlieren. Ich würde in der Nähe einen Lagerplatz finden müssen, um am nächsten Morgen der Spur weiter zu folgen.
Das Geräusch von Wasser, das vom Wind getrieben sanft ans Ufer schlug, machte mich auf ein weiteres Problem aufmerksam. Mein Pferd hatte meine gesamten Vorräte, meine Decken und meinen Wasserschlauch bei sich.
Es würde eine kalte und hungrige Nacht werden. Ich hoffte, dass wenigstens das plätschernde Geräusch kein Trugschluss war und sich das Wasser als genießbar herausstellen würde.
Wenige Minuten später entpuppte sich die Wasserstelle als ein kleiner See mit einem Durchmesser von etwa fünfzig Schritten. Er war umgeben von einer großen Lichtung, dessen Boden nicht die dunkle Feuchtigkeit des Waldes aufwies, sondern dem trockenen, weißen Sand ähnelte, den man in Wüsten finden mag. Der gesamte See wurde wie ein blaues Juwel von diesem hellen Streifen eingefasst, in dem absolut nichts zu leben schien. Ich hatte so etwas noch nicht gesehen und konnte mir den Anblick nur mit einem unerhört starken Gift im See erklären. Aber das Wasser war kristallklar und roch so frisch und köstlich, dass ich sehr in Versuchung geriet, es dennoch zu probieren. Ich glaube, erst, als ich mich über die Wasseroberfläche beugte, sah ich endgültig davon ab, hier meinen Durst zu stillen. Offensichtlich stimmte hier etwas nicht. Die Sonne würde in wenigen Minuten untergehen, aber statt sich den Farben der Dämmerung anzupassen, behielt das Wasser das leuchtende Blau des Meeres an einem heißen Sommertag. Direkt an der Uferkante fiel der See ins Bodenlose ab. Er war so tief, dass trotz des unvergleichlich reinen Wassers der Grund unsichtbar blieb. Je steiler der Blick durch das Wasser drang, umso mehr verschob sich die Farbe zu reinstem Indigo. Minutenlang gab ich mich diesem wunderbaren Anblick hin. Immer tiefer schienen meine Blicke zu dringen, bis ich schließlich das Gefühl einer Tiefe erreichte, die dem Blick in einen Sternenhimmel ähnelte. Nein, hier stimmte etwas nicht. Entschlossen schüttelte ich die Faszination ab und trat einige Schritte zurück. Es würde eine durstige Nacht werden.
Der weiße Sand schien mir jedoch als Lagerstätte sehr geeignet zu sein. Die Sonne hatte ihm eine angenehme Wärme verliehen und er schien frei von all dem krabbelnden Getier zu sein, das einem Reisenden im Freien so zusetzen konnte. Also machte ich das Beste aus meiner Situation. Sorgfältig breitete ich meinen Mantel aus und stellte fest, dass der kostbare Stoff in Verbindung mit dem warmen Sand ein erstaunlich bequemes Nachtlager abgab. Lang ausgestreckt lag ich da und beobachtete, wie sich die Sonne mit einem letzten spektakulären Farbenspiel zur Nachtruhe zurückzog. Als die letzten warmen Strahlen hinter dem Horizont verschwunden waren und die Sterne endgültig das Firmament eroberten, breitete sich keine völlige Dunkelheit über die Lichtung. Der See selbst leuchtete in einem intensiven Blau und ähnelte jetzt mehr denn je einem unbezahlbaren Edelstein. Offensichtlich befand ich mich an einem mystischen Ort und natürlich war mir klar, dass ich beunruhigt gewesen sein müsste. Doch ich empfand nur Erstaunen und Faszination. Kurz darauf muss ich eingeschlafen sein.
Als Nächstes erinnere ich mich daran, wie ich scheinbar grundlos aus tiefstem Schlaf hochfuhr und noch halb im Land der Träume versuchte, die ungewohnte Umgebung mit meiner Erinnerung in Einklang zu bringen. Ich konnte kaum mehr als ein oder zwei Stunden geschlafen haben. Der See lag noch immer sanft leuchtend unter dem Firmament und machte keinen bedrohlichen Eindruck. Außer den Bäumen war weit und breit kein Leben, geschweige denn eine Gefahr zu entdecken. Erst als ich die Ursache für mein Hochschrecken entdeckte, fand die vertraute Furcht zu mir zurück: Herzrasen hatte mich geweckt. Wie ein eigenständiges Wesen, dessen Todesangst mir das Blut in die Adern presste, regierte die Panik in meiner Brust, ohne meinen Kopf erreichen zu können. In meinem ganzen Leben war mein Herz noch nie so gerast und mir mein Körper so fremd vorgekommen. Wie lange konnte ich das überleben?
Doch sogar die Angst vor dem Tod verblasste zur Bedeutungslosigkeit, als eine Bewegung im Augenwinkel meinen Kopf hochfahren ließ. Das blaue Leuchten war heller geworden und bildete in der Mitte des Sees eigentümliche weiße und schwarze Schlieren. Wie konnten mitten im Licht Schatten entstehen? Dann wurde die spiegelglatte Oberfläche sanft von einer zierlichen Gestalt durchstoßen. Die Schwärze entpuppte sich als endlos langes blauschwarzes Haar, das schneeweiße Haut oder vielleicht auch reines Licht umschloss. Zuerst war nur ein scheu gesenkter Kopf zu sehen, der unter der wilden – erstaunlicherweise trockenen – Haarpracht nicht näher zu erkennen war. Es folgte ein Oberkörper, dessen grazile Weiblichkeit mich fast erblinden ließ und schließlich fanden endlose, weich geschwungene Beine sicheren Halt auf der Wasseroberfläche. Atemlos starrte ich dieses unglaubliche Wesen aus einer anderen Welt an. Ich war dankbar für ihr wildes Haar, das ihrer Nacktheit wenigstens einen notdürftigen Schutz vor meinen Blicken gab. Diese Schönheit war nicht für sterbliche Augen geschaffen. Langsam, fast zögernd, hob sie den Blick und ich sah in das erhabene Gesicht einer Elfin, wie sie nur unter den Göttern zu finden sein kann. Sie war so unfassbar perfekt, dass nicht einmal ihre Augen mich zur Besinnung brachten. Sie hatten keine Pupillen, sondern waren wie der See, dem sie entstiegen war. Unendliche Tiefen verbargen sich unter der Oberfläche und je länger die Augen ihren Blick hielten, umso mehr verschoben sie sich in reinstes Indigo. Fasziniert begriff ich, dass sie und der See eins waren. Ihr sanft geschwungener Mund mit den leicht bläulichen Lippen zeigte den Ansatz eines Lächelns, als sie diese Erkenntnis in meinen Augen las. Doch der Rest des Gesichtes war von einer seltsamen Trauer überschattet. Ihr erster Schritt war reine Magie; jeder weitere wob daraus eine Melodie, die auf ihrem lautlosen Weg über den See zu einer Symphonie der Anmut wurde. Trotz ihrer unbegreiflichen Schönheit spürte ich, wie das Grauen mich ansprang, sich jedoch an einem dicken Panzer aus Gleichgültigkeit die Zähne ausbiss. Für eine Berührung ihrer Haare wäre ich mit Freuden gestorben, für ein Lächeln hätte ich meiner Königin die Gefolgschaft verweigert. Als hätte sie meine Gedanken gelesen, wurde ihr Lächeln wärmer und der Mantel aus Trauer dichter. Bläulich schimmernde Tränen reinsten Silbers begannen ihr über das Gesicht zu laufen und ließen sie nur noch erhabener und göttlicher erscheinen. Ich wollte etwas sagen, sie fragen, wer sie sei, mich vorstellen oder ihre Trauer vertreiben, aber mein Verstand und meine Stimme verweigerten einfach den Dienst. Nur mein Herz schien in der Lage zu sein, normal auf sie zu reagieren. Wie eine panische Büffelherde donnerte es in meiner Brust und schien gleich herausspringen zu wollen, um notfalls auf eigene Faust das Weite zu suchen. Erstaunlicherweise war mir vollkommen bewusst, dass Davonlaufen die richtige Reaktion gewesen wäre, doch ich ertrank in ihren Augen und ihrer unwirklichen Schönheit.
Dann stand sie endlich über mir und lächelte mit tränenüberströmtem Antlitz auf mich herunter. Eine Strähne ihres endlosen Haares streichelte mein Gesicht und trug einen Duft in meine Nase, der mich an Kirschblüten und frisch geschnittenes Gras erinnerte.
Ein kaum hörbarer Ton floss über ihre Lippen, schwoll an und wurde zu einer traurigen Melodie, die mein Innerstes durchdrang und meine Seele beinahe vor Schwermut vergehen ließ. In ihren Augen las ich, dass sie für mich sang. Ein verlorenes Lied der Trauer, das von einer Stimme getragen wurde, der nichts glich, was ich je zuvor gehört hatte. Sie lag irgendwo zwischen einem Käuzchen, zerbrechendem Kristall, einem Bass und einem Reibeisen. Und dennoch war sie von einer solch tiefgründigen Harmonie und Klarheit, dass ihre Schönheit nicht hinter der ihrer makellosen Erscheinung zurückstand. Allein mit dieser Stimme, mit diesem wortlosen Lied der Trauer, mochten ganze Imperien zu bezwingen sein, sie sang jedoch allein für mich. Ich wusste, dass ich nach dieser Nacht ein Verlorener sein würde.
Es mögen Stunden gewesen sein, die ich hilflos schluchzend zu ihren Füßen verbrachte. Als ihr Lied endlich endete, war es, als könne ich endlich wieder frei atmen. Jede Trauer und alle Sorgen in mir schienen für immer verbrannt worden zu sein. Ich lachte vor Glück und sah in ein warmes Lächeln hinauf, das bis auf den Grund der Seen hinunterzureichen schien, die ihr als Augen dienten. Fast schmerzhaft anmutig kniete sie sich zu mir herunter und beugte sich über mich. Eine Göttin auf Knien, die einen Sterblichen zu beschenken sucht. Eine kalte, aber unendlich zarte Hand strich über mein Gesicht, und als ihre kühlen Lippen den meinen einen sanften Kuss schenkten, wurde meine Welt für immer eine andere. Alle meine Sinne verbanden sich zu einem gewaltigen Rausch. Ich verging beinahe in ihrem Feuer.
Meine nächste klare Erinnerung war der undeutbare Ausdruck ihres Gesichts, als sie auf mir sitzend meinen Körper mit ihren Haaren bedeckte. Mein zärtliches Lächeln zerbrach an einem Ausdruck kalter Gnadenlosigkeit, an dem eine Seele erfrieren konnte. Ihre Augen verdunkelten sich und wurden von einer Wollust erfüllt, die nichts mit irgendeiner menschlichen Empfindung zu tun hatte. Plötzlich riss sie mich mit einer Kraft, die mein Pferd zu Boden gezwungen hätte, an sich. Ich hörte das Knacken meiner Knochen und spürte einen fürchterlichen Schlag vor die Brust, der mir sekundenlang schwarz vor Augen werden ließ. Unglaubliche Schmerzen tobten durch meinen Körper und schalteten jede andere Wahrnehmung aus. Erst als mein Blick wieder klar zu werden begann, nahmen auch meine Ohren ihren Dienst wieder auf. Ich hörte sie schlürfen und gierig schlucken. Eine warme zähe Flüssigkeit tropfte auf mich herunter. Meine Augen verrieten mir, dass sie ein zuckendes Stück Fleisch in den Händen hielt, von dem sie mit großen, hungrigen Bissen aß. Mit morbider Faszination stellte ich fest, dass es ein Herz war. Mein Herz. Ihr Gesicht und ihre makellosen Brüste glichen feinstem Porzellan, das von Schlachtabfällen besudelt wurde und in einer merkwürdigen Weise schämte ich mich für diese Beschmutzung. Mein letzter Eindruck war der lüsterne Ausdruck ihrer Augen, als sie mein Blut von ihren Fingern leckte und dabei auf mich herabsah.

Der nächste Morgen fand mich schlafend am Waldrand vor, doch kann er kaum so überrascht wie ich über diese Tatsache gewesen sein. Ich musste einen erstaunlich realen Traum gehabt haben und trotz seines Endes war ich ernsthaft betrübt darüber, dass es nur eine Illusion gewesen war. Als ich mich aufsetzte, fand ich mein treues Pferd fein säuberlich abgesattelt und angebunden vor. Hatte ich nicht nur geträumt, sondern auch noch vergessen, wie ich das Tier wiedergefunden hatte?
Tief erschüttert, nein verunsichert, kam ich knapp zwanzig Minuten später in Wispersee an und traf auf eine verängstigte Dorfbevölkerung, die sich in der kleinen Schenke des Ortes versammelt hatte. Die Todesfee sollte gestern Nacht wieder jemanden zu sich geholt haben. Die halbe Nacht sei ihr klagendes Lied aus dem Schattenlichterwald gedrungen und das bedeutete angeblich nie Gutes. Normalerweise sang sie nur jeden Neumond, aber wenn sie zwischendurch singe, hieße das immer entsetzliches Unheil für eine arme Seele.
Ich glaube, man war sehr überrascht, einen Siegelträger der Königin, der das Lied angeblich nicht gehört hatte, wegen so einer Geschichte kreidebleich werden zu sehen. Doch ich war so erschreckt, dass ich erst nach dem dritten Schnaps wagte, nach meinem Herzschlag zu fühlen. Aber ich wusste bereits, dass ich vergebens suchte.
Es ist schon ein beängstigendes Gefühl, nicht zu wissen, ob man tot ist oder nicht. Doch die Unsicherheit währte nur kurz. Schon beim nächsten Neumond verstand ich, warum ich noch lebte, warum ich die Sehnsucht nach meiner Göttin, der blauäugigen Todesfee, spürte und warum ich ihren See nie wieder fand. Ich bin immer noch ein Ritter. Der Herold einer Herrin, deren Wohl über dem Wohl des Restes der Welt steht.
Jeden Neumond erwache ich mit einem Samenkorn unter der Zunge, dem eines wunderbar dunklen Baumes mit Blättern von der Farbe schwarzer Oliven. Den ganzen Tag über begleitet mich ihr Lied, bis das Werk vollbracht ist und der Samen seinen Platz gefunden hat. Mit jedem Baum, den ich pflanze, vergrößere ich das Reich meiner Herrin, der blauäugigen Göttin. Und eines Tages, wenn ich ihr gut und lange genug gedient habe, wird sie mich zu sich rufen. Ich werde sie wiedersehen und die Ewigkeit mit ihr in ihrem See verbringen.
Die Aufgabe, die ich bis dahin zu erfüllen habe, ist gewiss nicht leicht, aber eine große Ehre. Denn es bedarf eines besonderen Mannes, ihren Samen in den einzigen Humus zu setzen, der die Bäume der Todesfee gedeihen lässt: menschliche oder elfische Herzen. Du kannst dir denken, dass sich nicht jeder Auserwählte gerne von dem seinen trennt. Schlimmer noch: Wenige sind so kooperativ wie du und setzen sich in einer Neumondnacht zu mir an ein einsames Lagerfeuer irgendwo in der Wildnis.
Verstehst du jetzt, was Schicksal ist?

Gabriele Ketterl
www.gabrieleketterl.de
Die Autorin Gabriele Ketterl wurde in München geboren, wo sie auch heute wieder mit ihrer Familie lebt. Sie absolvierte ein Studium der Amerikanistik und Theaterwissenschaften an der Ludwig Maximilians Universität, München. Zahlreiche Auslandsaufenthalte inspirieren Gabriele Ketterl immer wieder zu neuen Geschichten. Sie schreibt Romane, Kurzgeschichten, Kolumnen und Kinderbücher.
DAS ELFENBUCH
Gabriele Ketterl
Hamburg, Hauptbahnhof
»Könnten Sie gütigerweise endlich mal den Weg freimachen?« Der Mann klang genervt und Sanya verkniff sich jeden Kommentar. Wäre er etwas weniger fett gewesen, wäre er auch problemlos an ihr vorbeigekommen. Zugfahren war zwar nicht schlimm, aber bis man auf seinem Platz saß, hatte man einiges auszuhalten. Endlich fand sie ihr Abteil und verstaute ihren Rucksack und die Tasche im Gepäcknetz. Seufzend ließ sie sich auf den Fensterplatz fallen. Keine zwei Minuten später verließ der ICE Hamburg. Müde lehnte Sanya den Kopf an das Fenster. Draußen wurde es langsam hell und sie sah ein letztes Mal die Umrisse der Stadt durch den Morgennebel. Ihr war bewusst, dass sie Hamburg nie wiedersehen würde. Was würde sie überhaupt je wiedersehen? Es war noch keine vierundzwanzig Stunden her, dass sie den Ruf der Hohepriesterin gespürt hatte. Sanya war so sehr in ihrem menschlichen Leben und dessen Alltag eingebunden, dass sie zuerst gedacht hatte, sie habe an eine offene oder defekte Stromleitung gefasst. Erst nach geraumer Zeit wurde ihr klar, was sie spürte. Tyandras Ruf hatte sie in den frühen Morgenstunden des vergangenen Tages erreicht. Sie hatte sich gerade für die Fahrt zur Uni vorbereitet, sich auf die Präsentation der besten Bilder gefreut, unter denen sich auch eines der ihren befand. Sie war die Beste des Kunstkurses gewesen. Nun würde sie nie erfahren, ob eine gute Malerin aus ihr hätte werden können. Sanya war sich ihrer Pflicht sofort bewusst gewesen. Innerhalb kürzester Zeit hatte sie alles erledigt, die Zugtickets besorgt und sich um einen Anschlusszug in London gekümmert.
Die Möglichkeit zu fliegen, hatte sie sofort verworfen. Sie hielt es in einem Flugzeug nicht aus. Die Schmerzen in ihren Schultern, die sonst nur leicht und als dumpfer Druck zu spüren waren, würden in der bedrückenden Enge eines Flugzeuges unerträglich sein. Die ganze Zeit war dieses elektrisierende Prickeln über ihrem Körper gewesen. Es hatte sich im Laufe des Tages sogar noch verstärkt, ebenso wie das fortwährende Pochen in ihrem Kopf. Komm, komm, komm! Es klang dringend, sie musste sich beeilen, so gut sie konnte. Doch sie wusste auch, dass sie nicht die Einzige war, die den Ruf wahrgenommen hatte, und dass, nachdem es begonnen hatte, von der ersten Sekunde an, ihr Leben in Gefahr war. Darauf war sie ebenso vorbereitet wie auf alles andere. Nun musste die Prophezeiung ihren Lauf nehmen, es gab kein Zurück.

Los Angeles, Kalifornien
»Aua, verdammt noch mal, welcher Idiot lässt denn hier seinen ganzen Mist herumliegen?« Liams tastende Hände fanden endlich den Lichtschalter und er erkannte, dass es seine eigenen Stiefel gewesen waren, über die er gefallen war. Er rieb sich den schmerzenden Schädel, den er sich an der Küchentheke angeschlagen hatte. Was war nur los mit ihm? Er fühlte sich, als habe er einen Stromschlag bekommen, sein ganzer Körper vibrierte. Zitternd goss er sich ein Glas Wasser ein, es half nicht wirklich. Während ihm der Schweiß in kleinen Rinnsalen über den Körper lief, öffnete er das Fenster. Die Hollywood Hills lagen vor ihm im Mondlicht. Er konnte sich nicht erinnern, etwas geraucht zu haben, und getrunken hatte er gestern auch nichts. Sie hatten am frühen Morgen Probeaufnahmen für die neue Doku gemacht. Müde und verwirrt strich sich Liam seine langen, blonden Haare aus dem Gesicht. Er würde ein tolles Bild des coolen Surfers abgeben, wenn das so weiterging. Erneut raste etwas wie ein Stromstoß durch seinen Körper und endlich begriff Liam. Sein Leben als Beach Boy war ab sofort vorbei. Mit dieser Erkenntnis ließ der Schmerz nach. Liam riss alle Fenster auf, um frische Luft hereinzulassen und bahnte sich durch seine nicht wirklich ordentliche Wohnung den Weg zum Kleiderschrank. Mit einer einzigen Handbewegung fegte er die Bodenplatte leer und hob sie an. Ein großes in Leder gewickeltes Bündel kam zum Vorschein. Liam wickelte es vorsichtig aus und legte den Inhalt neben sich: ein Langbogen, ein Köcher mit Pfeilen, ein langer, silberner Dolch und ein breiter Gürtel aus Wildleder, gespickt mit kleinen Wurfdolchen. Liam warf einen kurzen Blick darauf und ging zum Telefon. Eine Schiffspassage kam nicht infrage, also würde er in den sauren Apfel beißen müssen und fliegen. Allein der Gedanke verursachte ihm Übelkeit. Er buchte ein Ticket nach London und von dort aus einen Anschlussflug nach Manchester. Das war die schnellste Verbindung, die er bekommen konnte. Der Flug ging in zwei Stunden. Während er unter der Dusche stand, dachte er mit Wehmut an das Leben, das er zurücklassen musste – für immer. Aber schon, als er noch tropfnass aus seinem Badezimmer trat, gestand er sich ein, dass er eigentlich sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet hatte. Liebevoll strich Liam über den Bogen. »Dann hat es also begonnen!«

Rom, Italien
»Pietro, es ist soweit. Die alten Mächte sind erwacht. Du weißt, was das bedeutet? Hol unseren Mann. Sofort!« Der Greis lehnte sich in seinem hohen Sessel zurück. »Gut, dass ich das erlebe. Gut, dass ich es bin, der es endgültig beenden wird.« Er spürte sein hohes Alter in allen Knochen, doch jetzt galt es, das auszuführen, wofür er gelebt hatte.

London, Central Station
Sanya verabschiedete sich von ihrer Mitreisenden. Eine ältere Dame war ihr in den letzten Stunden eine amüsante Reisebegleitung gewesen. Allerdings war auf die Bahn wieder einmal kein Verlass, und sie hatte ihren Anschlusszug nach Manchester verpasst. Vier Stunden musste sie warten. Das war schlecht, sie wusste nur zu gut: Je näher sie ihrem Bestimmungsort kam, umso größer wurde auch die Gefahr. Schon jetzt beschlich sie ein ungutes Gefühl. Ganz zu schweigen von dem Schmerz, der sich zunehmend unter ihren Schulterblättern bemerkbar machte. Sie wählte sorgsam den belebtesten Platz im Bahnhof. Die vielen Menschen boten Schutz und schirmten sie ein wenig ab. Leise über die englischen Preise fluchend, kaufte sich Sanya ein Sandwich und eine Packung Kakao. Sie setzte sich neben ein junges Paar, aß hungrig das pappige Brot und wartete auf den Zug in den Norden.

Los Angeles, Airport
Liam bedankte sich mit strahlendem Lächeln beim Bodenpersonal der British Airways. Obwohl sein riesiger Seesack eigentlich Übergepäck war, hatte man ihn problemlos eingecheckt. Am Airport angekommen, war er nervös geworden, ob man wohl seine seit Langem vorbereiteten Dokumente akzeptieren würde. Doch seine »Filmrequisiten« waren, bis auf ein kurzes Stirnrunzeln und einen prüfenden Blick des Zollbeamten ebenso abgefertigt worden, wie der Rest seines Gepäcks. In Hollywood zu leben und zu arbeiten, war ab und an gar nicht so übel.
So war nun alles auf dem Weg nach Manchester und für den Augenblick hatte er damit ein Problem weniger. Sein Flug wurde bereits aufgerufen. Nur fünfundvierzig Minuten später blickte er, mit einem Hauch Wehmut, zum letzten Mal hinunter auf die stets hell erleuchtete Stadt der Engel.

Rom, Italien
Er blickte forschend in das Gesicht des riesigen Mannes vor sich. Die hellgrauen, ausdruckslosen Augen entbehrten jeder Spur von Menschlichkeit. Das Gesicht, der ganze Mann, strömte eisige Kälte aus. Jeder Andere wäre vor diesem Wesen zurückgeschreckt, nicht aber er. Er hatte ihn erschaffen, dieser Mann war eine Maschine, der nur lebte, um zu töten – zielgerichtet und effektiv! Der Greis verspürte kein Schuldbewusstsein, ihn seiner Menschlichkeit beraubt zu haben. Es war für einen viel höheren Zweck geschehen und jener heiligte hier die Mittel durchaus. »Nauro, deine Anweisungen sind klar. Der Jet wird dich an deinen Bestimmungsort bringen. Triff deine Vorbereitungen. Es ist Eile geboten. Nicht zu viel Aufmerksamkeit, hörst du mich, Nauro?«
Der riesige Mann nickte unmerklich. Sein kahlgeschorener Kopf wandte sich zum Fenster. »Das Licht! Sie ist angekommen.« »Pietro, gib sofort Anweisung an den Airport. Die Limousine muss bereitstehen. Rasch!« Er wandte sich seinem Killer zu. »Geh, Nauro! Enttäusche mich nicht!«
»Das wird nicht geschehen!«
Als die Tür hinter Nauro ins Schloss fiel, ging der alte Mann zum Fenster. Er öffnete die schweren Läden und blickte hinaus auf die Dächer der erwachenden Ewigen Stadt. »Zweifle nicht an mir, Herr. Ich werde all das, was du aufgebaut hast, schützen … auch mit meinem Leben.«

London, Central Station
Sanya machte es sich bequem. Der Zug war älter, aber komfortabel und sie hatte einen angenehm breiten Sitz. Mit zwanzig Minuten Verspätung fuhren sie los. Schuld daran waren die zahllosen Fans von Arsenal London, die zum Spiel gegen Manchester United wollten. Zuerst war Sanya die laute Fangemeinde unangenehm gewesen, mittlerweile gestand sie sich ein, dass die Männer wohl eher Schutz boten. Die Arsenal Fans hatten die angrenzenden Abteile mit Beschlag belegt, doch hier hatte sie ihre Ruhe. Zu ihrer Freude war das junge Paar mit in den Zug gestiegen und teilte sich nun mit ihr das Abteil. Sie hatten die Vorhänge zugezogen, um neugierige Blicke abzuwehren. Kurz darauf schliefen die beiden, eng aneinandergekuschelt, in ihren Sitzen ein. Sanya ließ ihren Blick über die Landschaft schweifen, die langsam mit der einbrechenden Dunkelheit verschmolz. Ihr Aufenthalt in London hatte wertvolle Zeit gekostet. Sanya spürte, schon seit sie in den Zug gestiegen war, eine deutliche Bedrohung. Sie ließ ihren scharfen Geist durch die Abteile gleiten, was leider in ihrem jetzigen Zustand sehr anstrengend war. Sie hatte lange nicht geschlafen und war erschöpft. Zu schlafen hatte sie nicht gewagt. Plötzlich stieß sie auf eine Barriere aus Eis. Verdammt! Sie hatten sie schon gefunden. Eilig zog sie ihren Geist zurück und baute, so gut sie konnte, ihren Schutzschild auf. Die nächsten beiden Stunden wagte sie kaum, sich zu bewegen. Sie hielt den Schild konstant aufrecht und hoffte, dass sie ihre Fähigkeiten in der langen Zeit unter Menschen nicht verlassen hatten. Draußen auf dem Gang feierten die Fußballfans. In deren Gesänge mischte sich zunehmend eine Stimme, die – wie ein Mantra – stets die gleichen Worte wiederholte: »Das Licht ist hier.« Dort draußen war etwas Bedrohliches. Etwas, das ihr nach dem Leben trachtete. Um ein Haar wäre ihr Schutzschild zusammengebrochen, als sie vom Gang die Stimme eines angetrunkenen Mannes vernahm. »Mensch, Alter, hör auf hier herumzurennen und tu mir den Gefallen, wenn du dein Scheißlicht gefunden hast, geh hinein und halt endlich die Fresse!«
Gegen jede Vernunft musste sie kichern und schaffte es gerade noch, den Schild wieder aufzubauen. Hätte der Typ gewusst, in welch tödlicher Gefahr er sich befand, er hätte wohl geschwiegen. Aber er hatte Glück. Was auch immer dort suchte, wollte nicht ihn, es wollte nur sie. Ihr Schutz hielt und die Stimme entfernte sich. Sanya versuchte herauszufinden, wo sie gerade waren. Gar nicht so übel. Die Gegend kannte sie. Sie überlegte, wie sie ihren Plan umsetzen sollte, als der Zufall ihr zu Hilfe kam. Ihre Begleiter wurden wach und wollten ins Restaurant-Abteil. Das war die Chance, die sie brauchte. Sie versprach dem Paar auf deren Gepäck zu achten und schloss hinter den beiden sorgsam die Tür. Wenn sie sich nicht irrte, kam in wenigen Augenblicken der Berg und damit auch der kleine Bahnhof. Richtig, der Zug wurde langsamer. Sanya riss ihr Gepäck herunter, öffnete das Fenster und wartete einen günstigen Moment ab. Sie warf ihre Taschen nach draußen und sprang hinterher. Jeder normale Mensch hätte sich hierbei die Knochen gebrochen, nicht Sanya. Sie sprang weit und kam leicht auf ihren Füßen auf. Ein Lächeln glitt über ihr Gesicht: »Ich kann es noch!«, murmelte sie vor sich hin. Jetzt konnte sie nur hoffen, dass ihr Verfolger ihre Abwesenheit eine Weile nicht bemerkte. Sanya schnallte sich ihre Tasche auf den Rücken und rannte auf den Waldrand zu. Sie hatte noch einen weiten Weg, ehe sie in Sicherheit sein würde. Sie musste es schaffen, sonst war alles verloren!

London, Heathrow Airport
Seine Schwester war in Gefahr, sogar in großer! Verflixt, er war noch viel zu weit weg. Hoffentlich starteten sie wenigstens rechtzeitig. Er hätte jetzt bei ihr sein sollen, als ihr Beschützer. Zu seiner großen Erleichterung hob der Flieger wirklich pünktlich ab. Unruhig lehnte sich Liam in seinem Flugzeugsitz zurück.

Windermere, Cumbria
Sanya lief. Noch gelang es ihr, den Schutzschild aufrecht zu halten. Wie lange das noch gutgehen würde, stand in den Sternen. Sie spürte, dass sie von Kilometer zu Kilometer müder wurde. Sie war sich sicher, dass ihr Jäger inzwischen wusste, dass sie den Zug verlassen hatte. Sanya umrundete eine Baumgruppe und blieb wie vom Blitz getroffen stehen. Vor ihr im Mondlicht lag er, Lake Windermere! Der magische See, dessen wahres Gesicht nicht einmal die kannten, die hier lebten. Wie auch? Nachdem alles, was diese Gegend einmal ausgemacht hatte, im Verborgenen leben musste. Aber was war hier geschehen? Das war nicht mehr der See, den sie kannte. Jachthäfen säumten seine schönen Ufer, Hotel reihte sich an Hotel. Sanya schüttelte sich. Menschen! Mussten sie Schönheit immer zerstören?
Sie hatte keine Zeit, sich Gedanken über die Bauwut der Menschen zu machen. Ihr Ziel lag noch Kilometer entfernt und sie musste sich beeilen. Viel schlimmer als alles andere war, dass sie begann, den Jäger wieder zu spüren. Eilig lief sie zurück in den Wald, folgte so schnell sie konnte dem für das ungeschulte Auge nicht sichtbaren Pfad. Sanya rannte schneller, ihr Herz klopfte bis zum Hals. Sie spürte, dass Liam noch weit weg war, zu weit um ihr eine Hilfe zu sein. Während sie durch den Wald lief, versuchte sie ihren Schild wieder aufzubauen. Doch ihre Kraft reichte nicht mehr aus. Sanya bemühte sich, in einen gleichmäßigen Schritt zu fallen. Das, was sie verfolgte, war böse. Abgrundtief böse. Es griff ihre Energie an. Ihr wurde eiskalt, obwohl sie wie eine Wahnsinnige rannte. Was auch immer ihr auf den Fersen war, hatte nur ein Ziel – sie tot zu sehen. Sanya wusste, in wessen Namen ihr Verfolger handelte. Welch ein Wahnsinn. Langsam konnte sie fast nicht mehr atmen, ihre Rippen taten schrecklich weh und der Schmerz unter ihren Schulterblättern war schier unerträglich geworden.
Der Wald war finster, aber ihre Augen benötigten kein Licht. Sanya konnte den Atem ihres Verfolgers hören. Sie lief nicht mehr, nein, sie flog förmlich zwischen den Baumreihen hindurch. Eine Kugel pfiff an ihr vorbei und bohrte sich in den Stamm einer Tanne. Der Jäger hatte sie gefunden! Sie schlug einen Haken und versuchte, zwischen den Bäumen Schutz zu finden. Geschickt wich sie tief hängenden Ästen aus, während sie hinter sich sein Keuchen hörte. Er war zu schnell! Sanyas Herz schlug ihr bis zum Hals. Auch sie war schnell. War, wenn sie es wollte, unsichtbar, doch dazu brauchte sie Kraft. Kraft, die sie nicht mehr hatte. Nicht versagen!, feuerte sie sich insgeheim an. Alles hing davon ab, dass sie ihr Ziel erreichte, sonst waren all die Jahre im Verborgenen vergeblich. Sie musste laufen, koste es was es wolle. Die aus dem Boden ragende Wurzel bemerkte sie dabei nicht. Sanya strauchelte, versuchte vergeblich, ihr Gleichgewicht wiederzuerlangen. Schon als sie auf dem Boden aufprallte, herausgerissen aus ihrem schnellen Lauf, sah sie seine riesigen Umrisse. Sie starrte in ein seelenloses Gesicht, dem keinerlei Erschöpfung anzumerken war. Ihre Feinde hatten ein Monster geschaffen, nur um sie zu töten. Er zog das silberne Schwert der Bruderschaft unter seiner Jacke hervor. Sanya rief ihre Magie und schleuderte ihm die letzte geballte Energie, derer sie habhaft werden konnte, entgegen. Der Mann strauchelte nicht einmal. Hilflos musste sie mit ansehen, wie er das Schwert über den Kopf hob. »Du sollst sterben, Missgeburt!« Sanya schloss die Augen in Erwartung des tödlichen Hiebes. Was sie spürte, war eine höllische Hitze. Dann roch sie brennendes Fleisch und es war nicht das ihre. Sie riss die Augen auf und sah ihn brennen. Der Riese war eine einzige Feuersäule. Sanyas Blick blieb an einem Paar Stiefel hängen. Langsam glitt er nach oben. Sie kniff die Augen zu, um sie vorsichtig wieder zu öffnen. Der Anblick hatte sich nicht verändert. Der hochgewachsene Mann direkt vor ihr, nahm seine Kapuze ab und schüttelte sein langes, schwarzes Haar. »Sanyadriel, wie schön dich zu sehen. Darf ich dir helfen?« Sanyadriel! Wie lange hatte sie ihren wahren Namen nicht mehr gehört. Er trat noch etwas näher, streckte ihr seine Hand entgegen und half ihr hoch. Sie starrte ihn an und fragte sich, wie das Böse mit so unendlich viel Schönheit einhergehen konnte. »Ist es nicht nett von mir, dass ich ihm seinen letzten Wunsch erfüllt habe?« Er lachte leise über seinen Scherz.
Endlich fand sie ihre Stimme wieder. »Asazel, was tust du hier? Du hast mir das Leben gerettet! Warum?«
Der dunkle Engel lächelte nachsichtig auf sie herab. »Wenn du, so wie ich, seit Jahrtausenden in den Spiegel der Zeit sehen müsstest, dann wüsstest du warum. Die Menschheit macht mir – oder vielmehr uns – wenig Freude. Sie ist tatsächlich abstoßender, als es mir jemals angedichtet wurde.«
»Aber ich dachte, das freue dich und deinen Herrn?«
»Falsch gedacht, süße Sanyadriel. Das Ende des Zeitalters der Menschen ist nicht mehr fern. Sie übertreiben es. Kein Maß und Ziel.« Asazel seufzte theatralisch.
»Ich wäre jetzt tot, nicht wahr?« Sanyadriel zitterte.
»Ja, er war dafür gezüchtet worden, dich zu vernichten. Mit mir haben die Herrschaften allerdings nicht gerechnet.«
»Ich verstehe es immer noch nicht. Du passt irgendwie nicht in die Prophezeiung. Oder etwa doch?« Sanyadriel sah den dunklen Engel nachdenklich an.
»Das kommt noch. Tyandra wird es verstehen, wird es dir erklären.« Asazel lächelte sie an, schien eine Weile zu zögern, dann strich er ihr liebevoll über die Wange. Plötzlich drehte er sich herum. »Oh, meine Freunde geben noch nicht auf. Lauf Sanyadriel, das Tor ist nah!« Mit diesen Worten verschwand Asazel in der Nacht. Sanyadriel überlegte nicht lange. Sie rannte in die Richtung, die der Engel ihr gewiesen hatte, spürte, wie die Magie stärker wurde und endlich sah sie den großen Findling zwischen den beiden hohen Tannen. Sie war zu Hause!

Rom, Italien
Er hatte Nauros Tod gespürt. Der alte Mann schrie voller Wut, Zorn und Schmerz in den Hörer. »Tun Sie, was ich sage. Etwas hat meinen Mann getötet. Es muss etwas Übernatürliches gewesen sein. Eine Ausgeburt der Hölle. Sie sind der Einzige, der diese Dämonen jetzt noch aufhalten kann. Sie sind Priester! Sie sind dem Gewand, das Sie tragen, verpflichtet. Handeln Sie! Töten Sie den Mann und finden Sie dieses Weib. Ohne diese beiden haben die Götzendiener endgültig verloren. Sorgen Sie dafür, dass dieses Licht endgültig erlischt!« Ohne auf die Antwort zu warten, warf er den Hörer zurück auf die Gabel. Er zitterte.
Leise näherte sich Pietro. »Eminenz, Ihr seid krank. Ihr braucht ärztliche Hilfe.« »Verschwinde Pietro! Alles, was ich brauche, ist die Nachricht vom Tod dieser beiden Kreaturen!«

Lancaster, Cumbria
Der junge Priester hatte Lancaster rasch hinter sich gelassen. Sein kleines Gefährt quälte sich über die schmalen Straßen, die in den Lake District führten. Es war eine Ehre, dass der Kardinal ihn in dieses Geheimnis eingeweiht hatte, dass er ihm diese wichtige Aufgabe übertrug. Er gedachte nicht zu versagen. Rom! Das war etwas Anderes als dieser Provinzort. Dort ging es um Höheres. Als er den rasch durch den einsetzenden Regen laufenden Mann sah, wusste er, was er zu tun hatte.

Liam erinnerte sich wieder daran, warum er Kalifornien so gemocht hatte. Es war warm und trocken. Ihm war klar, dass es nicht mehr allzu weit sein konnte. Der Lake Windermere war nahe und damit auch das Tor. Aber nass war er trotzdem. Er hörte das Auto kommen und wich aus, ohne seinen Lauf zu verlangsamen. Dann fühlte er einen stechenden Schmerz. Durch seinen Oberkörper hatte sich ein Schwert gebohrt. Diese Drecksbruderschaft! Liam spürte, wie das Blut aus seiner Brust floss – und es floss viel zu schnell!

Die Scheibenwischer wurden mit den herabprasselnden Wassermassen fast nicht mehr fertig. Der Priester erkannte die dunkle Gestalt vor ihm viel zu spät. Es folgte ein dumpfer Aufprall und dann Stille. Er durfte nicht anhalten, es galt, die Frau zu finden. Daher stieg er auf das Gaspedal und das Auto fuhr schlingernd los, um sofort wieder auf ein Hindernis zu stoßen. Wütend stieg er aus und versuchte zu erkennen, was ihn aufhielt. Als er es erkannte, verlor sein Gesicht jegliche Farbe, seine Knie gaben unter ihm nach und seine Stimme verweigerte den Dienst. Der dunkle Engel trat nahe an ihn heran. »Schämst du dich denn gar nicht, Priesterlein? Was haben sie dir beigebracht? Du sollst nicht töten!« Bei jedem Wort des letzten Satzes stach Asazel dem Priester seinen Zeigefinger in die Brust. »Böser Priester!«
»Satan, weiche von mir.«
»Zuviel der Ehre, kleiner Mann!« Asazel verbeugte sich mit einem bösen Lächeln. »Stirb!«

Das Reich des Lichts
Sanyadriel weinte! Sie hatte den Schmerz ihres Bruders gefühlt, nur wenige Meter, nachdem sie endlich durch das Tor getreten war. Die alten Schwerter der Bruderschaft aus Rom konnten sie töten. Und nun lag Liam im Sterben. Tyandra aber war sofort bei ihr. »Sanyadriel, du hast es geschafft! Nein, kein Wort, mein Kind. Komm rasch!«
Sanyadriel entfaltete, zum ersten Mal seit unendlicher Zeit, ihre Flügel und folgte der Hohepriesterin ohne Widerspruch. Tyandra brachte sie in ihre Unterkunft, wo sie sich sofort für die Zeremonie umkleidete. Wenig später stand Sanyadriel in ihrem Priesterinnengewand neben Tyandra und den anderen Hüterinnen der Quelle an einem kleinen Wasserfall mitten im Heiligen Wald. Nachdem Tyandra die Hände erhob, versiegte der Wasserfall jedoch. In der kleinen Höhle, die sich dahinter auftat, plätscherte eine Quelle und daneben lag ein großes, altes Buch. Sanyadriel hielt den Atem an.
Endlich!
Das Buch der Elfen!
Nach Hunderten von Jahren hatte die Quelle es wieder freigegeben. Die Macht der Großen Mutter war auf die Erde zurückgekehrt. Und sie, Sanyadriel, war die neue Herrin des Lichts und Hüterin des Buches. Tyandra legte ihr den Folianten lächelnd in die Arme. Welch ein glücklicher Moment dies hätte sein können, doch das Wissen, dass Liam wahrscheinlich schon tot war, lähmte Sanyadriel. Während sie das Buch voll Ehrfurcht in den Armen hielt, berührte Tyandra zärtlich ihren Arm. »Sanyadriel, sieh doch.«
Als sie sich umwandte, stand dort – Asazel. Der dunkle Engel hielt ihren Bruder in den Armen und legte ihn vorsichtig auf dem Boden vor der Quelle ab. Als er sich wieder erhob, sah er Sanyadriel lange in die Augen. »Heute hat ein neues Zeitalter begonnen, Sanyadriel. Dein Bruder wird leben und ich werde mir große Mühe geben, dich in Zukunft oftmals zu überraschen.«
Sanyadriels Erstaunen wuchs, als sich Asazel vor Tyandra verneigte und im Nichts verschwand.
Ein neues Zeitalter hatte begonnen? Sanyadriel atmete tief ein. Dann soll es so sein, dachte sie und lächelte verträumt. Und zum ersten Mal, nach langer Zeit, öffnete sie das Buch der Elfen.

Barbara Büchner
geboren 1950, arbeitete viele Jahre lang als Journalistin, ehe sie sich ganz der Literatur und hier vor allem der Dark Fantasy widmete. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane und Kurzgeschichten. Die Autorin lebt und arbeitet in Wien.
DAS KALTE ZIMMER
Barbara Büchner
Du hast uns verlassen,
wir aber werden dich niemals verlassen.
Ich mag diese Villa nicht, dachte Cathy Mallory. Schlimmer noch. Ich hasse sie und mir graut vor ihr! Aber wie sollte sie ihrem Ehemann Angus beibringen, was sie empfand? Äußerlich war an der Villa Wertham – einem hübschen Stück viktorianischer Zuckerbäcker-Architektur in Hellblau, Rosa und Weiß – nichts auszusetzen. Das Quartier war sauber und preiswert. Es wurde von Mrs und Miss Wellbutton besorgt, Mutter und Tochter, Schottinnen aus Edinburgh, was dem Ganzen einen angenehm heimatlichen Touch gab. Die Einrichtung war etwas antiquiert, aber gemütlich. Gut, die Bilder waren nicht nach dem Geschmack der Mallorys, sie hätten lieber hübsche Aquarelle gehabt als diese Unzahl von Ölgemälden und Fotografien ausländischer Berge, die alle sehr frostig, grimmig und sturmumweht aussahen, aber natürlich hatten leidenschaftliche Bergsteiger wie die beiden längst verstorbenen Lords Wertham ihnen zusagende Sujets gewählt. Angus´ Chef in Glasgow hatte das Quartier empfohlen, er kannte die Besitzer und meinte, es sei billiger und zugleich für einen frischgebackenen Prokuristen auf Hochzeitsreise passender, ein Privatquartier zu nützen, als sich mit tausend plebejischen Sommertouristen in ein Hotel zu quetschen.
Cathy sah das nicht so. Die junge Schottin war nicht umsonst im Schatten des Ben MacDhui, des von Spukerscheinungen heimgesuchten Berges in den Cairngorms, geboren worden. Sie erkannte einen Geist, wenn sie einen spürte, und kein Zweifel: In der Villa Wertheim gab es einen, sogar einen extrem widerwärtigen.
Auf dem Ort lastete eine Atmosphäre von Beklemmung und Bangigkeit, wie sie für ein so unschuldig aussehendes Gebäude ungewöhnlich war. Und die Quelle allen Unbehagens befand sich in einem Erkerzimmer im Oberstock, das sehr deutlich als PRIVAT gekennzeichnet, aber sichtlich unbenutzt war. Mehr noch: Es war unbenutzbar gemacht worden. Mit Absicht. Das Schloss war, wie Cathys flinke Augen im Vorbeigehen mit einem Seitenblick festgestellt hatten, mit Modelliermasse verstopft worden.
Angus sah daran nichts Besonderes. Wenn das Zimmer stets verschlossen bleiben musste, war das verdächtig? Schließlich waren die Mallorys fremde Gäste, denen man mit Fug und Recht verwehren durfte, in Privatsachen herumzustöbern.
Cathy widersprach. „Das ist nicht alles. Da sind noch die Gebetstücher.“ Quer über die Tür war eine dünne Seidenschnur gespannt, an der bunte, in fremdartigen Lettern beschriebene Fähnchen hingen – Gebetstücher, wie man sie in Fernsehberichten aus dem Himalaja auf den schneebedeckten Hängen im Wind flattern sah. Die beiden Lords hatten allerlei exotisches Zeug von ihren Expeditionen mitgebracht, aber Cathy wurde den Eindruck nicht los, dass die Flaggen hier nicht als Zierde, sondern als Sperre dienten – als asiatisches Äquivalent zu einem Knoblauchkranz. Angus sah das nicht ein. Er war natürlich auch der Meinung, sie hätte sich nur eingebildet, dass die leichten Tücher in einem aus den Türritzen dringenden Wind flatterten. Die azurblauen Sturmläden des Erkerzimmers waren immer geschlossen.
Woher sollte in einem hermetisch verschlossenen Raum Wind kommen? Also erzählte Cathy ihm nichts davon, was ihr passiert war, als sie auf dem nächtlichen Weg zur Toilette an dem Erkerzimmer vorbeigemusst hatte. Gut, um ehrlich zu sein, sie hatte nicht wirklich gemusst. Das kalte Zimmer lag einen Stock höher als ihr Quartier. Aber sie hatte einfach nicht widerstehen können hinaufzuhuschen und an der Tür zu lauschen. Und da hatte sich in einer einzigen Sekunde ein scheußliches Bild in ihre Gedanken geprägt. Ein riesiges Gesicht ohne Körper hatte sie angestarrt, blaugrau wie eine in Schnee und Eis mumifizierte Leiche, mit borstig gesträubten Haaren – und aus dem weit aufgerissenen Mund mit den morschen Zahnstummeln war ein unverständlicher Schrei gedrungen, so dünn wie das Winseln des Windes auf fernen Bergeshöhen. Es war natürlich nur eine Phantasmagorie gewesen, gewiss, denn die Tür war und blieb verschlossen, aber die Seidenfähnchen wirbelten in einem jähen Windstoß. Cathy war vor Angst der Atem in der Kehle stecken geblieben. Sie konnte von Glück sagen, dass sie auf den unregelmäßigen Stufen nicht gestolpert und die Treppe hinuntergefallen war, so eilig hatte sie es wegzukommen.
Das war in der ersten Nacht gewesen, die eigentlich ihre Hochzeitsnacht hätte werden sollen – aber nach der langen Reise, dem Um- und Einräumen, dem viel zu späten Abendessen in einem billigen Lokal waren sie beide nicht in der Stimmung für Zärtlichkeiten gewesen. Angus fiel in den Schlaf wie ein Stein ins Wasser, und Cathy Mallory kämpfte sich zur Strafe für ihre Neugier durch einen schrecklichen Traum. Sie befand sich irgendwo in einem Tal zwischen völlig fremdartigen, nicht-europäischen Bergmassiven, vor denen sie sich fürchtete, aber etwas zog mit unwiderstehlicher Gewalt an ihr und saugte sie immer höher und höher, vorbei an gigantischen Schluchten, in deren Finsternis Wasserströme rauschten. Über ihr, immer weiter hinauf bis in den gelblichen Himmel, stapelten sich – einer über dem anderen – monumentale Felstürme. Und diese fremdartigen Orte, fühlte Cathy, waren bewohnt: Von bösen, lemurenhaften Geschöpfen bewohnt, die jedes für sich seinen Weg gingen und ihre schweren, schwarzen Schatten hinter sich herschleppten.
Sie hatte es kaum gedacht, als der furchtbare Schrei von Neuem ertönte, aus weiter Ferne und doch so durchdringend, dass es ihr wie eine Nadel ins Herz stach. Es musste ein Schrei in einer ihr völlig fremden Sprache gewesen sein, denn auf Englisch hätten die klagenden, stöhnenden Laute nur den ziemlich absurden Satz ergeben: „Ganz-schön-eng-da!“
So real erschien ihr der Traum, dass sie es kaum glauben konnte, als sie im Morgengrauen in einem gemütlichen Bett neben ihrem frisch angetrauten Gatten erwachte und der herrliche Duft des Frühstücks, das Mrs Wellbutton unten in der Küche zusammenbrutzelte, ihr in die Nase stieg.
Bei der Erinnerung an diesen Traum durchschüttelte sie erneut die Verzweiflung darüber, dass Angus so gar nichts von dem Grauen im Haus mitbekam, und sie beschloss, nicht länger um den heißen Brei herumzureden. Sie schob das Kinn vor und wölbte die Schultern. Ihr hübsches sommersprossiges Gesicht verzog sich zu der Grimasse, die besagte: Wage es nicht, mir zu widersprechen!
„Ich bin überzeugt“, sagte sie, jedes Wort betonend, „dass in diesem so sorgfältig verschlossenen Zimmer ein Gespenst wohnt.“
Angus wusste darauf keine Antwort, also schnauzte er sie hochmütig an: „Und wenn schon? Dann lass es in Ruhe in seinem Zimmer wohnen, solange es nicht herauskommt.“
„Ihr Mann hat recht, Mrs Mallory.“ Die Stimme gehörte Mrs Wellbutton, die unversehens im Frühstückszimmer erschienen war. Die jungen Gäste hatten nicht gehört, dass sie von ihrem Einkauf zurückgekehrt war, und jetzt waren sie beide peinlich berührt. Die Haushälterin sah von Cathy zu Angus und wieder zurück. „Sie haben es also bemerkt, hm? Dann kann ich Ihnen nur sagen: Lassen Sie die Dinge, wie sie sind. Fürchten Sie nichts, seien Sie aber auch nicht neugierig. Vor allem seien Sie nicht neugierig! Dann werden Sie hier eine gute Zeit haben. Andernfalls …“ Sie ließ den Satz drohend in der Luft hängen und verschwand in der Küche.
„Buh!“, machte Angus. „Jetzt hast du´s. Der verfluchte Ahnherr der Familie rasselt mit seinen Ketten im Erkerzimmer herum. – Und können wir jetzt bitte überlegen, welchen Londoner Sehenswürdigkeiten außer kalten Gespenstern wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden wollen?“
Cathy schwieg. Sie wollte weder mit ihrem frisch angetrauten Ehemann streiten noch das Misstrauen der Haushälterin auf sich ziehen, aber Blaubarts Frau war in ihr erwacht, und sie konnte an nichts anderes denken als an das goldene Schlüsselchen. Mrs Wellbutton hatte ihr ja wortwörtlich bestätigt, was sie bereits geahnt hatte: In dem so beklemmend kalten Erkerzimmer hauste ein Geist.

Drei Tage hielt sich Cathy Mallory an die stillschweigende Abmachung, das Erkerzimmer nicht zu erwähnen. Es fiel ihr nicht allzu schwer, denn die beiden jungen Leute amüsierten sich prächtig und waren abends so müde, dass sie wie Bleiklötze ins Bett fielen. Dann holte sich Cathy, die typische Keltin, weißhäutig und rothaarig, bei einer Bootsfahrt auf der Themse einen heftigen Sonnenbrand, und es empfahl sich dringend, einige Tage im Schatten des Hauses zu verbringen. Angus erklärte sich zwar sofort bereit, bei ihr zu bleiben, aber er war doch sehr erleichtert, als sie protestierte: „Sei nicht albern! Ich bin nicht todkrank. Mach deinen Männerkram, während ich mich auskuriere, dann können wir uns nachher den Dingen zuwenden, die mich auch interessieren.“
Angus fuhr also in die Stadt, und Cathy blieb zurück. Es dauerte nicht lange, bis sie sich langweilte. Es gab zwar einen Fernseher im Haus, aber am Vormittag liefen nur Seifenopern, also stöberte sie in der kleinen Bibliothek herum. Zu ihrem Missvergnügen stellte sie fest, dass die beiden Lords Wertham literarisch dieselben Sujets bevorzugt hatten wie in der Malerei. Außer Alpinismus gab es kein Thema, das sie interessiert hätte. Selbst ein Buch mit dem verheißungsvollen Titel „Der böseste Mensch auf Erden“ erwies sich als Biografie eines Bergsteigers. Offenbar hatten ihn die Brüder Wertham gut gekannt, denn das Buch trug eine überschwängliche persönliche Widmung für einen Lord Roger Wertham, unterzeichnet mit „Ho Mega Therion Laird of Boleskine.“
Cathy, die nun neugierig war, wie man als Bergsteiger zum bösesten Menschen der Welt avancieren konnte, nahm das Buch an sich und ließ sich in der schattigen Laube hinter dem Haus zum Lesen nieder. Sie hatte sich kaum in den Liegestuhl sinken lassen, als das Buch in ihrer Hand wie von selbst aufsprang. Auf der einen Seite zeigte es ein Schwarz-Weiß-Foto diverser bärtiger Männer mit Strickmützen vor der Kulisse einer schneegekrönten Felswand, auf der anderen war eine Textstelle angestrichen: „Den beiden adeligen Extrembergsteigern, Vater und Sohn Wertham, war der Laird von Boleskine als ein sehr fähiger, mutiger und einfallsreicher Bergsteiger bekannt, der eindrucksvolle sportliche Leistungen vollbrachte. Er war einer der Ersten gewesen, die bei ihren Touren auch auf unbekannten Bergen auf die Dienste eines einheimischen Bergführers verzichteten. Ohne Führer und im Alleingang hatte er unter anderem den wegen seiner heimtückischen Wetterverhältnisse allgemein gefürchteten Eiger bezwungen und das Jungfraujoch über die schwierige Schneehorn-Silberhorn-Route bestiegen. Nach Exkursionen in mexikanischen Gebirgen, wobei er mehrere Rekorde brach, hatte er sich einer Gruppe hochkarätiger Alpinisten angeschlossen, die sich ein verwegenes Ziel gesetzt hatten: die Besteigung von Achttausendern.
Im Jahre 1902 galt das wegen der extremen Strapazen und der unzureichenden Ausrüstung für große Höhen, in denen arktische Temperaturen herrschten, noch als unmöglich, auch künstlicher Sauerstoff stand noch nicht zur Verfügung. Die Gruppe wollte es dennoch wagen. Sie gelangten auch tatsächlich in eine bis dahin nie erreichte Höhe von siebentausendzweihundert Metern …“
Cathy gähnte, schloss halb die Augen und klappte das Buch zu. Sie hatte nicht das geringste Verständnis für Leute, die sich halb zu Tode rackerten, nur um als Erste auf irgendeinem öden Steinhaufen zu stehen. Wenn schon Expeditionen, fand die pragmatische junge Schottin, dann wenigstens in Gegenden, die für die Zukunft ein behagliches Leben versprachen: saftige Wiesen, fette Erde, fischreiche Gewässer … aber doch nicht irgendeine frostige, unfreundliche, von Lawinen und Steinschlägen bedrohte Gegend, die außer Mühsal und Schrecken nichts zu bieten hatte!
Da sie aber nicht aufstehen wollte, um sich ein anderes Buch zu holen, blätterte sie müßig in den Seiten, und schließlich erschien es ihr wieder, dass eine von selbst aufsprang: „Aber dieser großartige Alpinist zeigte auch abstoßende, geradezu ekelerregende Züge. Seine Bergkameraden verachtete er. Nur er allein war immer der Größte und Beste, und sie waren alles Schlechte von „verfressen” über „unfähig” bis „dumm” und „alpin unerfahren”. Den Sherpas gegenüber gebärdete er sich als Herrenmensch, er war zu ihnen nicht nur unhöflich und rücksichtslos, sondern trieb sie, wenn sie ihre kaum zu bewältigenden Lasten die steilen, gefährlichen Pfade hinaufschleppten, sogar mit Stockschlägen an.“
Was für ein widerwärtiger Mensch muss dieser Laird of Boleskine gewesen sein, dachte Cathy. Sie hätte es den einheimischen Trägern nicht verdenken können, wenn die armen Kerle ihm einen Tritt gegeben hätten, dass er über irgendeine Steilwand ins Nichts rumpelte.
Im Augenblick, als sie das dachte, war ihr, als ruhe ein fremder Blick auf ihr – kalt, verächtlich und feindselig. Der Blick richtete sich von schräg oben auf sie, so deutlich fühlbar, als sei eine Schnur zwischen ihrem Hinterkopf und den starrenden Augen gespannt. Unwillkürlich fuhr sie herum, überzeugt, eine übermenschlich große Gestalt hinter sich stehen zu sehen. Aber da war niemand, nur die von wildem Wein teilweise überzogene Rückseite des Hauses mit dem Erkerzimmer. Oder doch? Sehen konnte sie niemand hinter den geschlossenen azurblauen Jalousien, aber sie spürte die Gegenwart in dem verschlossenen Raum, wusste genau, hinter welchem der Fenster sie sich befand. Und war froh, dass sie gleichzeitig wusste: Was immer in dem kalten Zimmer wohnte, war darin festgebannt.
Dennoch beeilte sie sich, die Laube zu verlassen und das Buch in die Bibliothek zurückzustellen.
Sie sagte Angus nichts von dem Werk und auch nichts von ihrem merkwürdigen Erlebnis. Auch Mrs Wellbutton gegenüber schwieg sie wohlweislich, aber sie machte sich an deren Tochter Greta heran. Greta war ein feistes, bleiches und geistig merklich zurückgebliebenes Mädchen unbestimmbaren Alters, das den ganzen Tag ziellos im Haus herumwuselte. Anfangs hatte sich Cathy ihr gegenüber besonders liebenswürdig gezeigt, weil sie Mitleid mit dem armen Ding hatte, aber jetzt schlich sich eine heimtückische Absicht in ihre Freundlichkeit ein. Sie wusste, dass Kinder und Schwachköpfe oft viel mehr wussten, als sie sich anmerken ließen, weil sich die Erwachsenen und Vernünftigen in ihrer Gegenwart keinen Zwang antaten. „Ach, sie versteht es doch ohnehin nicht!“, hieß es.
Cathys Verdacht bestätigte sich. Greta hatte einiges sehr gut verstanden. Natürlich teilte sie die Ansicht ihrer Mutter, dass ein Geist im Erkerzimmer eingeschlossen war, sie fürchtete sich auch vor ihm, aber neugierig war sie dennoch, und so hatte sie nicht nur die Kälte gefühlt, die den unheimlichen Mieter umgab, sondern auch seine Stimme gehört. Mehr noch, sie hatte die Worte verstanden, die er jämmerlich stöhnend hervorstieß.
„Und was hat er gesagt?“
Greta neigte sich so nahe zu ihr, dass beider Nasenspitzen einander berührten, und flüsterte ihr das Geheimnis ins Ohr. „Ganz-schön-eng-da! Das hat er gesagt, und ach, Frau Mallory, mit was für ´ner dünnen, elenden Stimme, als heule und winsele einer fern, ganz fern auf´m mächtig hohen Berg oben, wo ihn niemand hören kann außer Gott!“
Cathy war ratlos. Greta hatte offenbar dieselben Worte gehört wie sie selbst, aber was mochten sie bedeuten? Bedrückende Enge war wohl das Letzte, was man mit der Besteigung hoher Berge verband. Oder hatte der Bewohner des Erkerzimmers seine jetzige Behausung gemeint? Vielleicht fand sie in dem Buch doch eine Antwort. Greta hatte es nicht gelesen; sie konnte kaum mehr lesen als die Schlagzeilen der Wochenzeitung, also brauchte Cathy an dieser Stelle nicht weiterfragen. Sie musste sich selbst ans Werk machen.
Sobald sie sich vor neugierigen Blicken sicher wusste, zog sie das Buch zurate. Wieder klappte es wie von selbst auf, kaum dass sie es berührt hatte. Die Worte sprangen ihr förmlich entgegen: „Man wusste, dass er ein Egozentriker und ein schlechter Kamerad war. Und dennoch – was schließlich geschah, hätte man selbst ihm nicht zugetraut. Die Expedition endete in einer Katastrophe, als mehrere Bergsteiger und Träger von einer Lawine mitgerissen und verschüttet wurden ...“
„Sie können es also nicht lassen, junge Frau.“ Mrs Wellbutton, die urplötzlich unter dem von Rosen umrankten Bogen der Laube erschienen war, blickte sie vorwurfsvoll an. „Ich dachte es mir gleich, dass Sie keine Ruhe geben werden, und als Sie dann auch noch das Buch aus der Bibliothek holten …“
„Ich wusste nicht, dass das verboten ist“, entschuldigte sich Cathy.
„Verboten ist es nicht“, antwortete Mrs Wellbutton. „Aber – ach weh, war´s nicht die Neugier, die Adam und Eva das Paradies kostete? Nun, ich werde Ihnen erzählen, was es mit dem kalten Zimmer auf sich hat, damit Sie mit Ihrer naseweisen Neugier nicht noch mehr Unruhe stiften.“
Sie zog einen der Weidenstühle heran und setzte sich Cathy gegenüber.
„Ich selbst“, erzählte nun Mrs Wellbutton, „habe ihn nicht gekannt, das war vor meiner Zeit – er starb 1947, und ich wurde erst zehn Jahre später geboren. Ich hörte die Geschichte von meiner Vorgängerin, die sie wiederum von ihrer Vorgängerin hatte. Offiziell freilich gab es gar nichts zu erzählen, die Familie hielt die Sache immer hinter Schloss und Riegel, aber wir Haushälterinnen mussten ja Bescheid wissen, sonst hätten wir am Ende einmal gedacht, in dem Erkerzimmer müsse sauber gemacht werden, und dann – ich will es mir gar nicht vorstellen! Also wurde mir mitgeteilt, was Miss Hassfurther – das war die Wirtschafterin zur Zeit der beiden Lords Wertham – erlebt hatte. Die beiden Herren waren ja närrisch, was die Berge anging, und genauso waren die Männer, die sie zu Besuch mitbrachten. Alles Verrückte, die ihre Seele dem Teufel verkauft hätten, nur um als Erste auf dem Gipfel irgendeines dieser ausländischen Gebirge zu stehen, wo einem der Atem in den Lungen gefriert und man nur noch die Sterne über sich hat. Manche von ihnen hatten keine Zehen mehr, andere keine Finger, und wieder anderen waren die Nasen und Ohren schwarz vor Kälte geworden und abgefallen. Hin und wieder, sagte Miss Hassfurther, fehlte einer aus ihrer Runde, und dann hörte man, dass er aus der Felswand gestürzt oder im Schneesturm erfroren war. Damals sagte sie zu Mrs Nestor, die nach ihr den Posten bekam: ´Ein trauriges Schicksal, gewiss, aber ich sage Ihnen ehrlich, ich habe kein Mitleid mit solchen Übermütigen. Gott lässt sich nicht spotten, und was haben wir auf den Bergen zu suchen, auf denen der Teufel thront? So jedenfalls sagen es die gelben Leute, die in diesen Gebirgen wohnen, und wenn sie auch Heiden sind, wissen sie, wovon sie reden. Diese Gipfel sind Dämonen geweiht, und ein Christenmensch oder auch nur ein vernünftiger Heide bleibt ihnen fern.“
Sie unterbrach sich, um Atem zu schöpfen, gerade lang genug, dass Cathy ihre tief empfundene Zustimmung zu diesen Ansichten äußern konnte.
„Unter den Bergsteigern“, fuhr Mrs Wellbutton fort, „die hierher zu Besuch kamen und oft wochenlang hier wohnten, war ein schottischer Lord – so jedenfalls nannte er sich, um sich wichtig zu machen. In Wirklichkeit war er kein Adeliger, kein Lord, sondern ein bloßer Laird, ein Gutsherr, der ein Haus und einige Acres Grund in der Grafschaft Boleskine besaß. Aber, dass er log, wie die Schlange im Paradies, war noch die kleinste seiner Sünden, Gott bewahre uns vor dem Bösen! Er war nicht nur ein Lügner und Schwätzer, er war allen Menschen und sogar seinen Bergkameraden gegenüber arrogant, leichtsinnig, launisch, rücksichtslos, überheblich. Kurz, er war ein so widerwärtiger Mensch, dass man meinen könnte, er wäre ein Teufel in Menschengestalt gewesen. Und Sie werden es nicht glauben: Er war noch stolz darauf, wenn man das von ihm dachte! Er prahlte damit, der böseste unter allen Menschen auf Erden zu sein! Vor allen Leuten nannte er sich Ho Mega Therion, das große Tier, und damit meinte er den Drachen aus der Offenbarung Johannis, der aus dem Abgrund der Hölle heraufsteigt. Allerdings sagte damals Miss Hassfurther, die eine kluge Frau war: Sogar das war gelogen, und er war kein Magier, kein Antichrist, kein Höllendrache, bloß ein eitler, aufgeblasener, mieser Kerl, den man nicht mit der Feuerzange anrühren möchte. Er starb ja auch dann jämmerlich in einem dreckigen Untermietzimmer irgendwo in London an dem Rauschgift, das er seit Jahren einnahm.“
„Aber er wohnte eine Zeit lang hier?“, fiel Cathy ein.
„Ja. Das war nach dem fürchterlichen Skandal. Die beiden gutmütigen Lords ließen zu, dass er sich in dem Erkerzimmer versteckte. Sie waren bei aller Narretei gute Kerle, die einen ehemaligen Kameraden nicht fallen ließen, auch wenn sie selbst nur mehr Abscheu und Verachtung für ihn empfanden nach der schrecklichen Geschichte … Wenn Sie das Buch gelesen haben, wissen Sie ja, was ich meine. Das Lawinenunglück.“
Cathy erklärte, nur wenige Stellen gelesen zu haben, worauf Mrs Wellbutton ihr das Werk aus der Hand nahm, darin blätterte und mit ihrer kräftigen klaren Stimme vorlas: „Der Versuch, die Verschütteten aus der Lawine zu bergen, gestaltete sich wegen der dünnen Höhenluft, des stürmischen Windes und der ständigen Gefahr weiterer Lawinenabgänge äußerst mühselig und gefährlich, aber da war kein Mann, Bergsteiger oder Sherpa, der nicht zu Hilfe geeilt wäre – außer einem! Während sich alle anderen abmühten, unter Einsatz des eigenen Lebens zu helfen, lag der Mann, der sich die Leitung der Expedition angemaßt hatte, in seinem Zelt, trank Tee und rauchte. Und nicht nur das! Er wartete ab, bis alle das Lager verlassen hatten und zu der Unglücksstätte geeilt waren. Dann schlich er sich davon. Er stieg alleine ins Tal ab und brachte sich in Sicherheit, ohne sich auch nur zu erkundigen, ob die verunglückten Kameraden geborgen werden konnten. Als dieses unerhörte Verhalten bekannt wurde, schämte er sich nicht etwa, nein, er wälzte alle Schuld auf seine Expeditionskameraden und verleumdete sie in einem Zeitungsartikel auf übelste Weise. Noch schlimmer, er machte sich nachher in aller Öffentlichkeit über die Lawinenopfer lustig und höhnte über die „Tollpatsche, die sich ihr Schicksal selbst zuzuschreiben gehabt“ hätten! Von da an spuckte man in der Welt des Alpinismus aus, wenn sein Name erwähnt wurde. Er musste ernsthaft fürchten, halb totgeschlagen zu werden, wäre ihm einer seiner ehemaligen Kameraden unversehens begegnet.“ Die Haushälterin schlug das Buch zu und blickte nachdenklich vor sich hin. „Aber wenn er sich auch vor seinen Feinden verborgen halten konnte, der Erinnerung an den Berg konnte er nicht entfliehen. Er nahm, sagte Miss Hassfurther, immer mehr von seinem Rauschgift, um Ruhe zu finden, aber es putschte nur seine Nerven auf und malte ihm Schreckensvisionen vor Augen.“ Von Neuem schlug sie das Buch auf und las den letzten Absatz: „Die Furcht vor der Schneewüste, vor den Felsenmauern des Großen Berges hielt ihn weiter umklammert. Von nacktem Grauen überfallen, hatte er angesichts des Unglücks den Kopf verloren und war geflohen. Aber mochte er auch fliehen bis an die Enden der Erde: Die er schmählich im Stich gelassen hatte, verließen ihn ihrerseits nicht. Selbst an seinem Zufluchtsort im Haus seiner Freunde, der beiden Lords Wertham, hörte er Tag und Nacht dieselben heulenden und klagenden Stimmen wie in der Schnee- und Eiswüste — die Stimmen der Toten oder der Dämonen des Kangchendzönga.”
Jetzt wusste Cathy, welches winselnd hervorgestoßene Wort sie selbst und die lauschende Greta aufgeschnappt und als „Ganz-schön-eng-da“ missverstanden hatten.

Am nächsten Morgen hatten die Mallorys ihre Koffer gepackt und verbrachten den Rest ihrer Flitterwochen jenseits des Ärmelkanals in Holland. Dort, wo es mit Sicherheit keine Berge gibt.
Anmerkung:
Die Geschichte beruht teilweise auf Tatsachen aus dem Leben von Aleister Crowley, der sich brüstete, ein Schwarzmagier und apokalyptisches Ungeheuer, „the most evil man on earth“ zu sein. Seine durchaus beachtliche Karriere als Alpinist endete abrupt, nachdem er sich bei dem Unglück am Kangchendzönga als letztklassiges Kameradenschwein erwiesen hatte. Die rächenden Geister des Berges peinigten ihn, den vom Rauschgift seelisch und geistig Zerrütteten, bis an sein Lebensende.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783948592141
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (März)
- Schlagworte
- Einhorn Fantasy Kurzgeschichte Anthologie düster dark Episch High Fantasy