Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
21. Juni, nachts
Wie unsympathisch ihr der Gedanke an die Reise nach Neu-England war, merkte die junge Pfarrersfrau Kathy Belham an den Träumen, die sie in der Nacht vor dem Aufbruch quälten. Sie waren verworren, lächerlich und bedrückend zugleich. In einer der kurzen Szenen, die ihr nach dem Erwachen mitten in der Nacht einfielen, ging sie an einem dunklen Strand entlang und beobachtete, wie sich eine Welle unter Wasser neben ihr her bewegte, als schwimme etwas Buckliges unter der Oberfläche. Sie versuchte davonzulaufen, aber mit jedem Schritt versanken ihre Füße tiefer im hemmenden Sand, während das unterseeische Ding bedrohlich näher und näher an die Wasserlinie heranpaddelte. In einem anderen Nachtmahr spürte sie kalte, hornige Finger ihren Rücken berühren und fuhr herum, aber da war nichts, nur eine Ranke der giftigen Fliegenwinde lag auf dem Boden. Schleim troff aus ihrem fahlweißen, trichterförmigen Kelch. Dann wieder überquerte sie in der Abenddämmerung eine Wiese, die gespenstisch vom Schein eines großen Feuers erhellt war. Eine Gruppe Männer stand daneben und warf Teile des überall herumliegenden Gerümpels in die Flammen. Manchmal krallten sich die Feuerzungen in Unverdaulichem fest, dann knatterte es wie Feuerwerk, und rotglühende Funken sprühten nach allen Richtungen auseinander. Manchmal fanden sie Süßes und Schmackhaftes, dann sprang die Flamme hoch und lodernd auf und drehte sich wie ein Wirbelwind. Kathy blickte in die Gesichter der Umstehenden, die im Feuerschein starr und glänzend und bronzefarben waren, und einen Moment leuchtete es wie eine Vision vor ihr auf: Gleich würde jemand einen metallenen Gong schlagen und schrille Musik aus gekrümmten Pfeifen erschallen, und rund um das lodernde Feuer würden in steifem Tanzschritt Gestalten in schwarzen perlenbesetzten Roben springen und Tänze zu Ehren abscheulicher Götter beginnen.
Einer dieser Träume jedoch war klar und deutlich das Wiederaufleben einer Erinnerung, die sie lange in sich vergraben hatte und die nun wieder ihr hässliches Haupt erhob.
Ihr Traum wiederholte ein schreckliches Erlebnis, das sie als kleines Mädchen gehabt hatte und über das sie nie mit jemand gesprochen hatte. Damals hatte Onkel Adrian eine kurze Zeit lang im Bostoner Haus ihrer Eltern gewohnt. Eines Abends, als ein heftiger Sturm durch die Straßenschluchten der Stadt fegte, war sie in den Korridor vor seinem Zimmer hinaufgestiegen, um die Fenster zu schließen. Sie war überrascht gewesen, den Schriftsteller dort vorzufinden, wie er vor dem runden Fenster an der Schmalseite des Korridors stand – reglos wie eine Schaufensterpuppe, den Blick auf die Stadt gerichtet, über der die von Blitzen erhellte Wolken dahinrasten. Er hatte ihr den Rücken zugewandt, und plötzlich hatte sie eine eisige Beklemmung bei dem Gedanken empfunden, dass er ihre Schritte gehört hatte, dass er sich jeden Augenblick umdrehen und sie ansehen könne. Und dann war es tatsächlich geschehen! Ohne ein Glied zu rühren, wandte er sich, als stünde er auf einer sich drehenden Platte, und sein Blick senkte sich in den ihren. Trotz des Halbdunkels im unbeleuchteten Korridor hatte sie ihn deutlich gesehen, denn ein sonderbar violettes Licht umgab ihn. Nein, es schien von ihm auszuströmen wie der Glanz eines dämonischen Glühwürmchens!
Sie hatte wie versteinert dagestanden, den Blick in atemlosem Entsetzen auf sein Gesicht gerichtet. Es hatte sich in eine teuflische Fratze verwandelt!
Ein sympathischer Mann war Adrian Petri nie gewesen, aber selbst seine Feinde – von denen er nicht wenige hatte – mussten zugeben, dass er ein attraktiver Mann war. Eine kraftvolle, robuste Erscheinung mit leuchtend diamantblauen Augen unter struppig überhängenden Brauen und einem Busch frühzeitig weiß gewordener Haare darüber. An diesem schrecklichen Nachmittag jedoch stand sein Haar vom Schädel ab wie die Borsten eines Reisbesens. Das Gesicht darunter war seltsam in die Länge gezogen wie vom Löffel rinnender Teig und von einer abstoßend gelben Farbe, wie Kathy sie noch nie an einem lebenden Menschen gesehen hatte. Auch die Zähne waren unnatürlich lang geworden und ragten weit aus den Kiefern. Die blauen Augen glühten wie Gasflammen in den tiefen, kohlschwarzen Höhlen. Als Kathy unwillkürlich aufschrie und so ihre Anwesenheit verriet, stieß er einen grässlich zischenden Laut aus und kam auf sie zu, nicht mit menschlichen Bewegungen, sondern wie an Drähten durch die Luft gleitend. Er krümmte die erhobenen Hände, als wolle er sie im nächsten Augenblick an der Gurgel packen und erwürgen – und es waren nicht mehr die manikürten Hände eines gepflegten Mannes, sondern gelbe, schuppige Klauen wie die eines Reptils.
Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, war Kathy schreiend die Treppe hinuntergeflüchtet, in solch wilder Hast, dass sie sich um ein Haar Hals und Beine gebrochen hätte, und war erst in die Wohnung zurückgekehrt, als ihre Eltern von der Arbeit heimkamen. Sie hatte nicht gewagt, irgendjemandem davon zu erzählen. Zum Abendessen war Onkel Adrian wie gewohnt bei Tisch erschienen und hatte genauso ausgesehen wie immer. Aber Kathy wusste genau, dass sie nicht geträumt hatte und keiner Sinnestäuschung erlegen war, das bewies ihr schon sein Verhalten – der furchtbare, mörderische Blick, den er ihr über den Tisch hinweg zuwarf. Er besagte: Wage es nicht, irgendjemand davon zu erzählen, was du gesehen hast! Ich würde dich auf der Stelle töten, und ich müsste nicht einmal eine Hand heben, um es zu tun!
Sie traute ihm durchaus zu, dass er sie mit einem Bannspruch tötete. Der Schriftsteller hatte, so lange sie sich zurückerinnern konnten, eine Neigung zu ausgefallenen, zuweilen altertümlichen und morbiden, jedenfalls aber definitiv unchristlichen Formen der Religion gehabt, die sich auch in seinen Romanen niederschlug. Er hatte sich als Sucher bezeichnet – und soviel Kathy von ihm wusste, hatte er schon früh klargemacht, dass er am Ende seiner Suche Tiefgründigeres erwartete als „diesen pfäffischen Schwulst“.
Kathy erinnerte sich, dass sie einmal – zu der Zeit, als er bei ihren Eltern gewohnt hatte – heimlich einen Blick in sein Zimmer geworfen hatte, das zu betreten ihr streng verboten war. Noch Jahre später spürte sie den Schauder, der sie damals befallen hatte. Es war halb dunkel darin gewesen, denn Onkel Adrian hielt die Jalousien Tag und Nacht geschlossen. Was für grässliche Gemälde da an den Wänden hingen! Was für unheimliche Dinge in dem kleinen Glasschrank standen! Das Schlimmste war jedoch eine wächserne Hand, die auf einem Tischchen lag. Als Kathy den Kopf durch die Türspalte steckte, begann diese Hand plötzlich im Kreis herumzurucken wie eine Kompassnadel, bis der ausgestreckte Zeigefinger genau auf Kathy wies. War es wirklich eine wächserne Hand gewesen? Später hatte sie sich einzureden versucht, es sei irgendein Automat gewesen, ein mechanisches Spielzeug – aber die Hand hatte wie eine lebende menschliche ausgesehen!
Seit der Zeit war sie dem Onkel aus dem Weg gegangen, wenn er nach Boston kam, und war froh gewesen, als er die Stadt verließ und nach Neu-England zog, in das seltsame Städtchen am Meer, um dort zu heiraten und sich im Schoß seiner neuen Familie mit Inbrunst seinen okkulten Studien zu widmen. Von ihm gehört hatte sie dennoch immer wieder, teils weil andere Familienmitglieder ihr erzählten, mit welchen hämischen und arroganten Briefen er sie, die Unerleuchteten, bedachte – teils auch, weil seine Bücher große Erfolge wurden und immer wieder Berichte über ihn in illustrierten Magazinen oder auch im Fernsehen erschienen. Obwohl Kathy inzwischen zwanzig Jahre älter war, durchschauerte sie beim bloßen Anblick eines Fotos noch immer dasselbe Grauen, das sie damals im Flur vor seinem Zimmer empfunden hatte. Denn weil das Böse, wenn es einmal Wurzeln geschlagen hat, wuchert wie Efeu, war es Onkel Adrian mit jedem Jahr deutlicher anzusehen, was in seinem Inneren hauste. Die finsteren und abwegigen Forschungen, die er in der magieverseuchten kleinen Stadt am Meer betrieb, hatten ihn gezeichnet. Sein Gesicht war verkniffen, sein Blick glühte in einem unheiligen Feuer. Den Mann hatte etwas Grauenhaftes umgeben, eine Aura, die einem den Atem nahm. Einem normalen Menschen war es unmöglich, sich längere Zeit in seiner Gesellschaft aufzuhalten. Selbst die hart gesottenen Fernsehreporter hatten nicht verbergen können, wie unwohl sie sich in seiner Nähe fühlten.
Wenigstens über die Bestattung ihres ungeliebten Verwandten hatten sie sich nicht den Kopf zerbrechen müssen. Für die waren alle nötigen Anordnungen in seinem Testament getroffen worden, wie der Notar ihnen mitgeteilt hatte. Aber das war auch schon alles gewesen. Sie wussten nicht einmal genau, woran er eigentlich gestorben war, und ob das Begräbnis bereits stattgefunden hatte oder noch bevorstand.
Sie erinnerte sich, wie sie zum ersten Mal den Brief des Notars gesehen hatte, dieses kurze und erstaunlich nichtssagende Schreiben, das die Mitteilung von Adrian Petris Tod enthielt und den Hinweis, sein Stiefsohn Cyril stünde nun völlig allein in der Welt.
Cyril.
Vor zwei Jahren hatte er seine Mutter verloren, und nachdem nun auch sein Stiefvater gestorben war, war er, elf Jahre alt und völlig allein in der Welt stehend, auf die Barmherzigkeit einer fernen Verwandtschaft angewiesen. Einer Verwandtschaft, die ihre Christenpflicht nur widerwillig wahrgenommen hatte.
Sie erinnerte sich an die Debatten unter Onkel Adrians Verwandten, die dieser Nachricht gefolgt waren.
Ich bitte dich, was kann das Kind dafür, wie sich Adrian benommen hat? Elf Jahre! Du weißt nicht einmal, ob sie dort irgendwie darauf eingerichtet sind, elternlose Kinder zu versorgen, es ist doch so ein entsetzliches Kaff.
Ich finde es überaus geschmacklos, dass man von uns erwartet, ein Kind dieser Person bei uns aufzunehmen. Die Tatsache, dass Adrian an solchen Leuten Gefallen gefunden hat ...
Du vergisst, dass er Schriftsteller war. Er fühlte sich fasziniert von der Atmosphäre dieses Ortes, von der Bevölkerung ...
Das ist in meinen Augen noch lange kein Grund, eine Person wie Marjorie Rogamer zu heiraten und ihr Kind bei sich aufzunehmen. Ich hoffe, das ist euch klar, dass es nicht einmal Adrians Kind ist. Wenn Jerome meint, wir müssten uns darum kümmern, dann sollte jedenfalls festgehalten werden, dass wir keine gesetzliche Verpflichtung dazu haben.
Zuletzt hatten sie sich, mit der plötzlichen allgemeinen Übereinstimmung, mit der solche Debatten zuweilen enden, auf die Lösung geeinigt Cyril abzuholen und dafür zu sorgen, dass er bis zu seiner Großjährigkeit auf irgendeine Weise angemessen gekleidet, ernährt und unterrichtet wurde. Es war zweifellos ein Werk der Barmherzigkeit, und wer von ihnen war für gute Werke prädestiniert? Jerome, der Pfarrer einer evangelischen Gemeinde war, und Kathy, die ihm als seine Frau jederzeit unentgeltlich beizustehen hatte. Kathy seufzte. Sie konnte sich selbst von der Sünde der Lieblosigkeit nicht völlig freisprechen. Sie hatte sich bereit erklärt, Cyril abzuholen, weil sie hoffte, damit ihren Teil getan zu haben und nicht mit weiteren guten Werken belastet zu werden. Auch wenn es sich nur um ein Kind handelte, sie wollte nichts mit den Leuten zu tun haben, mit denen sich Onkel Adrian versippt hatte – den Kalmans, den Rogamers, den Zorans, den Malchus´, den Jordans und den anderen alten Familien der Stadt. Allein, dass sie seine Freunde gewesen waren, bedeutete ihr Grund genug, ihnen aus dem Wege zu gehen.
Jerome hatte nicht verstanden, warum sie sich „so ängstlich anstellte“. Die Verpflichtung zu christlicher Liebe in Verbindung mit einem furchtlosen, optimistischen Gemüt hatte bei Pfarrer Belham dazu geführt, dass er immer geneigt war das Beste von anderen Menschen zu denken. Es brauchte sehr handfeste Beweise, um ihn zu überzeugen, dass ein Schurke tatsächlich ein Schurke war. Ihre Erinnerung an Onkel Adrians gespenstische Verwandlung hatte er als optische Täuschung abgetan, ihre warnenden Träume als Schäume. Und ja, die Vorliebe des Schriftstellers für abseitige, morbide Kulte war definitiv unchristlich gewesen, aber er war ja nun tot, und das Kind konnte nichts dafür, dass es aus einer verrotteten Familie stammte.
22. Juni, abends
Die Reise war lange und ermüdend gewesen, obwohl die Belhams einen Eilzug genommen hatten. Es war mittsommerlich heiß, und je näher sie den Salzmarschen und dem Meer kamen, desto schwüler wurde es, sodass selbst in den klimatisierten Waggons die Luft zum Schneiden stand. Noch schlimmer war es auf der Nebenstrecke, auf der ein aus nur zwei Wagen bestehender Zug träge dahinzuckelte und bei jedem Maulwurfshaufen hielt. Als sie dann endlich, schon bei Sonnenuntergang in der Station ankamen, mussten sie feststellen, dass sich das Städtchen in beträchtlicher Entfernung vom Bahnhof befand, also nahmen sie ein Taxi.
Die Straße war so unerfreulich, wie der Pfarrer und seine Frau befürchtet hatten. Sie führte weiterhin durch die öde Landschaft, die sie in den letzten zwei Stunden vom Zug aus gesehen hatten. Die dunkelnden Wiesen waren rundum mit dem Auswurf der Stadt besät. Ein Autobus ohne Räder stand in einem Haufen von zerschrammtem Gerümpel, von alten Metallmöbeln, Geräteteilen, zertrümmerten Schaltanlagen, verrosteten Fenstergittern und verbeulten Karosserieteilen. Das schwindende Sonnenlicht flammte düsterrot auf dem heißen Metall. Zuweilen begannen unmittelbar am Straßenrand die ölig schillernden, violetten Sümpfe, sodass der geringste Fahrfehler sie mittenrein in den Morast befördert hätte. Durch das spaltbreit offene Fenster zog ein säuerlicher Geruch nach verfaulendem Holz und verrottenden Pflanzen herein. Eine erstickende Schwüle stieg davon auf.
„Da vorne ist es“, sagte der Taxifahrer nach etwa fünf Meilen und wies mit ausgestreckter Hand in die Dämmerung. Tatsächlich blinkte kurz darauf im Licht der Scheinwerfer eines der üblichen Ortsschilder auf. Darauf stand der gebräuchliche Name der Stadt, aber er war mit dicken, blutroten Spray-Strichen ausgekreuzt und durch ein wunderliches Gekritzel ersetzt worden. Vielleicht die Signatur eines Sprayers, denn mit menschlicher Schrift hatte es keine Ähnlichkeit. „Sie haben hier wohl geschäftlich zu tun?“, wollte der Fahrer wissen.
„Wie kommen Sie darauf?“
Der Mann lachte. „Na, ich kenne niemand, der zur Erholung in das miese Kaff fahren würde. Die Leute hier sind ein eigener Schlag – ich sage immer, die fressen das, was sie auf der Straße überfahren haben! Wer nicht unbedingt hier sein muss, lässt es bleiben. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf: Laufen Sie nachts nicht auf der Straße herum. Gehen Sie in Ihre Zimmer und sperren Sie die Tür von innen ab.“
Jerome, der an die Sitzbank gelehnt döste, brummte nur, als er diese beunruhigende Mitteilung hörte, aber Kathy fröstelte heftig. Der Gedanke kam ihr, ob es in dieser Stadt genügen würde, die Tür abzusperren – ob hier nicht Gefahren auf sie warteten, für die eine verschlossene Tür kein Hindernis war. Die Abendnebel, die von den Marschen hereinwehten, schienen gesättigt mit einer unsichtbaren, aber deutlich spürbaren Bedrohung, als ritten Geister auf flüchtigen Pferden. Sie versuchte sich einzureden, dass es nur die ungewohnte und nach dem Trubel von Boston unheimlich lautlose Landschaft war, die ihr Angst machte, aber sie konnte sich selber nicht täuschen. Sie wusste, dass ein Fluch über der kleinen Stadt lag, denn Onkel Adrian hatte sie um dieses Fluches willen zu seiner neuen Heimat gemacht. Er hatte einen Ort gesucht, an dem das Böse zu Hause war, und hier hatte er ihn gefunden.
Wenig später mündete die Landstraße in eine Hauptstraße, die sich, zuweilen gefährlich verengt, zwischen den Häusern hindurchzwängte. Es mochte an dem Wechsel von der unbeleuchteten Landstraße zu den illuminierten Gassen der Stadt liegen, dass es Kathy erschien, als tauchten sie in eine riesige Blase merkwürdig violetten Lichts, die sich wie eine Dunstglocke über die Dächer breitete, und zugleich mit dem Licht in eine Art gelatinöser Substanz, die sich unsichtbar, aber deutlich fühlbar bis ins Innere des Wagens ergoss. Sie rang einen Moment lang nach Atem, erschreckt von dem Gefühl, dass die Atemluft immer weniger würde. Aber was es auch war, ihren Lungen tat es keinen Schaden. Sie konnte weiter atmen wie bisher. Dennoch wurde sie die Empfindung nicht los, dass die Luft in dieser Stadt, die außer einer Fischkonservenfabrik keinerlei Industrie aufwies, von einem beklemmenden Smog durchwirkt war, ärger als ein Wald rauchender Schlote ihn hervorrufen konnte. Einem Nebel, der sich wie ein klebriger Schmer auf ihre Gedanken und Empfindungen legte.
Es ist nichts, versuchte sie sich selbst zu trösten. Es ist nur eben sehr heiß, und mit der vielen Feuchtigkeit hier ist es schwül, und ich bin müde von dem langen Sitzen und Aus-dem-Zugfenster-Starren. Und außerdem ist mir diese ganze Reise von Herzen zuwider.
Die Stadt – eigentlich nur eine größere Ortschaft – musste einmal sehr hübsch gewesen sein, war aber längst verblüht und machte denselben peinlichen Eindruck wie Vergnügungsparks im Winter und Nachtklubtänzerinnen im hellen Tageslicht. Ihre Gebäude waren aus den Fugen geraten durch den unbarmherzig nagenden Ansturm der salzigen Winde, die über die Marschen brausten, und von allem Lack des Wohlstandes entblößt. Die Häuser hatten hohe schmale Fenster mit geschweiften Oberlichten und Balkone, so schmal wie Fenstersimse. Von den farbigen Gittern davor war der Lack abgeblättert, und das rostige Eisen starrte darunter hervor. Das Scheinwerferlicht glitt über etwas, das wie das anatomische Präparat einer Palme aussah, braun, verdorrt, verkrüppelt. Es stand in einem vergoldeten Übertopf auf einer windschiefen Treppe.
Zu der allgemeinen Verwitterung kamen Schmutz und Verwahrlosung. Die Mauern waren verschandelt von grellen Plakaten, die die Ankunft einer Rockband mit dem wenig ansprechenden Namen „Die Krüppelbande“ ankündigten, und die Straße war glitzernd gefleckt von windverwehten Stanniolpapierfetzen und zersplittertem Glas. Kathy Belham warf einen Blick auf ihren Ehemann, der neben ihr döste. Selbst jetzt, wo er mit halb offenem Mund gedämpft schnarchte, war er eine eindrucksvolle Erscheinung: ein großer, auffallend gut aussehender Mann mit dickem weizenblondem Haar, in das sich erste Strähnen von Grau mischten, und graublauen Augen. Ein längst vergangener Unfall, der ihn fast ein Auge gekostet hätte, hatte eine scharfe waagrechte Narbe wie einen Säbelschmiss auf dem Jochbein hinterlassen.
Beneidenswerter Jerome, dachte Kathy, der überall schlafen konnte! Sie war froh, dass er mitgekommen war. Nach dem ersten Blick auf das Städtchen war ihr klar geworden, dass sie hier dringend jemand brauchen würde, der sie aufheiterte. Alles in diesem Winkel Neu-Englands atmete Depression. Und es war nicht die milde Melancholie einer Stadt, die ihre besten Tage längst hinter sich hatte, sondern eine feindselige Verkrochenheit, etwas Finsteres und Verschlagenes, wie übellaunige alte Menschen es an sich haben – Menschen, die in ihrem Leben viele böse Geheimnisse angesammelt haben.
„Na, Ihr Mann ist ja wenigstens ein kräftiger Bursche, der Sie beschützen kann“, bemerkte der Fahrer und sprach damit genau das aus, was Kathy selbst soeben gedacht hatte. „Aber wie gesagt: Bleiben Sie nachts auf Ihrem Zimmer. Hier gehen ungute Dinge vor. Vor allem jetzt, so kurz vor dem Sommerfest! Das ist die schlimmste Zeit im Jahr. Zum Glück haben Sie keine Kinder mit, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen!“
„Was meinen Sie?“, fragte Kathy erschrocken, denn da kam ihr der Gedanke, dass sie in Kürze ein Kind bei sich haben würden. „Ist das Sommerfest denn so obszön, dass man Kinder davon fernhalten muss?“
„Sie könnten froh sein, wenn es nur das wäre, Lady. Nun, da Sie ohnehin allein mit Ihrem Mann hier sind, kann ich es Ihnen ja sagen. Das Sommerfest hat einen schlimmen Ruf, weil es früher ... in den alten Zeiten, verstehen Sie ... zu Ehren von irgendeinem Teufel gefeiert wurde, dem Plumpsack, wie sie ihn nennen. Es wird erzählt, dass sie diesem Teufel zu Ehren sogar Kinder im Sumpf ertränkt hätten. Alle die alten Familien der Stadt hatten dabei ihre Hände im Spiel, die Rogamers, die Kalmans, die Malchus’, die Zorans. Alle. Manche Leute behaupten ja, dass es auch heute abseits des normalen Sommerfestes noch immer ziemlich schlimm zuginge. Unbestrittene Tatsache ist, das können Sie auch in den Zeitungen nachlesen, dass zur Zeit des Sommerfestes immer wieder Kinder verschwanden. Spurlos. Die Einheimischen behaupten, sie hätten sich im Sumpf verlaufen und seien ertrunken, aber es gibt auch Leute, die anderer Meinung sind. Und man fragt sich ja: Warum verschwinden ausgerechnet immer zur Zeit des Sommerfestes Kinder?“
Kathy lauschte mit wachsendem Entsetzen. „Aber es ist doch undenkbar, dass heute noch jemand Kinder opfert!“
„So, meinen Sie? Das mag sein, wie es will; ich jedenfalls habe meine Frau und meine Kinder schon vorige Woche nach Boston geschickt, und morgen bin ich auch weg, da kann der Boss toben, wie er will.“
„Sie haben ernstlich Angst um Ihre Kinder?“
Der Fahrer schien jedoch zu denken, dass er bereits zu viel gesagt hatte. Er grunzte nur und tat, als müsse er sich völlig auf den Verkehr konzentrieren, obwohl die Straßen fast leer waren.
An der Einmündung eines Kanals, der wohl die Marschen entwässern sollte, stießen sie auf eine Gruppe von verwahrlosten alten Häusern, um deren Fundamente das Wasser gurgelte. Es waren sechs oder acht Gebäude, unter der summarischen Bezeichnung „Im Luch“ zusammengefasst, die die Künstlerkolonie des Städtchens beherbergten. Kathy wusste davon aus den gelegentlichen innerfamiliären Berichten über Onkel Adrians Tun und Treiben, denn so sehr man ihn auch verabscheute, waren seine Verwandten doch neugierig gewesen, und er hatte ihren Wissensdurst bereitwillig gestillt, schon um sie zu schockieren. Freilich war Kathy überzeugt, dass er ihnen alles andere als die ganze Wahrheit gesagt hatte, denn die Wahrheit über das Städtchen lag im Schoß der Familie Rogamer und ihrer Konsorten verborgen. Warum sonst hätte er in die verfluchte Sippe, die seit Jahrhunderten als Schwarzmagier verschrien waren, eingeheiratet! Nur ein zutiefst verdorbener Mensch konnte es wagen, sich in diese Familie zu drängen, die im übelsten Ruf stand. Als sie an dem quer über eine Gasse gespannten Transparent vorbeikamen, auf dem die Worte THRULE MALCHUS KUNST-ZENTRUM in halbmeterhohen Lettern zu lesen standen, überlief sie ein Schauder des Widerwillens, als hätte etwas Glitschiges ihren Nacken berührt.
Kunst-Zentrum!, dachte sie sarkastisch. Ein Zentrum der schwarzen Kunst war es. Hier, so behauptete Adrian Petri, hatte er die Antworten gefunden, die er suchte, hier hatte er die letzten Geheimnisse des Daseins enträtselt und das Elixier der Unsterblichkeit entdeckt. Was nichts daran änderte, dachte Kathy nicht ohne Häme, dass er jetzt kalt und steif in der Kühlhalle eines Bestattungsinstituts lag oder überhaupt schon unter der Erde.
Als sie sich dem Zentrum näherten, wurden die Straßen zusehends heller, obwohl sie immer noch nicht sehr vertrauenerweckend aussahen. Vor die Fassaden schoben sich, von Ziergittern eingerahmt, schmale Vorgärtchen, in denen „Brennende Liebe“ und „weißer Phlox“ blühten. In den Häuserreihen tauchten die Neonschilder von chinesischen Restaurants und die bunten Fenster von Selbstbedienungscafés auf. Das Schaufenster eines kleines düsteren Ladens war von zuckenden Lichtern erleuchtet. Darin hing eine graue Pappmaske neben der anderen, manche golden beflittert, manche mit langen spitzen Nasen wie Schneemänner, manche mit geringelten Papierlöckchen an den Seiten.
Kathy zog plötzlich die Nase kraus. Die Luft war eben noch von den Gerüchen einer Kleinstadt erfüllt gewesen, Gerüchen nach Blumen und Abendessen und von der Sommersonne überhitztem Asphalt. Das änderte sich mit einem Schlag. Ein scharfer chemischer Dunst hing in der Luft, so dicht, dass er bis ins Innere des Wagens drang. Sie rätselte noch, was es sein mochte, als der Fahrer ausrief: „Waren die Rotzmäuler schon wieder mit Stinkbomben unterwegs!“
Im selben Augenblick segelte von einem der dunklen Häuser etwas herunter, schnellte in hohen Froschsprüngen über die Straße und zerplatzte, Schwaden von gelblich schillerndem Rauch ausstoßend, wie ein riesiges Knallbonbon.
Der Fahrer stieg aufs Gas und schoss durch die Schwaden davon, bevor der würgende Gestank sie einhüllen konnte. Der Wagen quietschte, schlitterte und verschwand gerade noch rechtzeitig in einer der Seitengassen, als hinter ihnen schon das nächste „Knallbonbon“ explodierte.
Als er Kathys verdutztes Gesicht im Rückspiegel sah, wandte er sich halb um und bemerkte entschuldigend: „Ich sagte Ihnen doch, in drei Tagen ist das große Sommerfest, und ... na ja, Sie wissen, wie die jungen Leute sind.“ Die Einwohner des Städtchens, sagte er, hätten traditionell ein Faible für allen erdenklichen Mummenschanz, und es gäbe kaum ein Fest von der Kindstaufe bis zum Begräbnis, zu dem sie nicht in irgendeiner Verkleidung erschienen. Leute, die Masken-, Kostüm- und Zauberläden betrieben, konnten hier reich werden. Ihre Kunden zeigten ein nie erlahmendes Interesse an Juxartikeln jeder Art, ob es nun Gummispinnen waren, bengalisches Feuer, Zerrspiegel oder die winzige schwarze Dracula-Bank, aus der sich ein grünes Skelettchen erhob und die angebotene Münze entgegennahm. Sie liebten alles, was glitzerte, funkelte, krachte und unsinnigen Lärm erzeugte, mit einer Leidenschaft, dass man an jedem halbwegs bedeutsamen Feiertag die Knallfrösche heulen und Springteufel knattern hörte und Leute in Karnevalsmasken herumlaufen sah.
Sie nickte nur, zu müde, um das geringste Interesse an den Belustigungen der Stadt zu empfinden.
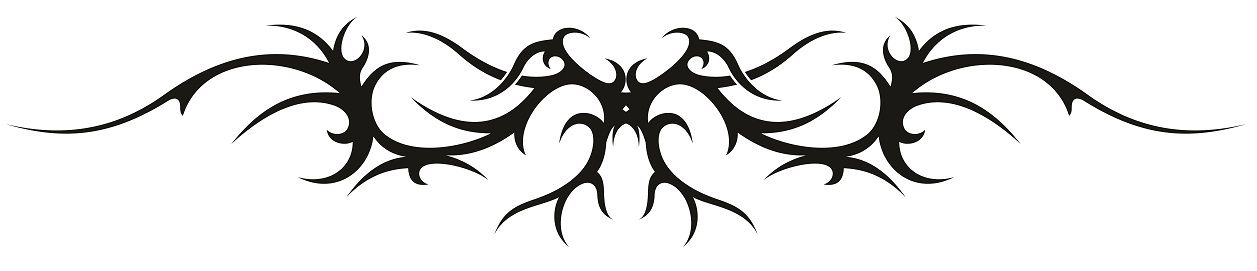
„Also, wie steht´s?“, fragte der Fahrer. „Soll ich Sie jetzt in ein Hotel bringen?“
Am liebsten wäre Kathy sofort in einem Hotelzimmer verschwunden, aber natürlich mussten sie sich als Erstes um Cyril kümmern. „Nein, fahren Sie in die Moorgasse, Nummer sieben. Wir müssen das Kind abholen.“
Der Fahrer drehte sich alarmiert mit einem Ruck um. „Ein Kind?“
„Ja, ein kleiner Junge. Deswegen sind wir hierhergekommen. Wir holen ihn zu uns nach Hause.“
Der Fahrer runzelte die Stirn. „Lady“, sagte er ernsthaft, „dann sollten Sie aber zusehen, dass Sie möglichst bald wieder abreisen. Wenn der Junge nämlich ... also wenn gewisse Leute Interesse an ihm haben, kann das für Sie ziemlich unangenehm werden. Die lassen sich hier nicht gern etwas wegnehmen.“
Als er ihr entsetztes Gesicht im Rückspiegel sah, fügte er lahm hinzu: „War nu so ´ne Redensart.“
Sie stiegen an der angegebenen Adresse aus. Jerome dehnte und reckte sich. Er hatte die gesamte Autofahrt verschlafen.
Der Notar hatte ihnen geschrieben, Cyril erwarte sie im Haus des Verstorbenen. Selbstverständlich hatten die beiden Belhams erwartet, ihn dort unter der Aufsicht von Verwandten vorzufinden, aber das Haus am Rande der Marschen, in dem Adrian Petri gewohnt hatte, war dunkel und machte einen völlig verlassenen Eindruck. Auf der Türschwelle lagen ein paar schmutzige Prospekte. Ein Fenster war eingeschlagen. Sie dachten schon, sie hätten die Anweisungen des Notars falsch verstanden, da tauchte ein mürrisch aussehender Mann mit einem Schlüsselbund auf und ließ sie ins Haus.
Es musste einmal ein prächtiges Gebäude gewesen sein, mit hohen luftigen Räumen und Verzierungen aus vergoldeter Stuckatur, aber es wirkte unsauber und verlassen. Obwohl Adrian Petri erst vor einer Woche verstorben war, herrschte in seinem Haus eine gruftartige Atmosphäre, als stünde es schon seit Jahren leer. Die Möbel wirkten verloren in den großen Räumen. Ein Schimmelgeruch hing darin, der verriet, wie vollgesogen mit dem schlammigen Salzwasser die Keller und Fundamente sein mussten.
Der Hausmeister drückte den Lichtschalter neben der Tür, aber mit erstaunlich dürftigem Resultat. Die meisten Glühbirnen waren aus ihren Fassungen geschraubt worden, sodass das Licht wie ein schwach fluoreszierender gelber Nebel in den Zimmern schwebte und kaum Einzelheiten enthüllte.
Der Hausmeister folgte ihnen auf Schritt und Tritt durch die Wohnung. Kathy ärgerte sich, dass sich niemand mit mehr Kompetenzen bereitgefunden hatte, sie zu erwarten, jemand wie eine Haushälterin oder Dr. Morlar, der Notar, von dem der Brief mit der Todesnachricht gekommen war. Der Hausmeister wusste nicht das Geringste über Adrian Petris Ende oder den Stand seiner Angelegenheiten, oder er wollte nichts sagen. Er hatte sich darauf beschränkt, auf Anweisung des Notars die Schlüssel in Verwahrung zu nehmen, das war alles, was sie aus ihm herausbekamen.
Kathy trat ans Fenster und blickte auf die Gasse hinaus. Einige Müßiggänger hatten sich vor dem Haus versammelt. Die junge Frau fühlte sich daran erinnert, dass sie sich in einer Kleinstadt befand, in der die winzigste Kleinigkeit, wie die Ankunft von Fremden, schon lebhaftes Interesse erweckte. Die Männer lehnten unter dem Leuchtschild eines Cafés und starrten, Zigaretten rauchend und Bier aus Dosen trinkend, zu den Fenstern hinauf. Fünf oder sechs Gestalten waren es, die im trügerischen Halblicht etwas eigenartig Verkrümmtes und Buckliges an sich hatten. Sie waren alle jung, aber ihre Gesichter hatten etwas undefinierbar Welkes und Greisenhaftes. Die Köpfe waren flach, die Arme unnatürlich lang. Die Augen schienen im Dunkeln zu leuchten. Sie wirkten eher wie Frösche, die auf zwei Beinen gingen, als wie Menschen. Als einer von ihnen die Frau am Fenster bemerkte, winkte er, die Zunge im Mundwinkel, mit einer frechen Geste zu ihr hinauf. Sie trat verärgert ins Zimmer zurück.
Jerome, der mit den Händen in den Taschen da stand, bemerkte: „Ich habe Hunger. Wir hätten zuerst essen gehen sollen.“
„Ich habe keine Ruhe, bis ich nicht weiß, wo das Kind ist.“
Kathy öffnete die Tür zu einem schmalen Nebenzimmer. Im ersten Augenblick fuhr sie erschrocken zusammen. Es war vollkommen still darin, aber von der bleiern glänzenden Fläche des Fensters hob sich eine menschliche Silhouette ab. Dann sah sie, dass es die eines Kindes war.
Cyril.
Er saß, die Hände auf den Knien verschränkt, in dem zwielichterhellten Raum auf einem sehr steifen Sofa und blickte ihr entgegen, ohne Anstalten zu machen, aufzustehen oder sie zu begrüßen. Neben dem Sofa auf dem Boden standen eine Reisetasche und ein Seesack.
Sie wandte sich gereizt an den Hausmeister. „Sagen Sie, sitzt das Kind am Ende seit Stunden hier allein im Finstern?! Kümmert sich niemand um ihn?“
Der Mann zuckte nur die Achseln.
„Jerome!“, rief sie. „Jerome, komm her, da ist Cyril.“ Sie streckte dem Jungen die Hand entgegen. „Komm mit ins Wohnzimmer.“
Er gehorchte stumm, ohne ihre Hand zu ergreifen.
Bei Licht betrachtet, war er ein unauffälliger, aber recht hübscher Junge, der den Babyspeck noch nicht völlig abgebaut hatte. Sein Haar war lockig und sehr hell, und er hatte blassblaue Augen. Er trug einen grünschwarzen Anzug von bäuerischem Schnitt, der eher zu einem bejahrten Zwerg als zu einem Kind gepasst hätte. „Hallo-hoo! Wo ist Cyril?“, rief Jerome quer durch die ganze Wohnung. Im nächsten Augenblick tauchte er im Türrahmen auf. Er warf einen Blick auf das Kind, hockte sich auf die Fersen nieder und streckte ihm lächelnd beide Hände entgegen. „Hallo, Cyril. Ich bin Jerome Belham. – Na, komm her.“
Der Junge schüttelte mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung den Kopf und wich einen Schritt zurück. Der angstvoll starre Ausdruck in seinen Augen veränderte sich nicht.
„Du meine Güte“, murmelte Jerome, der es gewohnt war, dass Kinder jauchzend auf ihn zustürzten. „Was hat er denn?“
„Er hat hier im Finstern gesessen. In der abgeschlossenen Wohnung“, erklärte Kathy. „Ich weiß wirklich nicht, was sich die Leute hier eigentlich denken! Deponieren ein Kind in einer dunklen Wohnung wie ein Postpaket! Wahrscheinlich hat er noch nicht einmal zu essen bekommen.“
„Da haben wir ja etwas gemeinsam.“ Jerome stand auf und lachte den Jungen an. „Weißt du, Cyril, was ich jetzt essen möchte? Pommes frites und Hühnernuggets mit Cocktailsoße, Käsetoast, und Limonade, und einen Milchshake. Und du?“
Cyril antwortete nicht, aber einen unbedachten Augenblick lang kam seine Zungenspitze zwischen den Lippen heraus und leckte einmal oben, einmal unten. Als Jerome ihm die Hand entgegenstreckte, kam er ängstlich, aber gehorsam herbei und legte sein kleines weiches Pfötchen in die kräftige Männerhand.
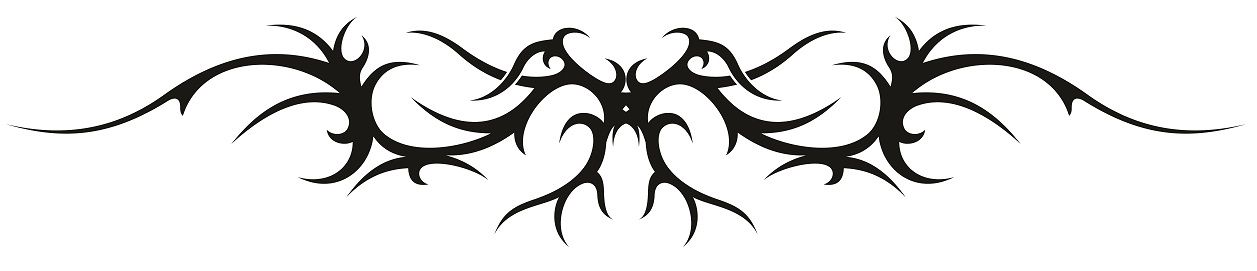
Sie hatten in einem Hotel auf dem Hauptplatz Zimmer vorbestellt, aber da es dort um diese Zeit keine Küche mehr gab und sich Jerome strikt weigerte, hungrig zu Bett zu gehen, machten sie sich auf die Suche nach einem Kiosk oder Straßencafé. Es war eine sehr späte Stunde für das Städtchen, dessen Häuser bereits von nächtlicher Stille umhüllt waren. Die Straßenlampen, die entlang der „Promenade“ – wie die Hauptstraße prätentiös benannt war – in engen Abständen brannten, strömten orangefarbenes Licht aus und tauchten, was in ihrem Bannkreis geriet, in einen gespenstig bleiernen Glanz. In schmalen Rabatten, die Bürgersteig und Fahrbahn trennten, blühten niedrige Rosenbüsche. Sie passierten eine Gruppe von Jugendlichen, die vor einem Kaffeehaus saßen und tranken. Sie wirkten im Zwielicht wie die Figuren auf dem Titelblatt einer verblichenen alten Illustrierten. Die Mädchen in vergilbt wirkenden, glänzenden Kleidern, an denen Strassbroschen steckten, die Hände und Arme in ellbogenlangen Ballhandschuhen, das hochtoupierte Haar silberrosa und wasserstoffblond gefärbt – die Männer in formlosen weißen und gelben Kunstfaseranzügen, trotz der Dämmerung riesige Plastiksonnenbrillen vor dem Gesicht. Kathy vermied es, sich nach ihnen umzudrehen, obwohl es sie drängte, sich zu vergewissern, dass sie richtig gesehen hatte. Die seltsame Mode mochte in diesem verlassenen Nest ja noch angehen, aber wann hatte sie jemals eine Gruppe von jungen Leuten gesehen, die in vollkommenem Schweigen dasaßen? Nicht einmal Taubstumme wären so still gewesen. Der absurde Gedanke kam ihr, dass sie sich telepathisch miteinander unterhielten. Sie beeilte sich, ein Stück Weges zwischen sich und die wachspuppenhafte Gesellschaft zu legen.
Kathy hatte sich, während sie schweigend dahintrabten (auch Jerome war jetzt müde, und von Cyril war kein Beitrag zur Unterhaltung zu erwarten), zunehmend Gedanken über den Jungen gemacht. Deprimierende Gedanken. Je öfter sie sein bleiches weiches Gesicht betrachtete, desto drängender wurde der Verdacht, er sei entweder beschränkt oder völlig verschüchtert oder beides. Er war immerhin elf Jahre alt, aber er zeigte nichts von dem fröhlichen Selbstbewusstsein dieser Jahre, die sich so glücklich zwischen die Unbeholfenheit des Kleinkindalters und die Qualen der Pubertät einfügen. Er schritt neben Jerome her wie ein kleiner Gefangener, den Blick seiner blassblauen Augen trübselig geradeaus gerichtet, einzig belebt von dem Gefühl, dass er Hunger hatte und dieser Hunger mit erfreulichen Dingen gestillt zu werden versprach.
Morgen, dachte Kathy, morgen kaufe ich ihm als erstes vernünftige Hosen und einen bunten Sweater statt dieses abscheulichen Anzugs.
Sie betrachtete ihn, und dabei bemerkte sie, dass Cyril zur anderen Straßenseite hinüberblickte. Im nächsten Moment hob er die freie Hand und winkte mit den Fingern, rasch und verstohlen, als wolle er nicht recht, dass sie es bemerkten.
In der öden Straße war nur ein einziges Lebewesen zu sehen, dem der Gruß gegolten haben konnte. Das war ein junger Mann mit einem bunten Samtbeutel über der Schulter, der in einiger Entfernung unter einer Straßenlampe stand. Seine ganze Erscheinung war so bunt, dass sie an Papageno in der „Zauberflöte“ dachte. Sie lächelte. Dann überkam sie einen Augenblick lang ein kribbelndes Unbehagen, ohne dass sie wusste, warum.
Der bunte Fremdling schlenderte langsam weiter, den Hügel hinauf, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Sie gingen weiter.
Es war immer noch sehr warm. Ein sanfter Wind wehte, der den Geruch von Tang und Fischen mit sich trug, und dann – endlich – auch den Duft von Köfti mit Zwiebelsenf und Frühlingsrollen und heißem Kaffee. Fast am Ende der „Promenade“, entdeckten sie eine noch offene Imbissbude, eine winzige Nische, die gerade zwei Tischen Platz bot. Außer dem Besitzer, einem müde und mürrisch aussehenden Mann mit aufgekrempelten Hemdsärmeln und einer fettigen, bodenlangen Schürze über den Jeans, war es leer.
Sein hoffnungsvoller Blick beim Eintritt von Gästen wandelte sich zu einer mürrischen Grimasse, als er sie als Fremde erkannte. „Ich wollte gerad eben schließen.“ Er illustrierte seine Worte damit, dass er das Licht über dem zweiten Tisch ausknipste. Aber es war deutlich zu sehen, dass er log, denn die Warmhalteplatten waren voll brutzelnder Würste, und auf dem Schneidebrett lag frisch gehacktes Gemüse.
Kathy, die außerordentlich hungrig und zudem müde war, reagierte mit einer Mischung aus plötzlichem Ärger und Nervosität, die ihrem sonstigen Wesen fremd war. „Könnten Sie nicht eine Minute warten? Wir waren stundenlang unterwegs und haben seit dem Frühstück nichts Ordentliches mehr gegessen. Wir sitzen schon nicht bis zum Morgengrauen herum.“
„Schon recht! Ich möchte eben auch ein Auge voll Schlaf kriegen“, brummte er. „Meinen Sie, ich habe heute nichts zu tun gehabt? Das geht den ganzen Tag hier. Da habe ich keine Lust, auch noch die ganze Nacht aufzubleiben.“
In der Art und Weise redete er weiter, aber Kathy glaubte ihm kein Wort davon. Nach einem Laden, in dem sich den ganzen Tag über die Leute die Klinke in die Hand gaben, sah der kleine Kiosk wirklich nicht aus. Eher schien es, als müsste der Besitzer für jeden Gast dankbar sein. Und dennoch hätte er sie am Liebsten hinausgeworfen, nur weil sie nicht zur geschlossenen Gesellschaft des Städtchens gehörten. Immerhin schlurfte er widerwillig zur Theke, warf eine Schaufel voll tiefgekühlter Pommes frites ins siedende Fett, schob Frühlingsrollen in den Mikrowellenherd und stellte die Kaffeemaschine an. Auf dem Rückweg schaltete er eine weitere Lampe aus. Es brannte jetzt außer der Arbeitsbeleuchtung hinter der Theke nur noch eine einzige Leuchte im ganzen Raum, die strohbeschirmte Lampe, die von der Decke hing. Wäre da nicht Jerome gewesen, der vergnügt auf den schweigsamen Cyril einschwätzte, wäre zu dem Zwielicht auch noch ein beklemmendes Schweigen gekommen. Kathy stützte den Kopf auf die Hand. Müde und übellaunig gab sie sich den Gedanken hin, die in verworrener Folge durch ihr Gehirn zogen. Der Mann mit der fettigen Schürze kam zurück und brachte Frühlingsrollen, Hühnchennuggets, Pommes frites, Zwiebelsenf, Gebäck und als Nachspeise zwei Milkshakes und einen Kaffee. Kathy stellte überrascht fest, dass Hühnchen und Frühlingsrollen heiß und knusprig waren, die Pommes frites goldbraun, die Milchshakes schaumig und fruchtig und der Kaffee heiß und stark. Nach dem eher trübseligen Äußeren der weiß gestrichenen, windzernagten Fassade und dem mürrischen Gesicht des Wirts hatte sie sich Schlimmeres vorgestellt.
Cyril wollte schon zugreifen, als Jerome ihm die Hand auf den Arm legte. „Einen Moment noch, Kleiner. Erst beten wir.“
Das Kind starrte ihn blinzelnd, mit offenem Mund an, als er die Hände auf der Tischplatte zusammenlegte und Gott in kurzen Worten für das Essen dankte. Kathy folgte seinem Beispiel, aber Cyril saß da, als wüsste er mit dem Geschehen nichts anzufangen. Nach dem Amen streckte er scheu und argwöhnisch die Hand aus und begann dann rasch zu essen.
Kathy und Jerome tauschten einen bedeutungsvollen Blick. Beide hatten ihre Erwartung bestätigt gefunden, dass in Adrian Petris Haus das Tischgebet nicht Brauch gewesen war. Cyril stopfte das Essen, für das er nicht gedankt hatte, gierig in sich hinein, so gierig, dass es ihn nach dem letzten Bissen laut aufstieß.
„Grunz, machte das Schweinchen!“, sagte Jerome und rülpste ebenfalls.
Kathy warf ihrem Ehemann einen verweisenden Blick zu. Und Cyril starrte ihn an, als habe er alles erwartet, nur nichts dergleichen. Seine blassen Lippen dehnten sich langsam zu einem Lächeln, aber als Kathy eben dachte, nun würde er lachen, zogen sich die Lippen wieder zusammen. Eine kleine Hand kam hoch, rieb verlegen die Nase und wischte das Lächeln weg.
Ihr wurde plötzlich bewusst, dass sie ihn noch kein Wort sprechen gehört hatte, und da sie müde und missgestimmt war, überfiel sie mit jäher Kälte die Angst, er könne vielleicht gar kein Wort sprechen. „Was möchtest du? Frühlingsrolle oder Hähnchen?“, fragte sie.
Erleichtert stellte sie fest, dass Cyril über eine, wenn auch sehr scheue und leise, Stimme verfügte.
„Beides“, sagte er.
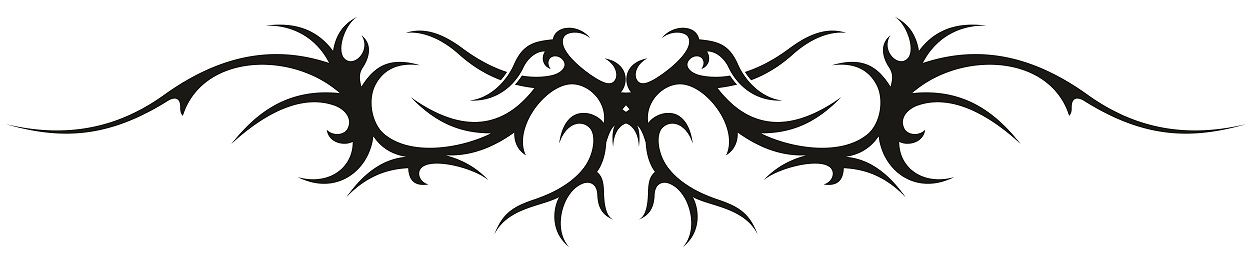
Sie wollte gerade einen Versuch machen, das Gespräch fortzusetzen, als ein weiterer später Gast hereinkam. Es war eben jener bunt gekleidete junge Mann, der zuvor unter der Straßenlaterne gestanden war.
Aus der Nähe besehen, hatte er ein hübsches Gesicht, dunkles Haar und einen sehr schmalen dunklen Bart um Oberlippe und Kinn. Er schlenderte herein, lehnte sich grußlos und stumm an die Theke, warf eine Münze hin, verlangte eine Dose Cola, indem er mit dem Zeigefinger darauf deutete, bekam es mit einem Strohhalm serviert und begann zu trinken.
Kathy betrachtete ihn mit einem Interesse, das einer inneren Unruhe entsprang. Sie hätte nicht sagen können, was an ihm ihr so absonderlich erschien – absonderlich über das Offenkundige hinaus, dass er an der Theke stand wie ein Fragezeichen, eine Hand auf der Hüfte, und dass er sehr exzentrisch gekleidet war. Er trug so enge Hosen, dass es, was die Sittlichkeit anging, auf das Gleiche herausgekommen wäre, hätte er gar keine Hosen getragen. Es sah aus, als wären seine Beine von den Knöcheln aufwärts schwarz lackiert. Darüber trug er ein loses weitärmeliges Oberteil aus einem orientalischen Material von so schwüler fiebriger Färbung und so krankhaft verschlungener Musterung, dass sie an die Blätter einer schönen giftigen Blüte erinnerte, und über diesem Oberteil noch einmal eine in zahllosen Rot- und Violetttönen schillernde Jacke aus Samt- und Seidenpatchwork, an deren Kragen er ein auffallendes Gesteck aus Vogelfedern befestigt hatte. Der alberne Gedanke drängte sich ihr auf, dass er einen Vogel gefangen und grausam gerupft hatte, um die Federn mit blutfeuchten Kielen an seine Jacke zu stecken.
Plötzlich zog er eine Zigarette aus der Jackentasche, klemmte sie zwischen die Lippen und kam zu ihrem Tisch herüber. Er beugte sich so weit vor, dass sein bis zu den Ohren reichendes dunkles Haar ins Gesicht fiel. „Haben Sie Feuer?“, wandte er sich an Jerome.
Der sah, aus seinen Gedanken gerissen, auf, begriff, was er gefragt worden war, und hob Bedauern ausdrückend beide Hände. „Ich bin Nichtraucher, tut mir leid.“
Kathy verglich unwillkürlich die beiden Gesichter, die der enge Lichtkreis der Lampe wie ein Scheinwerferspot hervorhob. Jerome war fast doppelt so alt wie der Fremde, und dennoch wirkte er neben ihm wie der junge Morgen. Nicht, dass die Zeit sein Gesicht völlig verschont gehabt hätte, man sah durchaus deutlich, dass er kein Jüngling mehr war. Aber seine Augen waren klar, auf seinen Zügen glänzte der Widerschein des simplen Vergnügens, gut gegessen zu haben, über seiner ganzen Erscheinung lag die milde Ruhe eines Menschen, der sein Gewissen rein und seinen Gott gnädig weiß. Im Gesicht des bunt gekleideten jungen Mannes war nichts von alledem zu finden.
Er nahm seine Zigarette aus dem Mund und steckte sie in die Schachtel zurück. Im gleichen Ton wie zuvor fragte er: „Können Sie mir einen Zwanziger leihen?“
Jerome lächelte sein Sommersonntagslächeln. „Nein.“
Das Gesicht des Fremden (Kathy bemerkte, dass es ein sehr bleiches Gesicht war) änderte seinen Ausdruck auf diese Abweisung hin keinen Deut. „Sie sind wunderschön“, sagte er.
Jerome hörte dergleichen gerne, auch wenn er es unter solchen eher ungewöhnlichen Umständen zu hören bekam. Er lächelte. Der Fremde erwiderte das Lächeln, aber auf eine kuriose Art, indem er wie eine Katze auf einer Seite die Oberlippe hochzog und die Eckzähne entblößte. Er setzte eben an, noch etwas zu sagen, als der Lokalbesitzer aus dem Hintergrund rief: „Jean-Marie, was hab ich dir gesagt?! Lass meine Gäste in Ruhe!“
Der junge Mann zog sich ein Stück zurück, schüttelte den Kopf, als habe er Spinnweben in den Augen, schob die Hände in die Taschen und schlenderte hinaus, ohne seine Cola zu trinken.
Jerome nahm den Zwischenfall nicht weiter ernst, er lachte auf, schüttelte den Kopf und biss in den letzten Rest seiner Frühlingsrolle, aber Kathy atmete auf. Ihr war zu Mute, als hätte sich eine schwere schwarze Wolke verzogen. Der Mensch hatte eine so böse, so giftige Aura um sich verbreitet, dass ihr beinahe übel geworden war. Sie warf einen raschen Seitenblick auf Cyril. Er saß steif da, seine Augen glänzten entzückt. Offenkundig hatte er den Auftritt des Fremden genossen.
Kinder schienen immer alles zu genießen, was anderen Leuten peinlich war.
Die Lumpensuppe
Es ging auf zehn Uhr abends, als sie den Kiosk verließen. Kathy war so erschöpft von der langen Reise und dem ungesund feuchten Klima der Marschen, dass ihr die nächtliche Szenerie immer wieder vor den Augen verschwamm, und so dachte sie im ersten Augenblick an eine optische Täuschung, als sie die Gestalt entdeckte.
Es war auf jeden Fall kein Mensch, denn es hatte ein einziges spindeldürres Bein genau in der Mitte des Körpers. Es sah wie eine riesige Vogelscheuche aus, aber wie kam eine Vogelscheuche auf eine Baulücke zwischen zwei Häusern?
Als sie neugierig nähertrat, erkannte sie in der übermannshohen dunklen Gestalt eine Art Halloween-Monster. In einer großen Blechdose, in der einmal zehn Pfund süßsaure Gurken geliefert worden waren, war eine Stange einzementiert, und diese bildete das Gerüst einer tonnenförmigen, grotesk ausgebauchten Figur, die wie eine Schneiderbüste auf ihrem Ständer dastand. Den Kopf stellte eine feste Pappkartonschachtel dar, in die Augen, Mund und Nase geschnitten waren. Was Kathy verblüffte, war die Sorgfalt, mit der der feiste Popanz bekleidet und geschmückt war. Das Licht der Straßenlampen brach sich in unzähligen Spiegelchen, mit denen seine rotbunte Kleidung wie das Kostüm eines Harlekins benäht war, und in den Perlen und Plättchen von billigem Schmuck, die daran hingen. Lange Korkenzieherlocken aus weißem Papier pendelten – wie die Perücke eines englischen Richters – vom Rand der Pappkartonschachtel herab.
Kathy wandte sich an Cyril, der als Einheimischer wohl Bescheid wissen musste. „Kannst du uns sagen, was das ist?“
Er hob langsam den Blick, und sie hatte den Eindruck, dass er alle Buchstaben seiner Antwort einzeln zusammensuchte, so lange dauerte es, bis er die beiden Worte hervorbrachte. „Der Plumpsack.“
„Ein was?“
„Plumpsack. Fürs Sommerfest.“
„Ach so.“ Merkwürdige Belustigungen brachte dieses Sommerfest mit sich!, dachte Kathy. Dann fiel ihr ein, was der Fahrer gesagt hatte: „Die Leute entführen Kinder und opfern sie dem Moorteufel – dem Plumpsack, wie sie ihn nennen.“ Ein kalter Schauder lief ihr über den Rücken. Das war doch sicher nur ein Aberglauben, oder? Selbst in dieser widerwärtigen Stadt würden die Leute nicht im Ernst daran denken, irgendeinem scheußlichen Dämon kleine Kinder zu opfern?
Sie kehrten zur Straße zurück. „Weißt du mehr über den Plumpsack?“, fragte sie, von innerer Unruhe erfüllt. Sie wollte eine Antwort haben, und doch fürchtete sie sich davor sie zu bekommen – vor allem, sie von Cyril zu bekommen. Kinder sollten von solchen Dingen nichts wissen.
Er gab jedoch keine Antwort. Er trabte ein Stück vor ihnen her, ohne sich um sie zu kümmern, wobei er wie ein Mensch, der Selbstgespräche führt, den Kopf von einer Seite zur anderen bewegte. Es dauerte eine Weile, bis Kathy bemerkte, dass er während des Gehens mit kleinen unbeholfenen Bewegungen die Hände ineinander schlug und leise vor sich hinsang. Sie verstand die Worte nicht, aber sie hatten einen seltsamen und irgendwie beunruhigenden Klang.
Sie schlenderten hinter dem Jungen her, der im Gehen von einem Bein aufs andere hüpfte und immer noch sein Lied sang. Und plötzlich konnte Kathy auch die Worte verstehen, soweit man unsinnige Worte verstehen kann. Cyril schlug die Hände einmal links, einmal rechts zusammen, als webe er in der leeren Luft, und dabei sang er mit seiner kleinen monotonen Stimme immer wieder denselben Reim oder Spruch: „Thrule Malchus, Thrule Malchus, erce erce gorgoroth.“
„Was singst du da für dummes Zeug?“, fragte sie scharf. „Hör auf mit dem Unsinn!“ Sie hatte nicht vorgehabt unfreundlich zu Cyril zu sein, aber der Gesang ging ihr auf die Nerven. Sie war erleichtert, als der Junge schwieg.
Jerome fragte leise: „Warum schreist du ihn so an? Du wirst ihn noch völlig verschüchtern.“
„Ich erkläre es dir, wenn wir allein sind.“
22. Juni, nachts
Kathy war froh, dass sie im „Golden Flower Inn“ gebucht hatten, das einer landesweiten Hotelkette gehörte und mit seinem importierten Personal wohl nicht völlig unter dem bösen Bann stand. Es war zwar eine etwas welke Blüte im goldenen Strauß, aber immerhin sauber, modern und auch von der Atmosphäre her weitaus weniger drückend als alles, was sie bis jetzt von der Stadt gesehen hatte. Ihr Zimmer erwies sich als ein großer, billig, aber ordentlich möblierter Raum, dessen einziges Fenster auf ein Vordach und darüber hinaus auf die Feuerwache des Städtchens hinausging. Außerhalb des Lichtkreises der einzelnen Lampe, die vor der Feuerwache brannte, huschten Schatten vorbei.
Langbeinige, krummrückige Schatten.
Kathy fuhr sich über die Augen. Ihre Müdigkeit begann offenbar, ihr die dümmsten Streiche zu spielen. Es war wirklich an der Zeit, dass sie ins Bett kam.
Ein großes Doppelbett bot Platz für das Ehepaar, eine Couch nahm Cyril auf. Erschöpft von den Aufregungen des Tages und dem überreichlichen Abendessen schlief der Junge ein, noch bevor sie das Licht gelöscht hatten.
Auch Jerome fiel in Schlaf, wie ein Stein in einen Brunnen fällt, aber Kathy konnte trotz ihrer Müdigkeit nicht einschlafen. Sie hätte gerne mit ihrem Mann darüber geredet, was der Fahrer gesagt und was er verschlafen hatte, und dass der groteske Popanz auf seinem Spindelbein eine sinistre Bedeutung hatte und Cyril Liedchen sang, die keine Kinderlieder waren. Es gab für sie keinen Zweifel mehr, dass die alten Kulte, deren Erforschung sich Adrian Petri mit solchem Eifer gewidmet hatte, in diesem morschen Städtchen noch sehr lebendig waren. Vor der letzten Konsequenz dieser Überzeugung scheute sie freilich zurück. Menschen, die einem Sumpfdämon Kinder opferten – gab es die im 21. Jahrhundert wirklich noch? Nein, gewiss nicht. Vermutlich war das Sommerfest mit seinem gottlos wüsten Getriebe nur noch ein Volksbrauch, dessen eigentlichen Ursprung man längst vergessen hatte, die leere Hülle vergangener Bacchanalien zu Ehren eines finsteren Götzen.
So versuchte sie sich selbst zu trösten, aber ihr Herz wusste es anders. Cyril war in Gefahr, und es gab niemand außer ihr selbst und Jerome, der ihn retten konnte.
Schließlich überwältigte sie die Erschöpfung und sie schlief ein. Wieder quälten sie die verzerrten Bilder vergangener Ereignisse: Die Verwandlung im Flur – die wächserne Hand – die haarigen Hände des Mannes, die sich manchmal wie von selbst bewegten und kuriose, abstoßende Gebärden machten. Dann, mit dem abrupten Wechsel der Szenerie, der Träumen eigen ist, stand sie am Rande der Stadt hinter Onkel Adrians Haus. Tiefe Dunkelheit hing über allem. Da zuckte plötzlich ein Blitz auf, schwebte, sekundenlang alles rundum erhellend, über ihr. Zu ihrer Rechten glitzerten bösartig die Wasserlachen der Sümpfe, und in der Ferne vor sich sah sie den ungesunden Schimmer der weiten Salzmarschen, über denen Scharen von Leuchtkäfern schwebten. Vor ihr stand, ganz in Rot gekleidet und mit einer steifen Mütze auf dem Kopf, der verstorbene Schriftsteller, und hinter ihm wälzte sich etwas auf der Erde herum, das nicht Mensch und nicht Tier war. Plötzlich tauchte hinter ihrem Rücken Cyril auf und lief auf Onkel Adrian zu. Kathy wollte schreien, wollte ihm eine Warnung zurufen. Aber der Junge hörte nicht! Er lief weiter – und schon hatte der Mann ihn gepackt und in einen großen Sack gesteckt. Das Kind schrie und strampelte. Ein neuer Blitz zuckte auf. Ein böses Lächeln der Befriedigung erhellte das wachsbleiche Gesicht des Nekromanten, das allein sichtbar blieb, vor ihr im Dunkel schwebend wie eine Maske im Nichts.
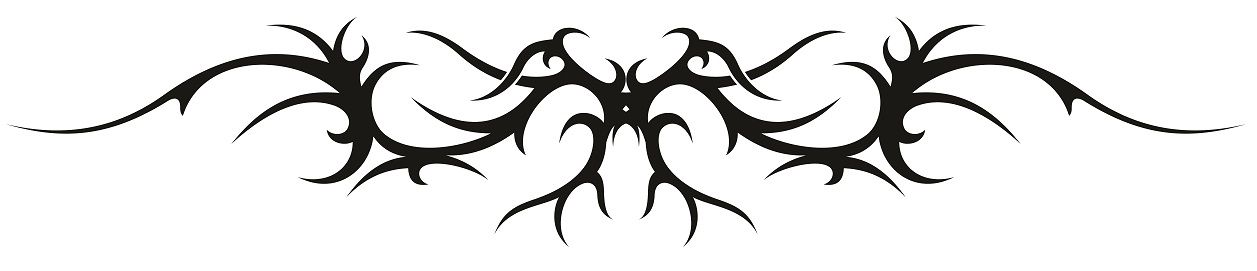
Sie erwachte, schwitzend und zitternd von den Schrecken ihrer Träume. Ängstlich bemüht, Jerome nicht zu wecken, setzte sie sich auf und trocknete sich mit einem Taschentuch das feuchte Gesicht. Da fiel ihr Blick aufs Fenster – und bevor sie den Aufschrei hinter der vorgehaltenen Hand ersticken konnte, fuhr er ihr heraus.
Durch das Fenster, frei im Raum schwebend, glotzte ein Gesicht – ein rundes weißes Idiotengesicht mit starren Augen und starrem Grinsen.
Kathy spürte, wie ihr das Herz im Hals schlug. Eine jähe kalte Welle von Übelkeit überlief sie, und es begann ihr vor den Augen zu flimmern. Sie sprang aus dem Bett und schlüpfte in ihren Schlafrock.
Dann wurde ihr Blick klar. Sie sah noch einmal hin, und nun entdeckte sie im grauen Halblicht den Stecken, auf dem dieses fratzenhafte weiße Gesicht saß.
Sie ballte die Fäuste, heiß von jähem Zorn durchflutet. Jetzt war es deutlich zu sehen. Ein dicker Kürbis grinste da zu ihrem Fenster herein – und von der Straße unten drang gedämpft das gackernde Lachen von Halbwüchsigen herauf.
Sie riss das Fenster auf. Das Gesicht verschwand, rollte über die dunkle Straße davon, während unten eine Hand voll finsterer Gestalten in langen Sätzen davonstoben. Die salzgeschwängerte Luft der Marschen wehte herein, vom kühlen Wind der Nacht getragen.
Kathy schloss das Fenster wieder. Immer noch innerlich zitternd, kehrte sie langsam zum Bett zurück.
Dummejungenstreiche, dachte sie. Billige Bosheiten, wie sie einem überall begegnen konnten.
Aber hier war mehr als Bosheit.
Hier war Böses.
Sie verschränkte die Arme hinter dem Nacken und versuchte sich wenigstens zu entspannen, wenn sie schon nicht wieder einschlafen konnte. Es würde nicht mehr lange dauern, bis sie ohnehin aufstehen musste. Sie beruhigte sich allmählich und schlief ein, aber ihren Schlaf störte ein weiterer Albtraum.
Sie träumte, dass sie erwachte, weil ihr im Bett zu heiß wurde. Hinter den bauchigen Fenstergittern dämmerte es. Der Himmel wechselte von Schwarz zu Blassgrün. Im Zimmer schien es jetzt dunkler als draußen. Sie kletterte steifbeinig aus dem Bett und schlurfte zum Waschbecken, um sich mit einem Guss kalten Wassers Gesicht und Arme zu erfrischen. Danach fühlte sie sich besser, ihr Kopf war klar, ihr Herz schlug wieder normal. Kathy stieß die beiden Fensterflügel auf und atmete, die Arme über den Kopf streckend, tief die kühle frische Luft des grauen Morgens ein.
Im nächsten Augenblick erstarrte sie mitten in der Bewegung.
Das Zimmer lag im ersten Stock des Gasthofs, aber jemand beobachtete es, als könnte er hineinsehen. Eine Person, die unter ihren Fenstern auf der Straße stand, so reglos wie eine Vogelscheuche im Acker – so reglos wie der einbeinige, bunt beflitterte Popanz, den sie auf ihrem abendlichen Heimweg gesehen hatten. Keinen Augenblick lang glaubte sie, dass da unten nur ein früher Gast oder ein verspäteter Nachtschwärmer stand, dazu sah der Mann zu absonderlich aus. Seine Züge waren plebejisch und gemein, sein Kopf dick, seine Lippen fleischig. Er hatte eine scharfe, schnabelartig gebogene Nase und dunkle, boshafte Augen. Sein Haar war stahlgrau und üppig gekräuselt. In der Linken hielt er mit einer steifen, gezierten Bewegung einen Stängel Fliegenwinde mit zwei großen Blüten daran, weiß und wächsern wie die Blüten der Kalla. Seine heisere Stimme drang ihr ans Ohr: „Bring das Kind heraus, Kathy! Bring mir das Kind! Es gehört mir! Zum Sommerfest will ich es haben!“
Kathy sah jeden Knopf seiner rotschattierten Kleidung, jede Linie der lilienartigen Blüten so deutlich, als stünde er in hellem Licht vor ihr. Sie meinte, schleimige Perlen in den Blumenkelchen zu sehen und ihren süßlich üblen Duft zu riechen. Eine volle Minute oder noch länger stand sie da und stierte den Unbekannten an wie das Kaninchen die Schlange. Sie spürte durch und durch, dass von dieser plumpen roten Gestalt eine Kälte ausging, dass es wie eine schillernde Aura um sie webte. Der Mann war fremd – völlig fremd in dieser Welt. Seine heisere Stimme drang erneut an ihr Ohr, drängender und drohender als beim ersten Mal: „Bring das Kind heraus, Kathy! Bring mir das Kind! Es gehört mir! Zum Sommerfest will ich es haben!“
Von der Uhr auf der Stirnwand der Feuerwache drangen rasche glockenhelle Schläge einer Uhr. Keine Geisterstunde – halb fünf Uhr morgens. Der Mann bewegte zum ersten Mal sein Gesicht. Seine Mundwinkel hoben sich zu einem maskenhaften Grinsen. Er bewegte sehr langsam die rechte Hand, bis sie sich in Höhe seines Gesichts befand, und begann wie ein Automat mit immer derselben steifen, ruckartigen Geste fordernd zu winken.
Kathy spürte, wie Übelkeit in ihr aufstieg und wandte den Blick ab. Sie spürte, wie dieses harte mechanische Winken sie wider Willen faszinierte, und ohne nachzudenken, was sie tat, packte sie den wassergefüllten Krug auf dem Nachttisch und schüttete das Wasser mit wildem Schwung hinaus. Es klatschte zu Füßen des Fremden in den Straßenstaub und benetzte seine Kleidung.
„In Namen Gottes, verschwinde!“, schrie sie.
Er fauchte wie eine Katze, aber er wandte den Blick seiner schrecklichen Augen nicht ab. Unbeholfen drehte er seinen dicken Körper, sodass Kathy das ekelhafte Gefühl hatte, der Blick dieser Augen wandere in ihrem Kopf herum und sei noch auf sie gerichtet, als er schon mit dem Rücken zu ihr stand – und dann watschelte er fort. Eine der weißen Blüten fiel vom Stängel ab und blieb auf dem Asphalt liegen.
Gleich darauf war er hinter der Feuerwache verschwunden.
Im selben Augenblick rief Jerome mit schlaftrunkener Stimme vom Bett her: „Was ist denn, Kathy? Mit wem schreist du so?“
Cyril – der erstaunlich wach war – wiederholte wie ein Echo: „Ja, mit wem schreist du?“
Vor dem Kind wollte sie nichts Näheres sagen, also kehrte sie zum Bett zurück und murmelte: „Nichts. Üble Kerle, die unten herumlungerten. Sie sind weg.“ Mit steifen Gliedern kroch sie unter die Decke. „Lass mich länger schlafen, Jerome, ich bin in der Nacht andauernd aufgewacht und brauche noch eine Mütze voll Schlaf.“
Jerome rappelte sich auf und blickte sie an. „Meine Güte“, sagte er. „Wie du aussiehst, brauchst du eine ganze Hutfabrik voll Schlaf! Na, schlummer noch weiter, Cyril und ich stehen schon einmal auf.“
23. Juni, tagsüber
Dr. Morlars Informationen
Kathy Belham erwachte gegen acht Uhr morgens, nicht mehr so zerschlagen, aber alles andere als frisch. Sie schlug die Augen auf und wusste einen Moment lang nicht, wo sie sich eigentlich befand. Ein fremder Spiegel in einem geschnitzten Rahmen reflektierte das Oberteil des Bettes und ihr vom Schlaf zerknittertes Gesicht. Sonnenflecken schimmerten auf einem fremden Fußboden.
Das Bild, das sie in der Nacht gesehen hatte, kehrte mit erschreckender Heftigkeit zurück. War es wirklich nur ein Traum gewesen? Aber was hätte es sonst sein können? Sie fing doch nicht etwa an Gespenster zu sehen?
Sie stand mit schlechtem Gewissen auf und beeilte sich mit Waschen und Anziehen. Dann lief sie hinunter in den Frühstücksraum des „Golden Flower Inn“.
Jerome saß am Tisch und löffelte genießerisch an seinen Weizenflocken mit Milch und Honig. Cyril hockte neben ihm und aß ebenfalls Weizenflocken. Sie schmeckten ihm nicht, er löffelte aber tapfer daran – offenbar, weil Jerome sie aß. Kathy lächelte in sich hinein. Jerome hatte eine eigene Gabe dafür, Kinder für sich einzunehmen. Cyril war, wie es aussah, bereits entschlossen, ihn in jeder Hinsicht nachzuahmen. Es würde ihm guttun.
Cyril beobachtete sie aus seinen vergissmeinnichtblauen Augen. Als sie sich Kaffee einschenkte, ermahnte er sie: „Du musst zuerst beten.“
„Oh. Ja, du hast Recht.“ Sie legte die Hände zusammen und sprach das kurze Gebet, ehe sie nach den Brötchen griff.
Cyril sah sehr zufrieden aus, sagte aber: „Du musst immer zuerst beten.“
„Ich weiß.“ Was für ein kleiner Schulmeister das war! Sie machten aus, dass Kathy zu Dr. Morlar gehen solle, während sich Jerome darum kümmerte, dass Cyril neue Kleidung bekam. Der jungen Frau graute vor dem Gedanken, den Jungen noch einmal in diesem schimmelgrünen Anzug zu sehen.
Angesichts der geringen Größe der Ansiedlung machte es keine Mühe, vom Zentrum aus so ziemlich jeden Punkt zu Fuß zu erreichen, und Kathy brauchte frische Luft und Zeit zum Nachdenken. Sie machte sich mit dem Stadtplan in der Hand auf den Weg, nachdem sie Cyril nachgesehen hatte, wie er an Jeromes Hand davonschritt. Wie ein normales Kind wirkte er immer noch nicht, aber seit dem Vortag war er beträchtlich munterer geworden. Sie nahm nicht an, dass er um seinen Stiefvater trauerte. Sie konnte sich schwer vorstellen, dass irgendjemand um Adrian Petri trauerte. Er war ein so unzugänglicher, so verschrobener Mensch gewesen, so arrogant in seiner Seltsamkeit, die ihn von anderen Menschen trennte – ihn über sie hinaushob, wie er meinte. Gewiss war er kein Mann gewesen, dem ein Kind Tränen nachweinte.
„Sind Sie die Neue?“
Die Stimme riss sie so heftig aus ihren Gedanken, dass sie zusammenfuhr und sich erschreckt umsah. Nun entdeckte sie die Person, die die Frage gestellt hatte: Es war eine kleine schiefschultrige Frau, die trotz der drückenden Wärme einen Wintermantel aus grauem Loden trug und dicke wollene Strümpfe, die allerdings an ihren Beinen herabgerutscht waren und einen Wulst um die nackten Knöchel bildeten.
„Wie bitte?“, fragte sie vorsichtig.
Die Frau löste sich aus dem Schatten des Hauseingangs, in dem sie gestanden hatte, und näherte sich ihr mit einem halb hopsenden, halb schleppenden Schritt. Ihre winzigen schwarzen Augen funkelten bösartig. „Wer sind Sie? Sie sind doch neu hier?“, wiederholte sie, jetzt mit einem harschen Unterton in der Stimme, als sei sie drauf aus, Streit anzufangen.
Kathy warf einen Blick auf ihr Gesicht und kam zu dem Schluss, dass sie es mit einer leicht geistesgestörten Person zu tun hatte. Um die Frau nicht zu reizen, erwiderte sie beiläufig: „Ich bin zu Besuch hier“, und beeilte sich, an der Alten vorbeizukommen. Dass sie eine Antwort auf ihre Frage bekam, schien die Frau aber erst recht zu erbosen, ihr Gesicht verzerrte sich, und sie schrie Kathy nach: „Sie sind neu hier! Jawohl! Ich hab’s gesehen! Sie gehören nicht hierher! Sie sind keine von uns!“
Kathy schlug einen schnelleren Schritt ein. Die Frau wirkte altersschwach, trotzdem hatte sie ein wenig Angst vor ihr. Die Verrückte erschien ihr plötzlich wie eine Verkörperung der Feindseligkeit, die diese kleine Stadt ausströmte. Sie war froh, dass die Alte keine Anstalten machte, ihr nachzulaufen, sondern sich damit begnügte, ihr unverständliche Flüche nachzuschicken.
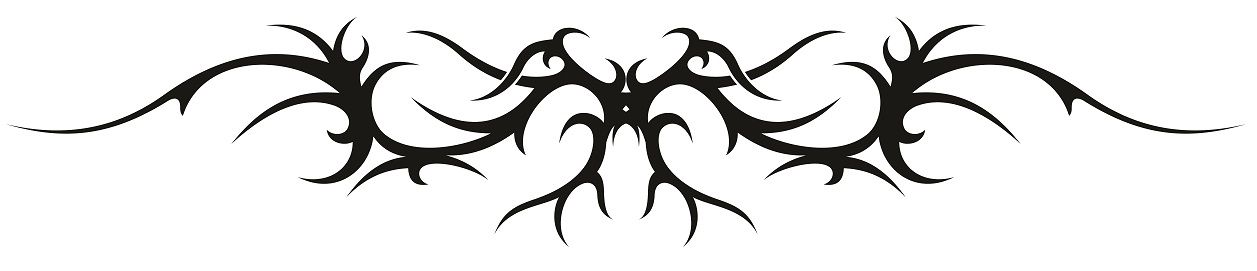
Um elf Uhr klingelte Kathy an der Tür einer hübschen weißen Villa mit einem von zwei dorischen Säulen gestützten Vordach. Neben der Tür glänzte das gravierte Messingschild.
Dr. Anselm Morlar. Notariatskanzlei. Termine nur nach Voranmeldung.
Der letztgenannte Satz trug ihr eine lebhafte Kontroverse mit Dr. Morlars Vorzimmerdame ein. Sie musste schließlich ziemlich lautstark darauf hinweisen, dass sie am Vortag angekommen waren, bei erster Gelegenheit wieder abzureisen gedachten und keine Zeit hatten, womöglich wochenlang auf Termine zu warten. Schließlich wurde sie vorgelassen.
Sie stellte fest, dass der Notar eine sehr gut gehende Praxis betrieb. Sie stand in einem der üblichen Prunkbüros eines erfolgreichen Selbstständigen. Riesige Fenster, ein weißer Schreibtisch mit einer Marmorplatte, ein Kristalllüster an der Decke, sparsam verteilte Nippes, die jeden Kunstdieb begeistert hätten.
Aber das alles – und Dr. Morlar, der sich hinter dem Schreibtisch erhob und ihr mit einer schlaffen Geste die Hand hinstreckte – nahm sie kaum wahr, so sehr faszinierte sie ein Gemälde, das in einem vergoldeten Rahmen hinter dem Schreibtisch hing.
Es war ein Bruststück, in altmeisterlicher Technik ausgeführt. Trotz dieser Technik, und obwohl die Farben dunkel waren wie die Farben alter Ölgemälde, hatte Kathy den Eindruck, dass es erst in letzter Zeit gemalt worden war. Es zeigte im Hintergrund einen rötlich schillernden Sumpf, in den sich zerbröckelnde Klippen hinausschoben, und davor Kopf und Brust eines Mannes, von einer breitflügeligen, rostfarbenen Haube umhüllt. In der erhobenen Hand hielt er einen grünen Stängel mit einer großen, einer Kallas ähnlichen weißen Blüte, aus deren Kelch Schleim tropfte.
„Womit kann ich Ihnen behilflich sein, Frau Belham?“, fragte Dr. Morlar. Er hatte eine weiche, langsame, etwas geistesabwesend klingende Stimme, als sei er in Gedanken ganz woanders, während er mit ihr sprach. Sie nahm sich zusammen und sah ihn aufmerksam an. Er mochte ebenso gut fünfundzwanzig wie fünfundfünfzig sein. Sein Kopf war ein Spur zu groß für den schmächtigen Körper. Spinnwebdünnes blondes Haar umrahmte ein sehr bleiches Gesicht mit vortretenden Augen und platter Nase, auf der eine zierliche Goldbrille saß. Seine Hände bewegten sich weich und unablässig wie Taschenspielerhände, der Zigarettenrauch floss wie schmeichelnd zwischen den Fingern heraus. Es waren lange Finger, mit der Missbildung an den Fingerkuppen, die man als Trommelschlägerfinger bezeichnet.
Kathy war sonst nicht sonderlich schüchtern, aber die unheimliche Ähnlichkeit des Gemäldes mit ihrem nächtlichen Besucher irritierte sie so, dass sie ihre Anfrage nur unsicher stotternd vorbrachte und über die Worte: „familiäre Verpflichtungen“ zweimal stolperte. Zuletzt schob sie ihm einfach den Brief hin.
Er las sein eigenes Schreiben sehr sorgfältig, tief über den Schreibtisch gebeugt. Wahrscheinlich brauchte er längst eine stärkere Brille.
„Ich bedaure“, sagte er schließlich. „Aber ich fürchte, ich muss Ihnen eine unangenehme Mitteilung machen.“
Er ging zum Aktentisch hinüber und raffte große, grau bedruckte Papierbögen zusammen, in denen sie, als sie näher hinsah, eine Abendausgabe der Stadtnachrichten erkannte.
„Ich habe es nicht für richtig gefunden, Ihnen die näheren Umstände des Todes von Herrn Petri brieflich mitzuteilen.“
„Ich verstehe“, sagte sie, als er ihr die Zeitung entgegenhielt.
Quer über die Seite prangte die dicke Schlagzeile: BERAUBT – MISSHANDELT – ERTRÄNKT.
Dr. Morlar breitete das großformatige Blatt neben ihr aus und begann die Seiten umzuschlagen. Wieder die Schlagzeile. Und ein zweispaltiges Foto, das eine gemeißelte Mauer zeigte, eine Mauer, an der eine Treppe entlangführte. Ein breiter Pfeil wies auf weißes längliches Etwas, das ein Stück entfernt halb versunken in Brackwasser oder Schlamm lag und die Beine grotesk abgewinkelt von sich streckte. Helle Fleckchen, wie Fehler in der Linse der Kamera, schimmerten da und dort auf dem Wasser.
Der Notar beobachtete Kathy. Sie registrierte, dass er anscheinend kein Zeichen von Trauer oder Schrecken von ihr erwartete, höchstens die milde Betroffenheit, die zivilisierte Menschen angesichts eines betrüblichen Ereignisses an den Tag legen. Offenbar nahm auch Dr. Morlar nicht an, dass irgendjemand ihrem verstorbenen Verwandten nachtrauerte.
Sie strich die Seite mit beiden Händen glatt.
Bekannter Schriftsteller brutal ermordet.
Einem Raubmord fiel gestern Nacht ein prominenter Einwohner unserer Stadt, der bekannte Schriftsteller und Brauchtumsforscher Adrian Petri, zum Opfer. Professor Petri, der häufig in einsamen Gegenden unterwegs war, um Material für seine Romane zu sammeln, wurde im alten Wasserwerk von bislang unbekannten Tätern überfallen, beraubt und ins Wasser gestoßen.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783948592349
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2021 (Februar)
- Schlagworte
- horror Plumpsack düstere Phantastik Horror

