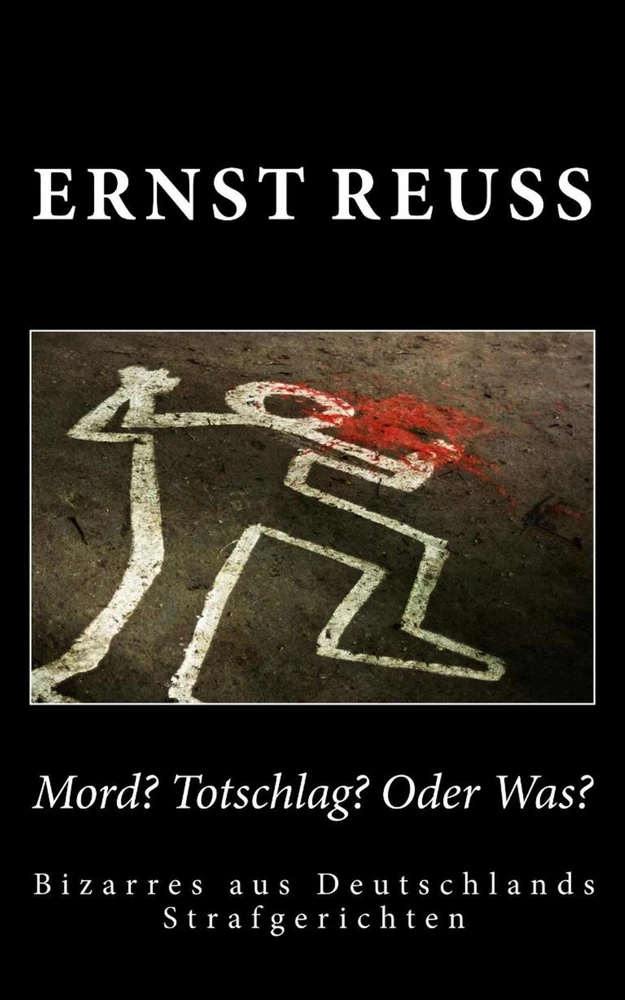Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Man könnte meinen, Mord und Totschlag boomen – in den Buchhandlungen stehen regalweise Krimis zur Auswahl und auf den Fernsehkanälen gibt es täglich dutzende Filmleichen zu sehen. Meist geht es um Verbrechen, Motive und Ermittlungen. Am Ende steht in der Regel der Erfolg, der Täter ist gefasst. Abspann. Buch zu.
Das vorliegende Buch „Mord? Totschlag? Oder was?“ nimmt sich des Themas der Strafverfolgung und Tatbewertung an. Es macht auf eindrucksvolle Weise deutlich, worin bei Straftatbeständen mit Todesfolge die Probleme in der Abgrenzung liegen. Wann wird ein Täter für Mord oder Totschlag oder was auch immer bestraft – und warum? Worin liegen die Schwierigkeiten für ein Gericht, dies zu entscheiden? Manches Urteil wird dem Leser oder der Leserin skurril vorkommen. Oder wenig nachvollziehbar.
Mord und Totschlag sind im juristischen Studium Kernbestandteile. Die Abgrenzung zwischen beiden, die immer wieder debattierte Frage ob es sich um eigenständige Straftatbestände oder beim Mord um eine Qualifizierung des Totschlages handelt, ist im Studium Gegenstand von Hausarbeiten und Klausuren.
Das Buch erscheint in einer Zeit, wo Bewegung in die Debatte um Mord und Totschlag gekommen ist. Möglicherweise ist es in nicht allzu ferner Zeit eher eine Geschichtslektüre. Die schleswig-holsteinische Justizministerin Anke Spoorendonk stieß Ende 2013 eine Debatte um die sprachliche Bereinigung der Tötungsdelikte an. Der jetzige Bundesminister für Justiz- und Verbraucherschutz, Heiko Maas, hat nunmehr eine Kommission einberufen, die einen Vorschlag für die Neuformulierung der Definition der Tötungsdelikte vorlegen soll.
Worin liegt eigentlich das Problem? Die bis heute gültige Formulierung des Mordparagraphen im Deutschen Strafgesetzbuch (§ 211 StGB) stammt aus dem Jahr 1941. Der Mordparagraph enthält sogenannte Gesinnungsmerkmale, beispielsweise die „niedrigen Beweggründe“ oder die „Heimtücke“. Es wird nicht eine Tat bestraft, nämlich das Töten eines Menschen, sondern die Tatbegehung. Und ob es dann Mord oder Totschlag ist, das hängt davon ab, wie Richterinnen und Richter die Gesinnungsmerkmale auslegen. Es obliegt ihrer subjektiv-moralischen Bewertung, ob die Tatbegehung eine aus „niedrigen Beweggründen“ oder aus „Heimtücke“ ist oder nicht. Das nennt sich Täterstrafrecht, weil ein Täterbild bestraft wird.
Das deutsche Strafrecht ist aber ein Tatstrafrecht, eben weil eine Tat bestraft werden soll. Die Kuriosität des Täterstrafrechts besteht zum Beispiel darin, dass eine Frau die ihren körperlich überlegenen Mann – nachdem er sie jahrelang geschlagen hat – im Schlaf erstickt, wegen heimtückischen Mordes verurteilt werden muss. Der Mann hingegen, der seine Frau totprügelt, kann mit einer Verurteilung wegen Totschlags rechnen. Sie bekommt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, er bekommt eine zeitige Freiheitsstrafe. Klingt nicht nur ungerecht, das ist auch ungerecht.
In verschiedenen Büchern und Schriften finden sich eindeutige Hinweise darauf, dass die Formulierung des Mordparagraphen an die sogenannte Tätertypenlehre der NS-Zeit anknüpft. Diese stellt bei der Formulierung von Straftatbeständen nicht auf konkrete Handlungen ab, sondern umschreibt Tätertypen. Deshalb finden sich Formulierungen im Strafgesetzbuch wie „Mörder ist, wer ...“.
Das vorliegende Buch ist nicht vordergründig politisch. Es fällt aber in eine hochpolitische Zeit. In eine Zeit, wo es nach vielen Jahren Debatte tatsächlich möglich erscheint, dass die Gesetze zu Tötungsdelikten neu gefasst werden. Das ist längst überfällig.
Dieses Buch ist aber nicht nur für Insider oder angehende Juristen lesenswert, sondern wegen der anschaulichen Kommentierung des Autors auch für den juristischen Laien verständlich. Möge es die fachliche Debatte bereichern und beim Laien dafür Verständnis wecken.
Berlin, den 1. Juli 2014 Halina Wawzyniak
Mitglied des Rechtsausschusses des Bundestages
Einleitung
Es muss wohl Mitte der 90er Jahre gewesen sein, als ich das erste Mal vom Sirius-Fall hörte, während einer Strafrechtsvorlesung in meinen Anfangssemestern an der Universität. Ein Mann hatte seine Bekannte überredet sich umzubringen, damit sie mit ihm, ohne ihren dafür hinderlichen Körper, zum Planeten Sirius reisen kann, um dort eine gemeinsame glückliche Zukunft haben zu können.
Mich elektrisierte dieser Fall sofort. Wie konnte so etwas Absurdes geschehen? Als angehenden Juristen interessierte mich natürlich noch mehr, ob man jemanden wegen solch einer Tat juristisch belangen könnte. Ein Selbstmord ist nun mal nicht strafbar.
Häufig wurde ich gefragt, wie ich so etwas „Trockenes“ wie Jura studieren könnte. Ich konterte gern, indem ich einen solch grotesken Fall schilderte. Meist erntete ich von meinen Zuhörern ein verwundertes Kopfschütteln und die Bemerkung, warum sie noch nie davon gehört hätten.
Schon damals hatte ich die vage Idee, eines Tages diese Geschichten aufzuarbeiten. Es gibt vermutlich ein breites Publikum, das sich für derartig merkwürdige und juristisch brisante Fälle interessiert. Nun endlich erscheint eine Auswahl davon in Buchform.
„Mord? Totschlag? Oder was?“ ist ein Buch über ältere und jüngere Strafrechtsfälle, die für den Bereich Mord und Totschlag exemplarisch sind. Wie der Auslöser des Ganzen, der Sirius-Fall, haben auch alle folgenden Fälle eine besondere juristische Eigentümlichkeit.
Warum wird jemand als Mörder verurteilt? Warum ein anderer „nur“ als Totschläger?
Mordmerkmale wie „Habgier“, „niedrige Beweggründe“, „Heimtücke“, „Mordlust“ und „Grausamkeit“ spielen in den Urteilen und deshalb natürlich auch in diesem Buch eine große Rolle. Vielleicht wird von diesen Mordmerkmalen bald nur noch in den Geschichtsbüchern die Rede sein. Eine Gesetzesänderung zur Neuregelung der Straftatbestände Mord und Totschlag ist in Vorbereitung.
Bei den Sachverhalten in diesem Buch handelt es sich um tragische, skurrile und außergewöhnliche Tatbestände. Bizarr, so lassen sich die meisten dieser Fälle am ehesten beschreiben. Da bringt beispielsweise ein Täter allein und eigenhändig mehrere Menschen um – und wird trotzdem nur als Gehilfe verurteilt. Wie kann so etwas sein? Einem anderen Täter wird eingeredet, dass ein „Katzenkönig“ existiert, der die gesamte Menschheit bedroht, falls er ihn nicht durch den Opfertod einer Frau besänftigen würde. Wie irrsinnig ist das denn? Jemand bringt einen ihm vollkommen Fremden um und zerstückelt seine Leiche. Wo bleibt das Motiv? Ein Mann verbrennt seine eigenen Kinder, eine Frau tötet fünf ihrer Kinder sofort nach der Geburt. Schrecklich, aber was sind die Hintergründe solcher Taten? Jemand trinkt sich zu Tode und sein Zechpartner wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Wie kann das denn sein? Ein bis dahin unbescholtener Grundschullehrer vergiftet mehrere seiner Sexualpartner. Warum? Es geht um „Totschlag auf Verlangen“, Kannibalismus, um Ehrenmord und um andere juristisch schwer zu fassende Tatbestände.
Die Recherche zu den Fällen war nicht immer einfach und so manches Gericht weigerte sich, die Urteile zugänglich zu machen. Ergänzend zu den Informationen aus den Medien ist es mir gelungen, auch andere juristische Quellen auszuwerten und damit Urteilsbegründungen kritisch zu erläutern, um beim Leser ein tieferes Verständnis dafür zu wecken, welche Abwägungskriterien bei solchen Urteilen eine Rolle spielen.
So ist ein Buch entstanden, das sowohl das juristisch interessierte Publikum anspricht als auch den aus dem Bauch heraus urteilenden Laien, den es brennend interessiert, warum ein Gerichtsurteil genau so ausgefallen ist, wie er es aus Zeitungen oder anderen Medien erfahren hat.
Mitunter gehen die Tateinzelheiten allerdings über das allgemein Erträgliche hinaus. Die Details wurden jedoch nur insoweit wiedergegeben, wie das zur Erläuterung der juristischen Wertung notwendig war.
Berlin, September 2014 Ernst Reuß
Der Sirius-Fall
Lag ein versuchter Mord vor?
Vor dieser äußerst kniffligen Frage stand im Juli 1983 der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Im Juristendeutsch lautet das Problem, über das das Gericht zu urteilen hatte:
„Abgrenzung von strafbarer Tötungstäterschaft und strafloser Selbsttötungsteilnahme in Fällen, in denen der Suizident durch Täuschung zur Vornahme der Tötungshandlung bewogen wird.“
Was war geschehen?
Das Landgericht Baden-Baden hatte am 3. November 1982 in einem fünftägigen Prozess den zu diesem Zeitpunkt 35-jährigen Angeklagten Fred G. – Mitinhaber eines Galvanobetriebes in Bayern – wegen versuchten Mordes, wegen Betruges, wegen vorsätzlicher Körperverletzung, wegen unbefugten Führens akademischer Grade und wegen eines Vergehens gegen das Heilpraktikergesetz zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Dagegen hatte Fred G. – beziehungsweise dessen Anwalt – Revision eingelegt.
G. soll „einen Suizidenten“ dazu überredet haben sich selbst umzubringen. Abgesehen davon, dass es sich bei „dem Suizidenten“ um eine Frau namens Heidrun T. handelte, mit der Fred G. seit mehreren Jahren eng befreundet gewesen war und ein Selbstmord möglicherweise moralisch verwerflich, beziehungsweise aus religiösen Gründen nicht erlaubt sein mag, ist eine solche Tat nach unserem Strafgesetzbuch definitiv nicht strafbar. Für sein eigenes Leben ist jeder immer noch selbst verantwortlich.
Es war also die Frage zu klären, ob man wegen massiver Beeinflussung eines Selbstmordkandidaten als Mörder verurteilt werden kann. Genau das versuchte das Gericht zu klären.
Weil der Selbstmordversuch der damals 29-Jährigen am 1. Januar 1980 erfreulicherweise nicht klappte, blieb es allerdings lediglich bei einer Anklage wegen versuchten Mordes.
Kann man also jemanden wegen des Selbstmordversuches eines anderen verurteilen?
Doch eher nicht, oder?
Anstiftung zu einem Selbstmord ist nicht strafbar, denn wer zu einer straflosen Tat anstiftet, kann deswegen nicht verurteilt werden.
Klingt einfach. Aber dieser Fall war speziell.
Ein vollkommen wirres Knäuel nicht nachvollziehbarer Phantastereien und menschlicher Abgründe wurde erneut einem Gericht vorgelegt. Der Bundesgerichtshof hatte die schwierige Aufgabe darüber zu entscheiden, ob wirklich ein versuchter Mord vorlag, wie das Landgericht Baden-Baden zuvor geurteilt hatte. Folgendes war geschehen:
Anfang der 70er Jahre lernte der Angeklagte in einer Diskothek in der Nähe von Aalen die vier Jahre jüngere Heidrun T. kennen. Diese war laut Schilderung von Zeugen damals noch eine unselbstständige junge Frau von Anfang 20, die ziemlich komplexbeladen gewesen sein soll. Der anscheinend umwerfende Charmeur Fred G. hatte sich als Heilpraktiker, Privatdozent und Doktor der Psychologie vorgestellt. Heidrun war stark beeindruckt von seinen Hochstapeleien und verliebte sich heftig, obwohl sie gewiss war, dass ihre Liebe von diesem aus ihrer Sicht großen, weisen – aber mit anderen Frauen liierten – unerreichbaren Mann nicht erwidert werden konnte. So entwickelte sich eine äußerst intensive, aber doch nur platonische Freundschaft.
Man diskutierte sich hauptsächlich die Köpfe heiß.
Die Gespräche gingen meist um Psychologie und Philosophie. Fred – der angeblich promovierte Psychologe – wusste einfach auf alles eine Antwort. Die ausgebildete Chefsekretärin Heidrun T., die inzwischen zur Tageszeitung „Welt“ nach Bonn gegangen war, befand sich in einer Selbstfindungsphase und war gerade dabei den Sinn des Lebens zu ergründen. Fred G. stand ihr zur Seite. Da sie nicht in derselben Ortschaft wohnten, wurden diese Diskussionen oft in mehrere Stunden dauernden Telefongesprächen geführt.
Laut Auffassung des Landesgerichtes Baden-Baden wurde Fred G. für die Heidrun T. im Laufe der Zeit zum Lehrer und Berater in allen Lebensfragen. Sie vertraute und glaubte ihm blindlings. Er war immer für sie da.
Zumindest telefonisch!
1978 verließ sie schließlich Bonn und zog in eine Fred gehörende Eigentumswohnung in die Nähe von Baden-Baden.
Die Nähe zwischen ihr und ihrem Freund in allen Lebenslagen nahm noch mehr zu. Ihre Abhängigkeiten und ihre persönlichen Probleme allerdings auch. Fred wusste natürlich Rat, auch wenn der sich letztendlich als teuer herausstellen sollte.
Damit sie ihre Probleme überwinden könne, meinte G., benötige sie einer geistigen und philosophischen Weiterentwicklung. Einer vollkommenen Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Dazu bedürfe es natürlich größter geistiger Anstrengung zu denen selbst er – der große Lehrmeister Fred G. - nicht in der Lage sei. Er könne allerdings Hilfe anbieten, denn er kenne einen Mönch namens „Uliko vom Volke der Dogen“.
Der wäre ein noch größerer Lehrmeister als er selbst. Er würde für sie meditieren, was allerdings nicht ganz billig wäre, denn das Kloster, in dem dieser leben würde, brauche Geld. Sehr viel Geld selbstredend! Das verstand Heidrun.
Im guten Glauben überreichte sie dem wahrscheinlich innerlich glucksenden Fred G. einen Scheck. Sie hatte zuvor einen Bankkredit aufgenommen.
Dass es sich bei „Uliko“ schlicht um ein Fantasieprodukt des Angeklagten handelte, braucht hier nicht näher dargelegt werden. Dass Heidrun T. keine Zweifel an Fred hatte, braucht wohl auch nicht erläutert zu werden. Und, dass Fred G. das ganze Geld mit dem ihm eigenen Selbstverständnis seinem eigenen Konto gut schreiben ließ, sicherlich erst recht nicht!
Laut dem etwas trockenen Deutsch des Bundesgerichtshofs spielte sich die Geschichte wie folgt ab:
„Als der Angeklagte erkannte, daß ihm die Zeugin vollen Glauben schenkte, beschloß er, sich unter Ausnutzung dieses Vertrauens auf ihre Kosten zu bereichern. Er legte der Zeugin dar, sie könne die Fähigkeit, nach ihrem Tode auf einem anderen Himmelskörper weiterzuleben, dadurch erlangen, daß sich der ihm bekannte Mönch Uliko für einige Zeit in totale Meditation versetze. Dadurch werde es ihrem Körper möglich, während des Schlafes mehrere Ebenen zu durchlaufen und dabei eine geistige Entwicklung durchzumachen. Dafür müßten allerdings an das Kloster, in dem der Mönch lebe, 30000 DM gezahlt werden. Die Zeugin glaubte dem Angeklagten. Da sie nicht genügend Geld besaß, beschaffte sie sich die geforderte Summe durch einen Bankkredit.“
Deswegen wurde Fred G. dann auch später vom Landgericht Baden-Baden zu Recht wegen Betrugs verurteilt.
So weit, so klar.
Aber versuchter Mord?
Es musste also noch mehr vorgefallen sein.
So war es auch. Mit ihrer geistigen Weiterentwicklung war Heidrun nicht ganz zufrieden, und das trotz der pünktlich übergebenen 30.000 DM. Der Erfolg der Meditation des Mönches „Uliko vom Volke der Dogen“ stellte und stellte sich nicht ein. Heidrun fühlte sich kein bisschen verändert. Die skurrile Geschichte ging also weiter. Das Gericht stellte später fest:
„Sooft sich die Zeugin in den folgenden Monaten nach den Bemühungen des Uliko erkundigte, vertröstete sie der Angeklagte. Später erklärte er ihr, der Mönch habe sich bei seinen Versuchen in große Gefahr begeben, gleichwohl aber keinen Erfolg erzielt, weil ihr Bewußtsein eine starke Sperre gegen die geistige Weiterentwicklung aufbaue. Der Grund dafür liege im Körper der Zeugin; die Blockade könne nur durch die Vernichtung des alten und die Beschaffung eines neuen Körpers beseitigt werden.“
Aha! Heidrun T. war also selbst schuld! Ihr Körper war ihr im Weg. Ein Missgeschick, dem „leicht“ abgeholfen werden konnte!
Ganz schön dreist von unserem Angeklagten!
Und ziemlich durchsichtig, doch die arglose Frau schöpfte keinen Verdacht. Sie war Fred G. vollkommen verfallen.
Eines Tages hatte Fred ihr in einem ihrer unzähligen esoterisch angehauchten Gespräche überraschenderweise erzählt, dass er ja, um ehrlich zu sein, eigentlich gar kein Mensch sei, sondern von einem fremden Stern stamme. Er sei Sirianer, also ein Bewohner des weit, weit entfernten Sternes Sirius.
Vom Sirius?
Ja!
Und Heidrun T., der offensichtlich keine von Freds Storys zu albern war, glaubte ihm unvorstellbarerweise tatsächlich auch diese Geschichte.
Fred G. erzählte ihr in den folgenden Tagen einiges von „seinem“ Planeten. Unter anderem berichtete er davon, dass die Sirianer eine Rasse seien, die philosophisch auf einer weit höheren Stufe stehen als die Menschen und er deswegen zur Erde gesandt worden sei, weil er den Auftrag habe es einigen besonders brillanten Menschen zu ermöglichen auf dem Sirius weiterzuleben. Selbstverständlich gehörte auch die leichtgläubige aber geschmeichelte Heidrun T. zu dieser Elite. Freilich gab ein klitzekleines Problemchen. Ein Weiterleben auf dem Sirius sei erst nach dem völligen Zerfall des eigenen Körpers möglich.
Ihr Körper war also erneut im Weg, denn nur mit ihrer Seele könne sie auf einem fremden Planeten und natürlich auch auf dem Sirius weiterleben.
Nun hatte Fred G. offensichtlich „Blut geleckt“. Voller Freude, dass ihm die junge Frau auch diese völlig aberwitzige Münchhausengeschichte glaubte, fasste er einen perfiden Plan. Laut Bundesgerichtshof lautete der wie folgt:
„Der Angeklagte spiegelte ihr vor, in einem roten Raum am Genfer See stehe für sie ein neuer Körper bereit, in dem sie sich als Künstlerin wiederfinden werde, wenn sie sich von ihrem alten Körper trenne.“
Heidrun T. sollte sich also „von ihrem Körper trennen“. Für Außenstehende schwer verständlich, erklärte er ihr auch noch, dass sie eine Lebensversicherung zu seinen Gunsten abschließen solle.
Unglaublich, aber auch das schluckte das vertrauensselige Mädchen, denn es würde sich ja nicht wirklich umbringen, sondern sofort in einem neuen Körper aufwachen.
Dem Körper einer Künstlerin!
Auch in diesem neuen Leben bräuchte sie ja Geld, und Kunst ist bekanntlich brotlos.
In welchen schillernden Farben Fred unserer leichtgläubigen Heidrun diesen neuen Körper vorher schilderte, geht aus dem Urteil leider nicht hervor. Es muss auf jeden Fall sehr überzeugend gewesen sein. Heidrun T. glaubte ihrem Sirianer ohne den Hauch eines Zweifels und ließ sich darauf ein, eine Lebensversicherung über 250.000 DM abzuschließen. Bei Unfalltod sollte sich die Summe auf 500.000 DM erhöhen. Daher musste der „Übergang in den neuen Körper“ wie ein Unfall aussehen. Jemanden zum Selbstmord zu überreden, um dann auch noch davon finanziell zu profitieren – schon der gesunde Menschenverstand findet es unverschämt habgierig, was sich unser Fred hier ausgeklügelt hat!
Er allerdings schien nicht zu wissen, dass Habgier – neben Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Heimtücke, Grausamkeit, Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln oder aus niedrigen Beweggründen – eines der Mordmerkmale im Sinne des § 211 Strafgesetzbuch ist. Eines davon genügt, um jemanden wegen Mordes zu verurteilen.
Fred G. hatte mit Sicherheit nicht mit einer Anklage wegen Mordes gerechnet.
Der Versicherungsschutz von Heidrun T. begann ab 1. Dezember 1979. Ihre monatliche Versicherungsprämie belief sich auf 587,50 DM. Ein ganz schöner Batzen Geld bei ihren Einkommensverhältnissen. Aber bald wäre sie ja Künstlerin und die Versicherungsprämie wäre dann hinfällig. Ihr konnte es zu diesem Zeitpunkt egal sein.
Heidrun T. bestimmte Fred G. zum Bezugsberechtigten und bereitete sich auf ihr neues Leben vor. Das Geld – so versprach Fred – werde er ihr nach Auszahlung der Versicherungssumme und sie sofort nach dem Unfall – den sie in Bälde erleiden würde – sofort überbringen. Sie glaubte ihm, bedingungslos.
Vorab gab sie ihm schon mal ihre Ersparnisse in Höhe von 4000 DM.
„… weil sie, wie er ihr sagte, nach dem Erwachen am Genfer See das Geld, das er ihr sofort überbringen werde, als »Startkapital« benötige. Die Auszahlung der Versicherungssumme könne sich verzögern. Ihr »jetziges Leben« sollte die Zeugin nach einem ersten Plan des Angeklagten durch einen vorgetäuschten Autounfall (…) beenden.“
Beide gemeinsam fanden den günstigsten Platz für den Autounfall: den Brückenpfeiler eines Autobahnzubringers. Der „Unfall“ sollte Weihnachten 1979 stattfinden. Heidrun war zu diesem Zeitpunkt gerade 28 Jahre alt.
Ihr Plan ging allerdings nicht sofort auf, denn tragischerweise durchkreuzte Freds Ehefrau Heike den Plan, indem sie sich kurz zuvor am 3. Dezember selbst erschoss. Fred hielt sich während des Selbstmordes seiner Frau in der Wohnung auf und hatte wegen der nachfolgenden Ermittlungen der Polizei erst einmal ganz andere Probleme zu bewältigen. Es liefen Ermittlungen gegen ihn, denn schon zuvor sollen Freundinnen von ihm auf recht dubiose Weise ums Leben gekommen sein.
Ob seine Ehefrau Heike sich von ähnlichen Motiven wie Heidrun zu ihrem Selbstmord leiten ließ, blieb im Dunkeln, obwohl deren Mutter im späteren Gerichtsprozess die Ansicht vertrat, dass nur Fred an ihrem Tod schuldig sein konnte.
Doch dem G. war vorerst nichts nachzuweisen.
Fred bastelte schon bald wieder munter an seinen Plan, wie sich Heidrun am besten selbst umbringen könnte. Beide nannten es verniedlichend „Körpervernichtung“.
Da sich Fred und seine ihm hörige platonische Beziehung nicht sicher waren, ob Heidrun bei einem Autounfall dann möglicherweise doch „nur“ schwer verletzt sein würde und die Familie seiner gerade erst verstorbenen Ehefrau von den Plänen Wind bekommen hatte, entschlossen sich die beiden es mit einem eingeschalteten Fön in der Badewanne zu versuchen. Anfang der 80er Jahre war das wohl noch eine sehr „angesagte“ Suizidart.
Mit einem Stromstoß in ein neues Leben – mit einem neuen Körper.
So sollte es geschehen!
„Evakuieren“ nannte Fred das. Evakuieren auf den Planeten Sirius.
Weit, weit weg in ferne Galaxien sozusagen.
Zuvor sollte Heidrun – damit es auch wirklich nach einem Unfall aussah – Wäsche waschen, einen Kuchen backen, eine Bekannte für den Abend einladen und das Telefon neben die Badewanne stellen.
Fred gab telefonisch den Startschuss.
Das Gericht fährt in seiner Tatbestandsschilderung unnachahmlich fort:
„Auf Verlangen und nach des Anweisungen des Angeklagten versuchte die Zeugin, diesen Plan am 1. Januar 1980 in ihrer Wohnung in Wildbad zu realisieren, nachdem sie zuvor, einer Anregung des Angeklagten folgend, einige Dinge getan hatte, die darauf hindeuten sollten, daß sie ungewollt mitten aus dem Leben gerissen worden sei. Der tödliche Stromstoß blieb jedoch aus. Aus »technischen Gründen« verspürte die Zeugin nur ein Kribbeln am Körper, als sie den Fön eintauchte.“
Blöd gelaufen! Doch Fred G. gab nicht auf! Er, der sich nach dem Tod der Gattin diesmal nicht am Tatort eines Selbstmordes aufhalten wollte, wartete am Telefon auf das nahende Ende seiner Freundin und war hörbar überrascht als Heidrun T. bei seinem Kontrollanruf den Hörer abnahm. Sie saß immer noch mit ihrem Fön in der Badewanne und versuchte verzweifelt damit ihren Körper zu vernichten. Fred half ihr mehr oder weniger „uneigennützig“ dabei:
„Etwa drei Stunden lang gab er ihr in etwa zehn Telefongesprächen Anweisungen zur Fortführung des Versuchs, aus dem Leben zu scheiden. Dann nahm er von weiteren Bemühungen Abstand, weil er sie für aussichtslos hielt.“
Nach stundenlangem erfolglosen Experimentieren also, doch noch mittels Stromschlag in der Badewanne ihr Leben auszuhauchen, stieg Heidrun aus dem – inzwischen wohl kalt gewordenen – Wasser und ging vermutlich frustriert ins Bett. Fred hatte zuvor den Befehl gegeben „Aufhören jetzt“, was sein Anwalt später in der Revision als Rücktritt von der geplanten Tat gewertet sehen wollte. Damit hatte er allerdings keinen Erfolg.
Der Gutachter des TÜV Karlsruhe hatte im Prozess festgestellt, dass Heidrun ihr Überleben einer Bauschlamperei zu verdanken hatte, denn die Badewanne war nicht geerdet!
Möglicherweise wollte Heidrun T. im tiefsten Inneren ja denn doch nicht aus dem jetzigen Leben scheiden? Weitere Versuche sich das Leben zu nehmen – um auf dem Sirius weiter zu existieren – sind nämlich nicht gerichtsbekannt.
Wie der Vorfall dann zur Polizei gelangte, lässt sich nur vermuten. Möglicherweise hatte jemand aus der Familie von Freds Ehefrau gepetzt. Sie hatte ihrem Leben ja kurz zuvor mit einer Pistole ein Ende gesetzt und wohl über Freds Pläne familienintern geplaudert. Jedenfalls hatte Heidrun bei einer ersten richterlichen Vernehmung im Februar 1980 noch wahrheitswidrig ausgesagt, dass nichts dergleichen am 1. Januar 1980 geplant war.
Erst am 23. August 1980 ging Heidrun zur Polizei und brachte damit den ganzen Fall ins Rollen. Aus welchen Motiven dies geschah, blieb im Dunkeln. Wahrscheinlich war es der jungen Frau einfach unmöglich, die monatliche Versicherungsprämie von 587,50 DM zu zahlen, und sie plauderte ihre Problemlage aus.
Die Polizei ermittelte, doch das größere Problem hatte die Justiz. Fred G. lachte sich wahrscheinlich erst einmal ins Fäustchen. Vielleicht war ihm auch ein bisschen mulmig zumute.
Aber ein Selbstmord ist nun mal nicht strafbar. Da beißt die Maus keinen Faden ab!
Betrug? Okay! Ein gewisses Sümmchen hatte er sich von der Heidrun ergaunert.
Aber versuchter Mord?
Nein, da war er sich sicher!
Angriff ist die beste Verteidigung, dachte Fred und warf der Kriminalpolizei einen „wüsten Amoklauf“ gegen seine Person vor und titulierte den gegen ihn ermittelnden Kriminalbeamten frech als „Zombiejäger“. Sein Anwalt trug vor, dass nur straflose Beteiligung am versuchten Selbstmord in Betracht gezogen werden könnte. Das war natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen.
Da stand die Justiz erst mal da. Doch ein Mann mit solch großer krimineller Energie und dieser dubiosen Vorgeschichte musste verurteilt werden. Straflos sollte so einer nicht ausgehen!
Das war doch zu dreist gewesen.
Das Gericht begründete:
„Die Zeugin handelte in völligem Vertrauen auf die Erklärungen des Angeklagten. Sie ließ den Fön in der Hoffnung ins Wasser fallen, sofort in einem neuen Körper zu erwachen. Der Gedanke an einen »Selbstmord im eigentlichen Sinn«, durch den »ihr Leben für immer beendet würde«, kam ihr dabei nicht. Sie lehnt eine Selbsttötung ab. Der Mensch habe dazu kein Recht. Dem Angeklagten war bewußt, daß das Verhalten der ihm hörigen Zeugin ganz von seinen Vorspiegelungen und Anweisungen bestimmt wurde.“
Soll heißen, dass allein Fred G. eine mögliche Tötung zu verantworten hatte. Die leichtgläubige Heidrun T. dachte ja nicht mal an Selbstmord, sie glaubte ohne Weiteres tatsächlich, im Körper einer Künstlerin in einem roten Raum in Genf zu erwachen und mit diesem Körper dann endlich zum Sirius zu entfleuchen.
Das Gericht war der Ansicht, dass die Abgrenzung einer „strafbaren Tötungstäterschaft von einer straflosen Selbsttötungsteilnahme“, die allein durch eine Täuschung zustande kam, nicht abstrakt beantwortet werden kann, sondern im Einzelfall bewertet werden muss.
„Die Abgrenzung hängt im Einzelfall von Art und Tragweite des Irrtums ab. Verschleiert er dem sich selbst ans Leben Gehenden die Tatsache, daß er eine Ursache für den eigenen Tod setzt, ist derjenige, der den Irrtum hervorgerufen und mit Hilfe des Irrtums das Geschehen, das zum Tod des Getäuschten führt oder führen soll; bewußt und gewollt ausgelöst hat, Täter eines (versuchten oder vollendeten Tötungsdelikts kraft überlegenen Wissens, durch das er den Irrenden lenkt, zum Werkzeug gegen sich selbst macht.“
Aha!
So ist das also!
Übersetzt für den Nichtjuristen bedeutet es: Soweit der potenzielle Selbstmörder beziehungsweise in diesem Fall die potenzielle Selbstmörderin sich gar nicht bewusst ist, dass sie gerade im Begriff ist sich umzubringen und der Hintermann, der sie zu dieser Tat anleitet, dieses hohe Maß an Einfältigkeit ausnutzt, ist der Hintermann als Täter anzusehen, denn er benutzt ein willenloses Werkzeug gegen sich selbst.
Klar?
Deshalb, und nur deshalb, kam das Gericht zum Ergebnis, dass in diesem Fall Fred G. wegen versuchten Mordes zu verurteilen war, obwohl er gar nicht persönlich Hand angelegt hatte – ja nicht einmal anwesend war – und Selbstmord nicht strafbar ist.
Das Gericht sagte also:
„Nach den Feststellungen des Tatgerichts spiegelte der Angeklagte seinem Opfer nicht vor, es werde durch das Tor des Todes in eine transzendente Existenz eingehen, sondern versetzte es in den Irrtum, es werde – obgleich es scheinbar als Leichnam in der Wanne liege – zunächst als Mensch seinen irdischen Lebensweg fortsetzen, wenn auch körperlich und geistig so gewandelt, daß die Höherentwicklung zum astralen Wesen gewährleistet sei. Die Überzeugung, daß ihre physisch-psychische Identität und Individualität lediglich Modifikationen erfahre, ergab sich für Frau T. nicht nur daraus, daß sie, wie ihr der Angeklagte sagte, auf diesem Planeten verblieb und Geld zur Deckung ihres Lebensbedarfs brauchte, sondern auch daraus, daß er ihr vormachte, sie werde im roten Raum am Genfer See Beruhigungspillen und im Nebenzimmer die erforderlichen Papiere finden. Was Frau T. nicht ahnte und wollte, erstrebte der Angeklagte: Der von beiden als sicher erwartete Stromstoß sollte dem Leben der Getäuschten ein Ende setzen und dem Angeklagten die Versicherungssumme verschaffen, von der sein Opfer annahm, sie sei die wirtschaftliche Grundlage des neuen Lebensabschnitts. Der Angeklagte, der auch das eigentliche Tatgeschehen durch stundenlang erteilte Anweisungen maßgeblich steuerte, beging infolgedessen ein Verbrechen der versuchten mittelbaren Fremdtötung.“
Dem Anwalt des Angeklagten, der versuchte, der Geschädigten – immerhin eine zwar noch junge, aber erwachsene Frau – einen Teil der Verantwortung zuzuweisen, weil sie so unbegreiflich leichtgläubig war, entgegnete das Gericht:
„Diese rechtliche Feststellung wird nicht dadurch in Frage gestellt, daß Frau T. völlig unglaubhaften Suggestionen erlag, obwohl sie keine psychischen Störungen aufwies. Der Angeklagte hatte sich die Psyche seines Opfers für diese Suggestion erschlossen. Das Erstaunliche dieses Vorgangs entlastet ihn nicht.“
Das Gericht fügte sogar noch an:
„Auch wenn Frau T. angenommen hätte, daß dem ‚Erwachen’ in einem roten Raum am Genfer See ihr Tod vorausgehen müsse (…) bestünde die Verurteilung des Angeklagten zu Recht.“
Denn – um es salopp zu sagen – Fred G. war der kritiklosen und naiven Heidrun T. weit überlegen, und nur seine Täuschungen führten dazu, dass sie arglos Hand an sich selbst legte. Von allein hätte sie es nie getan.
Dafür sprach auch, dass sie selbst in der Gerichtsverhandlung ein Recht auf Selbsttötung ausdrücklich negierte und ja eigentlich ernsthaft beabsichtigt hatte in einem neuen Körper weiterzuleben.
So kann also jemand, der im wörtlichen Sinn eigentlich keine Tat begangen hatte, als mittelbarer Täter für die Handlung eines anderen verantwortlich sein.
Ganz schön kompliziert!
Genau deshalb musste Fred G. wegen versuchten Mordes zu Recht einige Jahre in der Justizvollzugsanstalt Neumünster schmoren, auch wenn er selbst von einer „teuflischen Hetzjagd“ und einem „absurden Fehlurteil“ gegen sich sprach.
Vollkommen untätig blieb er in den nächsten Jahren auch in der Haft nicht. Als am 31. Oktober 1988 seine Strafe eigentlich verbüßt gewesen wäre, musste er gleich weiter im Gefängnis bleiben. Selbst in der JVA Neumünster war er nicht untätig geblieben. Wieder mit Hilfe einer leichtgläubigen Frau – der er offensichtlich auch überzeugend vom Sirius erzählt hatte – und einer selbst gegründeten Briefkastenfirma hatte er versucht ziemlich viel Geld zu ergaunern.
Er blieb für weitere zwei Jahre und drei Monate im Gefängnis.
Nach Verbüßung der Strafe verliert sich seine Spur.
Wer weiß schon, wem er wieder vom Sirius erzählt hat, denn offensichtlich hatte der Charmeur in der Justizvollzugsanstalt nichts von seiner stark ausgeprägten Überzeugungskraft und seiner Wirkung auf Frauen eingebüßt!
Quellen:
BGHSt 32, 38 ff. Urteil vom 05.07.1983 Az. 1 StR 168/83 bzw. Landgericht Baden-Baden Urteil vom 3.11.1982 Az. Ks 3/82;
Mitteilung des Landgerichtes Baden-Baden, 18.09.2007;
Zeitungsartikel der örtlichen Tagespresse und der Lokalnachrichten aus der Zeit vom 25.10 bis 3.11.1982 aus dem Privatarchiv des Richters P. Ruh am Landgericht Baden-Baden) (ohne Quellenangaben).
Staschynskij
Ganz anders entschied der Bundesgerichtshof 1962 beim so genannten Staschynskij-Fall:
„Wer eine Tötung eigenhändig begeht, ist im Regelfalle Täter; jedoch kann er unter bestimmten, engen Umständen auch lediglich Gehilfe sein.“
Wie kann das sein?
Jemand der einen anderen eigenhändig tötet, soll nun nur Gehilfe sein? Etwa Gehilfe seiner eigenen Hände? Oder wie ist das zu verstehen?
Die als Staschynskij-Fall bekannt gewordene Entscheidung des Bundesgerichtshofs urteilte über die Mordtaten des 1931 geborenen KGB-Agenten Bogdan Nikolajewitsch Staschynskij. Wieder ging es um die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme.
Die konservative „Welt“ schrieb am 5. Oktober 1962 in einem Vorbericht zum Verfahren Folgendes:
„Eine tolle Spionagestory wird am kommenden Montag der 30 Jahre alte Sowjetbürger Bogdan Staschynskij den fünf in rote Roben gekleideten Mitgliedern des Dritten Strafsenats des Bundesgerichtshofes erzählen. Seine Geschichte von der Tötung der beiden ukrainischen Exilpolitiker Lew Rebet und Stefan Bandera durch Schüsse aus einer geheimnisvollen Blausäurepistole, klingt so unglaublich, daß der zudem recht sympathisch wirkende junge Mann einige Schwierigkeiten haben wird, die Richter von der Richtigkeit seines Mordgeständnisses zu überzeugen.“
Offensichtlich hatte der Autor mit dem akzentfrei und fließend deutsch sprechenden Angeklagten viel Mitgefühl.
Der „sympathisch wirkende“ 30-jährige Staschynskij war im KGB in der „Abteilung für Terrorakte im Ausland“ beschäftigt.
Ja, tatsächlich. So etwas gab es in Zeiten des Kalten Krieges!
Trotz des sehr bürokratisch klingenden Namens der Abteilung, in der Staschynskij ein kleiner Angestellter war, war er auf „gut deutsch“ nichts anderes als ein gedungener KGB-Killer.
1957 erhielt er den Auftrag, einige als störend empfundene Exilpolitiker, nämlich führende Mitglieder der Organisation Ukrainischer Nationalisten und des russischen Nationalen Bundes der Schaffenden, zu liquidieren.
Dafür wurde er nach Ost-Berlin entsandt. Auftragsgemäß und zügig tötete er schon im Herbst 1957 Lew Rebet vom „Nationalen Bund“. 1959 „erledigte“ er dann Stepan Bandera, den Vorsitzenden der Ukrainischen Nationalisten, der im Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang mit Hitler paktiert hatte. In beiden Fällen hatte es auf den ersten Blick nicht nach Mord ausgesehen: Rebet wurde am 12. Oktober 1957 im Treppenflur am Münchener Karlsplatz tot aufgefunden. Der unter dem Pseudonym Stefan Popel in München lebende Bandera starb zwei Jahre später, am 15. Oktober 1959, ebenfalls in einem Münchener Treppenflur. Bei Rebet wurde Herzschlag als Todesursache vermutet, bei Bandera glaubte man an Selbstmord.
Die westdeutsche Frankfurter Allgemeine Zeitung verhielt sich neutral und schrieb am 20. Oktober 1959 unter der Überschrift „Bandera starb an Zyankali“, dass es umstritten sei, ob es sich um Mord oder Selbstmord handelte, aber das ukrainische Informationsbüro in der Bundesrepublik von Mord ausgehe. Bandera sei nach deren Darstellung von mehreren Menschen überfallen worden, wobei ihm das Zyankali in den Mund gesteckt worden sei. Allerdings habe er entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten den Leibwächter vor dem Betreten des Treppenhauses weggeschickt, was möglicherweise dann doch eher für Selbstmord sprechen würde.
Das ostdeutsche „Neue Deutschland“ schrieb einen Tag später unter der Überschrift: „Verfassungsschutz hintertreibt Ermittlungen des Bandera-Mörders“, dass der „Mordgehilfe Oberländers“, des damaligen Bonner CDU-Ministers für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, starb, „weil er zu viel über dessen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg wußte.“
(Anm. d. Verf.) Theodor Oberländer (1905-1998), umstritten wegen seiner Rolle bei den Massenmorden in Lemberg im Juli 1941. Er wurde deswegen 1960 in der DDR in einem rechtsstaatlich fragwürdigen Prozess in Abwesenheit zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt.
Es war eben Kalter Krieg.
Als Tatwaffe hatte Staschynskij eine schon mehrfach und stets mit Erfolg verwendete Giftpistole zum Versprühen von Blausäuregas verwendet, welches er seinen Opfern direkt ins Gesicht sprayte. Durch die Blausäure wurde das Opfer durch Verengung der Atmungsorgane ohnmächtig und starb zwei oder drei Minuten später. Staschynskij bekam ein Gegenserum, das er einsetzen sollte, falls er bei der Tatbegehung aus Versehen etwas davon einatmete. Auch vor einer Tat nahm er sein Gegenmittel ein, um sich vor solchen Eventualitäten zu schützen.
Den ersten Versuch, Bandera zu töten, hatte Staschynskij abgebrochen, weil er die Tat angeblich nicht über sich bringen konnte. Beim zweiten Anlauf hatte er dann weniger Skrupel. Laut seiner eigenen Schilderung war er mittels eines Dietrichs ins Treppenhaus von Banderas Wohnung gekommen, wo er auf ihn wartete. Das Gericht beschreibt das so:
„Dort hörte er alsbald, dass die Haustür geöffnet wurde. Daraufhin ging er hinunter und sah, dass Ba., soeben hereingekommen, im rechten Arm ein Körbchen mit Tomaten, jedenfalls mit ‚etwas Rotem‘, mit der linken Hand versuchte, den anscheinend verklemmten Türschlüssel wieder abzuziehen. Um diese Verzögerung zu überbrücken, bückte sich S. und tat, als ob er an seinen Schuhriemen nestele, obwohl er Halbschuhe ohne Schuhbänder trug. Gleich darauf ging er auf Ba. an der Haustür zu, sagte im Vorbeigehen etwa ‚Funktioniert es nicht?‘, fasste mit der linken Hand den äusseren Türknopf, richtete mit der rechten Hand die von der Zeitung verdeckte Waffe auf den Kopf des ahnungslosen Ba., drückte beide Abzüge zugleich ab, was ohne Mühe möglich war, und zog die Haustür eilig von draussen zu. Dann zerdrückte er die Gegenampulle, atmete den Inhalt ein und lief in Richtung zum Hofgarten. Den Nachschlüssel warf er ohne besondere Überlegung in ein Gully, die Waffe wiederum in den K.bach.“
Beim Mord an Bandera war die Waffe mit zwei Ampullen Blausäure geladen, um den eigentlich erwarteten Leibwächter gegebenenfalls auch umzubringen. Angeblich sei er dabei – laut seiner späteren Aussage – hin und her gerissen und „wie in einem Trancezustand“ gewesen, als er schließlich die Säure versprühte.
Das war damals also die übliche KGB–Methode, um unliebsame Regimekritiker aus dem Verkehr zu ziehen!
Soweit so schlecht.
Genauso wie Bandera wurde auch Rebet heimtückisch getötet.
Also ermordet, denn Heimtücke ist laut § 211 StGB eines der Tatbestandsmerkmale für Mord. Zumindest diesbezüglich waren sich die fünf Richter in den roten Roben einig, denn heimtückisch tötet, wer das Opfer unter bewusster Ausnutzung von dessen Arg- oder Wehrlosigkeit umbringt.
Das Gericht führte aus:
„R. wie B. waren im Augenblick der Tatausführung in dem dargelegten Sinne arglos. R. hatte soeben ein an belebtester Stelle Münchens gelegenes Bürogebäude, in dem sich seine Arbeitsräume befanden, B. sein gewöhnlich und auch am Tattage abgeschlossenes Wohnhaus betreten. Beide hatten zur Tatzeit in Richtung auf den Angeklagten keinerlei Argwohn. Beide Taten geschahen von einem den Opfern Fremden, in völlig unverfänglicher, keinen Argwohn erregender Weise blitzartig aus nächster Nähe. Sie schlossen jede Gegenwehr praktisch aus und schon nach dem ersten Atemzug des Opfers auch jede Aussicht auf Rettung. Dieser Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer und aller Umstände, auf denen sie beruhte, war sich St. bewußt. Er hat sie zu den beiden Attentaten geradezu ausgenutzt. Seine Auftraggeber hatten sie von vornherein eingeplant.“
Staschynskij hatte also Rebet und Bandera höchstpersönlich umgebracht. Auch diesbezüglich gab es seitens des Gerichts keine Zweifel mehr. Beide waren jedenfalls tot und Staschynskij wurde von seinem Auftraggeber dafür geehrt.
Für seine Verbrechen bekam Staschynskij den „Kampforden vom Roten Banner“, was auch immer das bedeuten mag. In der „Laudatio“ hieß es selbstverständlich nicht, dass der Orden für mindestens zwei Morde verliehen wurde. Verliehen wurde der Orden „für die Durchführung eines wichtigen Regierungsauftrages“ oder wie es in seiner dienstlichen Beurteilung durch den KGB hieß: „für die Bearbeitung eines wichtigen Problems“.
Staschynskij bekam aber nicht nur den Rotbanner-Orden, er durfte auch mit Erlaubnis des Komitees für Staatssicherheit – O-Ton „Die Welt“ 1962 – „das Ostberliner FDJ Mädchen Inge F.“ heiraten. Seine Frau war eine gelernte Friseuse.
Da Banderas Tod zu einiger Aufregung in Emigrantenkreisen und in der Bundesrepublik geführt hatte, wurde Staschynskij erst einmal aus dem Verkehr gezogen und nach Moskau zurückbeordert. Dort wohnte er gemeinsam mit seiner Frau, die sich für ihre große Liebe ebenfalls verpflichten musste, für den KGB tätig zu sein.
Staschynskij wäre ein hoch dekorierter Mann jenseits des Eisernen Vorhangs gewesen. In der BRD hätte es zwei ungesühnte und vielleicht noch unentdeckte Verbrechen gegeben, wenn alles wie immer gelaufen wäre.
Es kam jedoch ganz anders.
Das Problem für die bundesdeutsche Justiz entstand um den 13. August 1961, jenem bedeutsamen Datum im deutsch-deutschen Verhältnis – beziehungsweise Nichtverhältnis – und im Kalten Krieg, denn zum Zeitpunkt des Baus der Berliner Mauer war Staschynskij bereits mit seiner deutschen Ehefrau nach Westberlin geflüchtet. Dort kam er kurze Zeit später, am 1. September 1961, in Untersuchungshaft. Staschynskij hatte sich selbst angezeigt. Die Selbstbezichtigungen des Mannes vom KGB wurden von den zuerst ungläubig staunenden Ermittlungsbeamten ziemlich lange geprüft, ehe Anklage erhoben wurde.
Die Gründe und die Umstände der Flucht waren allerdings etwas nebulös. Angeblich hatte Staschynskij sich unter dem Einfluss seiner Frau, der er seine Taten reumütig gebeichtet hatte – vollkommen gewandelt. Soll ja schon mal vorkommen in einer Ehe. Außerdem soll die innerliche Umkehr angeblich schon unmittelbar nach seinem Mord an Bandera begonnen haben, als er sein totes Opfer bei einem Kinobesuch in der Wochenschau sah und er sich seiner Taten richtig bewusst geworden wäre.
Endgültig mit seiner Heimat und seinem „erlernten Beruf“ gebrochen hat er laut BGH aber erst einige Zeit später, als er – sinnigerweise bei der Ungeziefersuche im Schlafzimmer – eine Wanze, allerdings eine elektronische, fand. Das Gericht:
„Auch entdeckten beide eines Tages bei der Wanzensuche im Zimmer eine verborgene Abhörvorrichtung. S. stellte durch einen Versuch mit seinem Tonbandgerät fest, dass versteckte Mikrofone vorhanden sein mussten. Daraufhin besprachen sie sich über Wichtiges nur noch mit Hilfe von Zetteln und auf Spaziergängen. Ihre Verwandtenpost wurde ganz offenkundig zensiert.“
Ziemlich mysteriös das Ganze. Seine Frau durfte aus Moskau im März 1961 nach Ostberlin reisen, um ihr Kind zu bekommen. Als das Kind im August starb, durfte Staschynskij zum Begräbnis nachreisen. Dies war die Chance zur Flucht. Angeblich gelang sie am 11. August, trotz starker Bewachung von KGB-Agenten. Am 12. August 1961 zeigte er sich dann selbst bei der Polizei in Westberlin an.
Schon irgendwie seltsam. Man traute ihm offensichtlich nicht mehr so ganz in Moskau. Wieso hätte man ihm sonst Bewacher auf die Reise mitgeschickt? Man installierte Wanzen in seiner Wohnung und kurz vor dem Bau der Mauer darf er nach Berlin. Komisch. Er durfte also dorthin, wo es die allerletzte Möglichkeit gab, noch einigermaßen ungeschoren durch den bald vollkommen dichten Eisernen Vorhang zu entkommen. Zwei Tage später wäre auch dieses Schlupfloch versperrt gewesen.
Diese Tatsache gab Raum für Spekulationen.
Die Ostpresse bestritt natürlich jegliche Beteiligung Staschynskijs an den Morden und behauptete selbstverständlich, dass die ganze Geschichte erstunken und erlogen sei, um mittels antikommunistischer Kampfpropaganda die Sowjetunion zu diskreditieren. Nach ihrer Interpretation sei der wirkliche Mörder ein Mitglied einer Emigrantenorganisation gewesen.
Nun denn, im Westen jedenfalls glaubte man ihm nach einigem Zögern seine Geschichte. Deshalb stand er dann also vor Gericht.
Um den reuigen Sünder Staschynskij, dem eine lebenslange Freiheitsstrafe nahezu gewiss schien, zu einer kürzeren Strafe verurteilen zu können, bemühten sich die bundesdeutschen Gerichte mit einem Kunstgriff um Abhilfe. Es war sozusagen die Vorwegnahme der damals noch nicht existierenden und heute noch ziemlich umstrittenen Kronzeugenregelung.
Beide Attentate waren dem Angeklagten von höchster sowjetischer Stelle – von einem Regierungsgremium – befohlen worden.
(Anm. d. Verf.) Nach Stalins Tod 1953 wurden derartige Befehle nur noch von einem aus mehreren Regierungsmitgliedern bestehenden Gremium, nicht mehr direkt vom KGB, beschlossen.
Staschynskij war bereits seit 1950 KGB-Agent und von Januar 1956 an – nach entsprechender Schulung in Kiew – im Bundesgebiet tätig. Sein Agentenführer in Deutschland war in Ostberlin zuhause. Die Lebensgewohnheiten Rebets hatte Staschynskij vom Frühjahr bis Sommer 1957 ausführlich ausspioniert. In Berlin-Karlshorst sei ihm angeblich der erste Mordauftrag erteilt worden. Der zweite Mordauftrag folgte dann später in Moskau.
Der Bundesgerichtshof stellte fest:
„St‘s. Auftraggeber haben bei der Anordnung beider Attentate deren wesentliche Merkmale (Opfer, Waffe, Gegenmittel, Art der Anwendung, Tatzeiten, Tatorte, Reisen) vorher festgelegt. Sie haben vorsätzlich gehandelt. Die auf ihr Geheiß angefertigte, „schon mehrfach und stets mit Erfolg verwendete“ Giftpistole, die Tataufträge und -anweisungen im einzelnen beweisen, daß sie sich dabei Tötungen unter bewußter Ausnutzung der Arg- oder Wehrlosigkeit der Opfer und die Ausführung dieser Taten in dieser Weise, also Morde, vorgestellt und daß sie diese Morde gewollt haben. Als Taturheber, Drahtzieher im eigentlichsten Sinne, hatten sie Täterwillen, ohne daß dabei in rechtlicher Beziehung feststehen muß, welche Einzelpersonen diesen Täterwillen gehabt haben.“
Und jetzt kommt’s:
„Diese eigentlichen Taturheber sind daher Täter, und zwar mittelbare Täter. (…) Entgegen der Auffassung der Bundesanwaltschaft, die den Angeklagten als Täter ansieht, dies jedoch nicht näher begründet hat, war St. in beiden Fällen nur als Mordgehilfe zu verurteilen (§ 49 StGB).“
Das ist natürlich ein dickes Ding! Staschynskij, der höchstpersönlich mindestens zwei Menschen umbrachte, war auf einmal kein Täter mehr, sondern nur Gehilfe irgendwelcher obskuren Hintermänner. Das soll man mal einem klar denkenden Menschen erklären! Der Bundesgerichtshof versuchte es mit folgender Begründung:
„Gehilfe ist, beim Morde wie bei allen anderen Straftaten, wer die Tat nicht als eigene begeht, sondern nur als Werkzeug oder Hilfsperson bei fremder Tat mitwirkt. Maßgebend dafür ist die innere Haltung zur Tat. (…) Danach (…) kann insbesondere auch derjenige bloßer Gehilfe sein, der alle Tatbestandsmerkmale selber erfüllt, wenn ein solcher Tatteilnehmer meist auch als Täter zu verurteilen sein wird.“
Aha! Staschynskij war nur ein Werkzeug. Wirklich?
Zwar verdeutlichte das Gericht, dass staatlich befohlene Verbrechen die Tatbeteiligten keineswegs von der strafrechtlichen Schuld befreien, da sonst jede Ordnung aufgelöst und den politischen Verbrechen Tür und Tor geöffnet wäre. Der Bundesgerichtshof interpretierte daher:
„Der innere Grund des Schuldvorwurfs liegt darin, daß der Mensch auf freie, verantwortliche, sittliche Selbstbestimmung angelegt und deshalb befähigt ist, sich für das Recht und gegen das Unrecht zu entscheiden, sein Verhalten nach den Normen des rechtlichen Sollens einzurichten und das rechtlich Verbotene zu vermeiden, sobald er die sittliche Reife erlangt hat und solange die Anlage zur freien sittlichen Selbstbestimmung nicht durch (…) krankhaften Vorgänge vorübergehend gelähmt oder auf Dauer zerstört ist. Daran ist auch für den Bereich verbrecherischer Regime festzuhalten.“
Jedoch kann es nach Ansicht des Gerichts unter bestimmten Umständen mildernde Umstände geben, falls der Täter nicht:
„politischer Mordhetze willig nachgibt, sein Gewissen zum Schweigen bringt und fremde verbrecherische Ziele zur Grundlage eigener Überzeugung und eigenen Handelns macht oder (…) dafür sorgt, daß solche Befehle rückhaltlos vollzogen werden, oder wer dabei anderweit einverständlichen Eifer zeigt oder solchen staatlichen Mordterror für eigene Zwecke ausnutzt (…).“
Mildernde Umstände sollen also dann gegeben sein, wenn der Täter die Verbrechensbefehle an sich missbilligt und sie ihm widerstreben, er sie aber aus menschlicher Schwäche ausführt, weil er der Übermacht der Staatsautorität nicht gewachsen ist und ihr nachgeben muss.
Was? Ist das nicht eine billige Entschuldigung für Mörder? Für Mörder, die sich immer schon auf einen übergeordneten Befehl berufen haben? Sind sie etwa dann keine Mörder mehr, wenn ihnen „Vater Staat“ den Mord befiehlt? Befehl ist Befehl, oder wie ist diese Begründung zu verstehen? Immerhin führte das Gericht des Weiteren aus:
„Es besteht kein hinreichender rechtlicher Grund, solche Menschen ausnahmslos und zwangsläufig von vornherein schon in der Beteiligungsform dem Taturheber, dem bedenkenlosen Überzeugungstäter und dem überzeugten, willigen Befehlsempfänger gleichzusetzen (…).“
Also ganz langsam. „Befehl ist Befehl“ soll zwar nicht grundsätzlich als Entschuldigung gelten, aber bei Staschynskij dann wohl doch.
Eine nur schwer nachvollziehbare Begründung bei diesen heimtückischen Taten. Sie ist wohl nur angesichts der damals herrschenden politischen Verhältnisse zu erklären. Der Bundesgerichtshof hatte angesichts des Kalten Krieges weniger juristisch als politisch entschieden. Man wollte dem Überläufer die gesetzlich vorgesehene Strafmilderung für einen Gehilfen ermöglichen.
Laut Bundesgerichtshof soll Staschynskij also – bei seinen in Deutschland begangenen Taten – in Wirklichkeit nur dem eigentlichen Täter, dem in Moskau verbliebenen Chef des KGB, Beihilfe zu dessen zwei Morden geleistet haben.
Das Gericht begründete dies damit, dass Staschynskij
„ohne Interesse an dem Erfolg der Tat“
gewesen sei.
Er ermordete zwar zwei Menschen, aber eigentlich war es ihm vollkommen egal. Er sprühte den Opfern zwar höchstpersönlich Blausäure ins Gesicht, aber beherrschte laut Gericht offenbar nicht den Geschehensablauf, denn laut Gericht täte er das nur, wenn:
„Durchführung und Ausgang der Tat maßgeblich auch von seinem Willen abhänge.“
Deshalb war er nicht als Täter, sondern lediglich als Gehilfe zu verurteilen.
Seltsames Gerechtigkeitsverständnis.
Aus diesen Gründen wurde er – obwohl die Bundesanwaltschaft auf zweimal lebenslänglich Zuchthaus wegen zweifachen Mordes und drei Jahren Gefängnis wegen verräterischer Beziehungen plädiert hatte – nur zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.
Das Gericht fuhr in seiner dem Kalten Krieg geschuldeten Begründung fort:
„Solche bloßen Befehlsempfänger (…) befinden (…) sich in der sittlich verwirrenden, mitunter ausweglosen Lage, vom eigenen Staat, der vielen Menschen bei geschickter Massenpropaganda nun einmal als unangezweifelte Autorität zu erscheinen pflegt, mit der Begehung verwerflichster Verbrechen geradezu beauftragt zu werden. Sie befolgen solche Anweisungen unter dem Einfluß politischer Propaganda oder der Befehlsautorität (…) ihres eigenen Staates (…).“
Arme Bewohner hinter dem Eisernen Vorhang, kann man da wohl nur sagen. Waren wohl fast alle nur „sittlich verwirrte“ Befehlsempfänger! Das Gericht hatte den wahren Täter deutlich im Blickfeld. Obwohl Stalin schon längst nicht mehr lebte, war der böse Bolschewik immer noch – auch in den Richterköpfen – deutlich präsent:
„Diese gefährlichen Verbrechensantriebe gehen statt von den Befehlsempfängern vom Träger der Staatsmacht aus, unter krassem Mißbrauch dieser Macht. Derartige Verbrechensbefehle bleiben nicht einmal auf den eigenen Staatsbereich beschränkt.“
(Anm. d. Verf.) Hinsichtlich der Diktion und der Entscheidungen damaliger Urteile ist erkennbar, dass der „Kalte Krieg“ heftig tobte. Während in der DDR extra dafür geschulte Volksrichter eingesetzt wurden, die dem System zumeist treu ergeben waren und die die in den Parteischulungen vorgegebenen Maßgaben umsetzten, kam in der BRD der größte Teil der nach Ende des Zweiten Weltkrieges zunächst suspendierten Richter nach und nach in den Justizdienst zurück und damit mitunter auch ein unseliger „Korpsgeist“ aus vergangenen Nazitagen. (Vgl. E. Reuß, Millionäre fahren nicht auf Fahrrädern, Berlin 2012.)
Für den offensichtlich überaus altruistischen Staschynskij selbst hatte das Gericht dagegen ziemlich viel Verständnis:
„(…) unter Berücksichtigung aller Umstände, daß er diese Taten nicht als eigene gewollt, daß er kein eigenes Interesse an ihnen und keinen eigenen Tatwillen gehabt, daß er sich fremdem Täterwillen nur widerstrebend gebeugt, daß er sich letztlich der Autorität seiner damaligen politischen Führung wider sein Gewissen unterworfen und daß er die Tatausführung in keinem wesentlichen Punkte selber bestimmt hat. Ein eigenes materielles oder politisches Interesse als Indiz für seinen Täterwillen hat nicht bestanden. Ihm ist kein Tatlohn versprochen worden, wie einem gedungenen Handlanger, und er hat auch keinen erhalten.“
Wie das Gericht zu dieser Ansicht kam, lässt sich aus dem Urteil leider nicht entnehmen. Aber offenbar hat man den Aussagen des Angeklagten Glauben geschenkt.
Mord sei in seiner Heimat üblich gewesen erklärte Staschynskij während des Verfahrens. Auch in dem 1000-Seelen-Dorf in der Nähe von Lemberg, in dem er geboren wurde, sollen Morde an der Tagesordnung gewesen sein. Es gab Auseinandersetzungen zwischen ukrainischen Nationalisten und der Sowjetherrschaft. Seine Eltern und seine Schwestern standen dabei vollkommen auf Seiten der ukrainischen Nationalisten.
Nicht aus Überzeugung, aber weil noch Studienplätze frei waren, hatte sich Staschynskij nach der Schulzeit dazu entschlossen Lehrer zu werden. Es kam jedoch – wie wir wissen – anders. Nachdem der mittellose Staschynskij auf der Fahrt von seinem Studienort in die Heimat beim Schwarzfahren erwischt worden war, wurde er für den KGB rekrutiert. Eine damals (und wohl auch noch heute) durchaus übliche Praxis der Geheimdienste: „Mach etwas für uns und wir lassen die Anklage fallen.“ „So schlimm wird es schon nicht werden“, denkt sich dann wohl meist der angeworbene Delinquent. Im Prozess sagte Staschynskij zu seinem Verrat an Eltern und Geschwistern:
„Ich habe vieles im Dorf gehört und auch gesehen, wie eines Nachts eine polnische Siedlung überfallen und niedergebrannt wurde. Alle männlichen Bewohner sind erschossen worden. Ich habe gesehen, wie man ukrainische Bauern aufhängte, weil sie freiwillig der Kollektivierung beitraten. In meinem Elternhaus wurden diese Aktionen der Widerstandsgruppen gebilligt. Ich aber wollte, daß in meiner Heimat endlich Ruhe einkehre.“
Für seine Mitarbeit als Agent würde man das Sympathisieren seiner Eltern mit den Widerständlern und die aktive Hilfe der Schwestern angeblich vergessen. Nur deswegen sei er Agent geworden und hatte ukrainische Widerstandskämpfer aufgespürt. Das teilte er jedenfalls dem 3. Senat des Bundesgerichtshofes und den Zuhörern mit.
Selbst die verliehenen Orden wurden daher vom Gericht nicht als Lohn für die üble Tat gewertet, sondern:
„Die Ordensverleihung hat ihn überrascht und abgestoßen. Er konnte sich ihr nicht entziehen.“
Der arme Staschynskij!
Musste auch noch die ihn abstoßende, überraschende Ordensverleihung über sich ergehen lassen. Sein Verteidiger sprach zuvor in seinem Abschlussplädoyer gar von einer „gemarterten slawischen Seele“ und dass die pseudowissenschaftliche Sowjetideologie für die mystisch veranlagten Slawen eine Ersatzreligion gewesen sei, für die das deutsche Strafgesetzbuch eigentlich nicht vorgesehen wäre.
Wie?
Das Strafgesetzbuch sei für freie, bürgerliche Individuen bestimmt, nicht für die Aburteilung eines sich selbst entfremdeten politischen Werkzeuges.
Ach so!?
Sein Verteidiger wollte sogar prüfen lassen, ob die ideologische Dressur seinen freien Willen „verbogen“ hätte und er demnach eigentlich schuldunfähig sei.
Selbst die Vertreter der Nebenklägerinnen, die Anwälte der Witwen von Bandera und Rebet, zeigten Mitgefühl. Einer der Anwälte meinte, dass Staschynskij ein armer Teufel sei, es sich zwar wohl um Mord handeln würde, er persönlich aber Mitgefühl für Staschynskij empfinde. Der andere Anwalt meinte sogar, dass nur ein geringer zu bestrafender Totschlag und kein Mord vorliegen würde. Er hatte offensichtlich dieselbe Ansicht wie der Verteidiger Staschynskijs, der in seinem Schlussplädoyer behauptet hatte, dass die Ermordeten gar nicht arglos gewesen seien, da sie ja eigentlich immer mit Attentaten rechnen mussten, von Heimtücke daher überhaupt nicht gesprochen werden könne. Ganz schön zynisch.
Folgt man der Begründung des Gerichts, könnte man fast Mitleid haben, mit dem gedungenen Killer. Mit einem Mafia-Killer hätte das Gericht wohl sicherlich weniger Mitleid gehabt. Das Gericht führte aus:
„R. und B. als „zu beseitigende Feinde der Sowjetunion“ anzusehen, entsprang nicht seiner eigenen politischen Eingebung. Solche Vorstellungen sind ihm, ohne daß sie ihm zur festen Maxime geworden wären und sein Gewissen betäubt hätten, von Jugend auf ohne wirklichen Erfolg indoktriniert worden. Er hat ihnen im Grunde nie geglaubt, sondern sich im Tatzeitpunkt damit nur zeitweilig zu beschwichtigen gesucht. Das ist ihm nur ganz vorübergehend gelungen. Die Tatschuld hat sein Gewissen dann nur weiter angestachelt. Er hätte seine Taten auch nicht, wie die nationalsozialistischen Verbrecher, nach den politischen Umständen zwangsweise sühnen müssen. Er ist der sittlich unausweichlichen Sühne im Gegenteil unter Lebensgefahr nachgegangen, sobald er erkannt hatte, daß er zum „Berufsmörder“ mißbraucht werden sollte. Das regelmäßig für Täterwillen sprechende Anzeichen eigenhändiger Tatbegehung hat unter diesen Umständen diese rechtliche Bedeutung nicht. Die Auftraggeber St‘s. haben in beiden Fällen das Ob und Wie der Tat beherrscht. Sie haben die Tatentschlüsse gefaßt, die Opfer bestimmt, die Waffen und das Gift ausgewählt und erprobt, den Angeklagten als Tatwerkzeug befohlen, sie haben die sorgfältig geplanten „Legenden“ vorgeschrieben, die Reisen nach M. und deren Dauer genau bestimmt und bis ins einzelne angeordnet, wo und wann die Taten auszuführen seien. Allerdings hat St. beide Taten außerhalb des Machtbereichs seiner Auftraggeber begangen. Jedoch auch dies macht ihn nicht zum Täter. Zu meinen, er hätte sich doch nur westlichen Behörden zu offenbaren brauchen, hieße die wahre Sachlage verkennen.“
Und ganz deutlich wird der „brodelnde Kalte Krieg“ bei der weitergehenden Begründung:
„Dem Angeklagten ist es zu glauben, daß jemand, der elf Jahre hindurch als bildsamer junger Mensch ununterbrochen im Kern des sowjetischen Machtbereichs zugebracht hat und dort ständig indoktriniert worden ist, große Schwierigkeiten damit hat, westliche Lebens- und Denkweise zu verstehen, sich in sie hineinzufinden, Heimat, Verwandte und vertrauten Sprachraum für immer zu verlassen und dafür unbekannte Umstände, Gefahren und Einflüsse auf sich zu nehmen, selbst wenn er hier schon eine persönliche Bindung hat.“
Armer, sittlich verwirrter Staschynskij, der große Schwierigkeiten damit hatte, die westliche Lebens- und Denkweise zu verstehen. Wohlgemerkt, er war – wie wir erfahren hatten – mit einer deutschen Frau, dem „FDJ Mädchen Inge“ verheiratet!
Das Gericht fuhr fort:
„Auch hat er bisher keinen Beruf erlernt, der ihn ernähren kann.“
Jetzt wird es aber ganz abstrus. Staschynskij bekommt mildernde Umstände, weil er nichts Anständiges gelernt hat. Er war gezwungen Menschen zu killen, damit er sich ernähren konnte. Was für eine absonderliche Vorstellung!
Mit einigermaßen geradlinigem Denkvermögen lässt sich diese Begründung wohl nicht ganz nachvollziehen.
Immerhin im Folgenden ist dem Gericht wahrscheinlich zuzustimmen:
„Wegen des erteilten „wichtigen Regierungsauftrags“ ist ihm ferner zu glauben, daß er damals gefürchtet hat, vor und bei den Attentaten im sorglosen „Westen“ vom KGB überwacht zu werden und nach einem Übertritt als „Verräter“ der Rache seiner Auftraggeber ausgesetzt zu sein.“
Doch hier wird es wieder fragwürdig:
„Das Gesamtbild aller Tatumstände spricht daher nicht für Täterschaft des Angeklagten. Daher war er als Gehilfe zu verurteilen.“
Das Urteil des Landgerichts wurde vom Bundesgerichtshof bestätigt, der dabei die griffige Formel verwendete „Täter ist, wer die Tat als eigene will“ und damit argumentierte, Staschynskij habe seine Taten als fremde, nämlich als Taten des KGB-Chefs gewollt und statt Täterwillen nur Gehilfenwillen gehabt.
Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges sollte das Urteil wohl ein Signal an ausländische Geheimdienstler senden, wer bei solchen Taten mit welchen Konsequenzen zu rechnen hat. Der KGB soll seit diesem Fall „Mord als gewöhnlichem Mittel zur Erreichung politischer Ziele außerhalb des sozialistischen Lagers“ eine Absage erteilt haben.
„Die Welt“ kommentiert 1962 das Urteil so:
„Dieser Bogdan Staschynskij über den am Wochenende so viel gesprochen wurde, scheint ein Glückspilz zu sein – wenn auch ein für andere Leute giftiger. Er bespitzelte in seiner Heimat, einem kleinen Bauerndorf bei Lemberg, Vater; Mutter und Schwestern und wurde doch mit offenen Armen im Elternhaus wieder aufgenommen. Er verriet ukrainische Freiheitskämpfer an die Sowjets, aber entging dem Schicksal, dafür mit dem Kopf nach unten aufgehängt zu werden. Er trieb sich 1956 als Agent in der Bundesrepublik herum, wurde dabei photographiert, aber nicht verhaftet. Er tötete in München auf eine hinterhältige Art die beiden Exil-Ukrainer Rebet und Bandera, aber die Bundesrichter verurteilten ihn nicht wegen Mordes zu lebenslänglich, sondern wegen Beihilfe zu nur acht Jahren Zuchthaus. Dicke Mauern schützen jetzt diesen Bogdan Staschynskij vor der Rache des von ihm in dem Prozeß vor dem Bundesgericht bloßgestellten sowjetischen Geheimdienst.“
Staschynskij lebt – wenn er noch nicht gestorben ist – oder lebte wahrscheinlich nach seiner vorzeitigen Haftentlassung unter einer neuen Identität in der Bundesrepublik Deutschland, möglicherweise auch in den USA.
Um solch merkwürdig anmutenden Urteile zukünftig zu verhindern, wurde Jahre später in § 25 StGB mit der Formulierung: „Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht.“, ausdrücklich klarzustellen versucht, dass jeder, der die Tat persönlich verwirklicht, auch als Täter zu betrachten sei.
Quellen:
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20.10.1959;
Neues Deutschland vom 21.10.1959;
Die Welt vom 5.10.1962 und 7.10.2007;
BGHSt 18, 87 Urteil vom 19.10.1962 Az. 9 StE 4/62.
Der Katzenkönig
Ganz anders war es 1988, als der Bundesgerichtshof über den sogenannten Katzenkönig-Fall zu entscheiden hatte. Dort gab es drei Angeklagte, die laut Gericht
„in einem von ‚Mystizismus, Scheinerkenntnis und Irrglauben’ geprägten ‚neurotischen Beziehungsgeflecht’“
zusammenlebten.
Das Landgericht Bochum als erstinstanzliches Gericht hatte zuvor zwei der drei Angeklagten zu lebenslanger Haft und den dritten zu neun Jahren Haft und Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus verurteilt.
Dieser Dritte – Michael R. – hatte versucht, Annemarie N. eigenhändig umzubringen. Daran gab es keinen Zweifel.
Die beiden anderen Angeklagten, Barbara H. und Peter G., hatten gemeinsam dem offenbar leicht beeinflussbaren Michael erfolgreich weisgemacht, dass Barbara von Zuhältern und Gangstern bedroht würde. Michael – er war Polizist und schien ziemlich verliebt in Barbara zu sein – fühlte sich fortan als Barbaras Bodyguard und bewachte sie rund um die Uhr mit Argusaugen.
Barbara und Peter fanden das wohl lustig und trieben weiterhin ihre boshaften Possen mit R.
Er musste von nun an alle möglichen Mutproben bestehen, sich katholisch taufen lassen und Barbara auf Knien ewige Treue schwören.
Doch damit nicht genug.
Mit schauspielerischen Tricks, dem Vorspiegeln hypnotischer und hellseherischer Fähigkeiten und mit angeblich mystischen Kulthandlungen brachte das boshafte Paar Michael dazu, an die Existenz eines „Katzenkönigs“ zu glauben.
Dieser angeblich real existierende Katzenkönig verkörperte nach ihrer Schilderung seit Jahrtausenden das Böse in der Welt und war – warum auch immer – gerade jetzt eine unmittelbare Bedrohung für die Menschheit.
Barbara und Peter hatten wohl einen Heidenspaß dabei, derartige Spielchen zu treiben.
Michael jedenfalls glaubte fest daran und, wie das Gericht feststellte,
„wähnte sich schließlich auserkoren, gemeinsam mit den beiden anderen den Kampf gegen den ‚Katzenkönig’ aufzunehmen.“
Geschichten, die das Leben schreibt, aber die man kaum zu glauben wagt!
Als Barbara jedoch 1986 von der Heirat ihres früheren Freundes Udo N. erfuhr, war der Spaß schlagartig vorbei. Die krankhaft eifersüchtige Verflossene entschloss sich dazu, dessen frisch geehelichte Frau Annemarie umbringen zu lassen.
Michael war das perfekte Werkzeug für ihren perfiden Plan.
Peter, dem der um Barbara buhlende Michael inzwischen sowieso ein Dorn im Auge war, gefiel dieser Plan ebenfalls, denn indem er ihn zum Sündenbock machte, konnte er seinen Mitbewerber möglicherweise loswerden.
Das Gericht fuhr fort:
„In stillschweigendem Einverständnis mit P., der – wie sie wußte – seinen Nebenbuhler loswerden wollte, spiegelte die Angeklagte H. dem R. vor, wegen der vielen von ihm begangenen Fehler verlange der ‚Katzenkönig’ ein Menschenopfer in der Gestalt der Frau N.; falls er die Tat nicht binnen einer kurzen Frist vollende, müsse er sie verlassen, und die Menschheit oder Millionen von Menschen würden vom ‚Katzenkönig’ vernichtet.“
Michael war nun in einer Zwickmühle. Sollte er etwa für die Vernichtung der Menschheit verantwortlich sein? Das wollte er sicherlich nicht. Aber jemanden umbringen? Nein! Er war schließlich Christ und berief sich daher auf das fünfte Gebot: „Du darfst nicht töten“.
Doch auch diese Skrupel konnten Barbara und Peter entkräften. Sie erklärten dem armen, an Gewissensbissen leidenden Michael durchaus nachdrücklich, dass das Tötungsverbot in diesem Fall nicht gelten würde, da dies ein göttlicher Auftrag sei und man schließlich die Menschheit retten, also höhere Werte verteidigen müsse.
Letztendlich hatten sie ihn überzeugt und Michael erklärte sich zur Tat bereit.
Das Gericht beschrieb das so:
„Nachdem er Barbara H. ‚unter Berufung auf Jesus‘ hatte schwören müssen, einen Menschen zu töten, und sie ihn darauf hingewiesen hatte, daß bei Bruch des Schwurs seine ‚unsterbliche Seele auf Ewigkeit verflucht’ sei, war er schließlich zur Tat entschlossen. Ihn plagten Gewissensbisse, er wog jedoch die ‚Gefahr für Millionen Menschen ab’, die er ‚durch das Opfern von Frau N.’ retten könne.“
Nach weiterer Überzeugungsarbeit von Barbara und Peter, die auch den Mordplan ausarbeiteten, schritt Michael im Juli 1986 zur Tat. An einem Mittwoch, kurz vor Feierabend, ging er in Annemarie N.s Blumenladen und stach ihr heimtückisch mit einem Fahrtenmesser hinterrücks in den Hals, in das Gesicht und in den Körper. Passanten kamen herbeigeeilt und er musste fliehen. Doch es war schon zu spät, er wurde erkannt und nicht viel später festgenommen. Michael R. war sich zum Zeitpunkt seiner Flucht vollkommen sicher, dass er Annemarie getötet hatte. Diesbezüglich sollte er sich glücklicherweise irren. Frau N. überlebte.
Im Urteil des BGH klang das so:
„Am späten Abend des 30. Juli 1986 suchte R. Frau N. in ihrem Blumenladen unter dem Vorwand auf, Rosen kaufen zu wollen. Entsprechend dem ihm von P. – im Einverständnis mit Barbara H. – gegebenen Rat stach R. mit einem ihm zu diesem Zweck von P. überlassenen Fahrtenmesser hinterrücks der ahnungs- und wehrlosen Frau N. in den Hals, das Gesicht und den Körper, um sie zu töten. Als dritte Personen der sich nun verzweifelt wehrenden Frau zu Hilfe eilten, ließ R. von weiterer Tatausführung ab, um entsprechend seinem ‚Auftrag’ unerkannt fliehen zu können; dabei rechnete er mit dem Tod seines Opfers, der jedoch ausblieb.“
Michael, der leichtgläubige Polizist wurde also von den anderen beiden zu dieser Tat getrieben!
Das erinnert an den Sirius-Fall. Nur, dass es sich diesmal nicht um eine straflose Selbsttötung handelte, sondern um versuchten Mord. Aber es ähnelt auch dem Staschynskij-Fall.
War Michael – wie im Sirius-Fall – also nur ein Werkzeug der anderen? Oder – wie im Staschynskij-Fall – lediglich Gehilfe, hier von Barbara und Peter?
Nein, denn das Gericht ließ keine derartigen Vergleiche gelten und entschied:
„R. hat ‚eigenhändig in Tötungsabsicht auf Frau N. eingestochen, um seinen Auftrag zu erfüllen’; dabei nutzte er ihre Arg- und Wehrlosigkeit bewußt aus.“
Die Tatsache, dass das Opfer völlig ahnungslos, also arg- und wehrlos, in seinem Blumengeschäft arbeitete und Michael sich dies bei seinem Überraschungsangriff zum Vorteil machte, war natürlich heimtückisch. Das Tatbestandsmerkmal für Mord war erfüllt. Also versuchter Mord. Das Gericht führte weiter dazu aus:
„Der Mordversuch war beendet, da der Angeklagte nach Abschluß der letzten Ausführungshandlung glaubte, der Erfolg werde eintreten. (…) Zutreffend hat das Landgericht auch angenommen, daß der Angeklagte für sein Tun verantwortlich gewesen ist. Die sachverständig beratene Strafkammer hat sich die Überzeugung verschafft, daß der Angeklagte nicht schwachsinnig ist und nicht an einer krankhaften seelischen Störung leidet.“
Michael war also nicht schwachsinnig, deshalb war er auch Täter.
Staschynskij war auch nicht schwachsinnig, trotzdem wurde der nur als Gehilfe verurteilt. Beim Sirius-Fall wurde der eigentliche „Anstifter zum Selbstmord“ als mittelbarer Täter verurteilt.
Doch in diesem Fall, bei einer Person, die an einen imaginären „Katzenkönig“ glaubt, soll das nun wieder ganz anders sein? Obgleich es sich bei Michael laut Gericht:
„um eine ‚hoch abnorme Persönlichkeit’ (handelt), die ‚neurotisch tiefgreifend gestört und deformiert’ ist.“
So jemand sollte nun – trotz des Einflusses der Barbara und des Peter – Täter sein? Obwohl das Gericht feststellte, dass dieser Zustand auf die „erfolgreiche Überzeugungsarbeit der Angeklagten H. und P.“ zurückzuführen war und bei Michael zu einer „Wahngewissheit“ führte!
Eine „Wahngewissheit“ also! Soll wohl bedeuten, dass er in seinem Wahn vollkommen davon überzeugt war, das Richtige zu tun. War er etwa doch nur ein willenloses, schuldunfähiges Werkzeug seiner beiden Lehrmeister?
Nein!
Laut Gericht war die Einsichtsfähigkeit des R. nicht vollkommen beeinträchtigt, denn:
„er wußte um das Verbotensein der Tötung eines Menschen und er kannte sämtliche Tatumstände. Auch die Steuerungsfähigkeit war nicht aufgehoben, da der Angeklagte sich dem Tatauftrag hätte entziehen können. Daß die Wahnideen und die ‚daraus resultierenden pathologischen Gefühle’ den Angeklagten nach den Ausführungen der Strafkammer erheblich entsteuerten, hat diese durch Anwendung des § 21 StGB berücksichtigt.“
Also keine Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen nach § 20, aber immerhin verminderte Schuldfähigkeit nach § 21 des Strafgesetzbuchs.
Deshalb gab es für ihn, als einzigen der drei Angeklagten, auch kein „Lebenslänglich“.
Laut § 21 StGB kann nämlich die Strafe gemildert werden:
„Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.“
Allerdings hatte das Gericht darüber zu entscheiden, inwieweit sich Michael bei seiner Tat in einem „Irrtum“ befand. Er konnte sich nicht auf Notwehr oder Nothilfe berufen, da er keinem „gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff durch das Opfer“, also keiner Gefahr ausgesetzt war.
Ebenso wurde ein entschuldigender Notstand nach § 35 StGB verneint. Michael wollte keine Gefahr von sich selbst oder jemand anderem abwenden, denn:
„Er selbst fürchtete seinen Tod nicht, weil ihm von H. und P. vorgegaukelt worden war, daß er schon mehrfach gelebt habe und seine Seele sicher wiederkehren werde.“
R. wollte ja die Menschheit retten! Was könnte es Wichtigeres geben? Was zählte da schon ein einzelnes Menschenleben? Michael glaubte ja, bei seiner Tat von höheren Mächten legitimiert worden zu sein. Man könnte ihm möglicherweise deswegen einen Irrtum über eine Notstandslage zugutehalten. Eventuell als rechtfertigenden Notstand nach § 34 Strafgesetzbuch, beziehungsweise als Verbotsirrtum nach § 17 StGB, denn dort heißt es:
„Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte.“
Das wollte das Gericht so dann aber doch nicht gelten lassen, denn:
„Daß der Angeklagte diesen Interessenkonflikt fehlerhaft abgewogen hat, führt als Bewertungsirrtum auch nicht zum Vorsatzausschluß, sondern zu einem (…) vermeidbaren Verbotsirrtum gemäß § 17 StGB. Danach hätte er als Polizeibeamter unter Berücksichtigung seiner individuellen Fähigkeiten und auch seiner Wahnideen bei gebührender Gewissensanspannung und der ihm zumutbaren Befragung einer Vertrauensperson, zum Beispiel eines Geistlichen, die rechtliche Unzulässigkeit einer quantitativen Abschätzung menschlichen Lebens als des absoluten Höchstwertes erkennen können.“
Ein vermeidbarer Verbotsirrtum also. Pech für Michael, dass er Polizist war und seinen Job anscheinend halbwegs passabel bewältigte. Er konnte nach Ansicht des Gerichts also nicht vollkommen verrückt sein.
Michael war somit – wenn auch vermindert – schuldfähig, musste aber trotzdem in ein psychiatrisches Krankenhaus, denn nach § 63 Strafgesetzbuch wird dort derjenige eingewiesen, der eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit begangen hat:
„wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, daß von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.“
Man wusste ja schließlich nicht, ob Michaels Wahnidee zur Rettung der Menschheit von ihm schon vollkommen ad acta gelegt worden war. Möglicherweise trieb der „Katzenkönig“ in Michaels vernebelter Sichtweise noch immer sein Unwesen und musste von ihm mit allen Mitteln bekämpft werden. Darum sollten sich nun die Ärzte kümmern!
So weit, so gut.
Das Urteil hinsichtlich der Schuldfähigkeit von R. konnte man ja durchaus noch nachvollziehen.
Weitaus schwieriger war die Tatsache zu verstehen, dass sowohl Barbara H. als auch Peter G. in erster Instanz ebenfalls wegen versuchten Mordes als Täter verurteilt worden waren. Und zwar, im Gegensatz zu Michael, zu „Lebenslänglich“!
Zwar war ihnen keine Heimtücke bei der Tatbegehung nachzuweisen, denn die Tat hatte ja Michael eigenhändig und weitgehend selbstständig ausgeführt. Aber sie handelten laut Gericht aus niedrigen Beweggründen. Kein tatbezogenes, aber ein täterbezogenes Mordmerkmal.
Wie konnte das sein?
Im Sirius-Fall war es ein an sich strafloser Selbstmordversuch und der Hintermann wurde verurteilt, weil er die potenzielle Selbstmörderin als willenloses Werkzeug gegen sich selbst benutzt hatte. Es gab also keinen unmittelbaren, sondern nur den mittelbaren Täter.
Staschynskij war nicht verrückt, beging eigenhändig Morde und wurde nur als Gehilfe verurteilt, da er angeblich die Taten nicht als eigene Taten wollte, sondern nur im Auftrag des KGB tätig gewesen sein war und nach Auffassung des Gerichts keinen Täterwillen, sondern nur Gehilfenwillen gehabt hatte.
Nun, das klingt schon ziemlich weit hergeholt. Staschynskij war also nur ein Werkzeug gewesen.
Und hier?
Michael ist laut Gericht definitiv kein Werkzeug, sondern ein Täter. Wie gesagt, unter Umständen nachvollziehbar.
Doch auch seine Hintermänner? Sie, die nur im Hintergrund tätig waren, können doch nur der Anstiftung oder der Beihilfe schuldig sein, soweit der unmittelbare Täter schuldfähig ist, oder?
Wollte das Gericht potenzielle Jurastudenten quälen oder hatte es nur selbst den Überblick verloren?
Ein wenn auch vermindert schuldfähiger Täter, der kein Werkzeug eines anderen war und einen Mord eigenhändig beging, ist unmittelbarer Täter. Okay. Aber die Hintermänner, die ihn zur Tat getrieben haben, auch? Laut Gericht: Ja! Barbara und Peter waren demnach keine Anstifter oder Gehilfen, sondern mittelbare Täter!
Ganz schön kompliziert!
Die Frage, ob der Hintermann eines schuldhaft handelnden Täters mittelbarer Täter sein kann, war zuvor höchstrichterlich noch nicht entschieden worden.
Nun tat dies der Bundesgerichtshof.
Er führte aus:
„Die Abgrenzung hängt im Einzelfall von Art und Tragweite des Irrtums und der Intensität der Einwirkung des Hintermannes ab. Mittelbarer Täter eines Tötungs- oder versuchten Tötungsdelikts ist jedenfalls derjenige, der mit Hilfe des von ihm bewußt hervorgerufenen Irrtums das Geschehen gewollt auslöst und steuert, so daß der Irrende bei wertender Betrachtung als ein – wenn auch (noch) schuldhaft handelndes – Werkzeug anzusehen ist.“
Michael also doch so etwas wie ein Werkzeug? Ein – noch – schuldhaft handelndes Werkzeug!
Ganz schön verwirrend!
Laut Gericht hat es sich folgendermaßen abgespielt:
„Einerseits haben die Angeklagten H. und P. beim Angeklagten R. die Wahnideen hervorgerufen und diese später bewußt ausgenutzt, um seine rechtlichen Bedenken wie seine Gewissensbisse auszuschalten und ihn zu veranlassen, die von ihnen beabsichtigte Tat ihren Plänen und Vorstellungen entsprechend auszuführen. Auf diese psychologische Weise steuerten sie die Tatplanung. Darüber hinaus bestimmten sie wesentliche Teile der Tatausführung. P. übergab dem Angeklagten R. die Tatwaffe und erklärte auf dessen Frage, wie er die Tat ausführen solle, er solle von hinten so zustechen, wie es ‘Japaner und Ledernacken im 2. Weltkrieg‘ getan hätten, da das Opfer dann gleich tot sei; Zeugen dürften keine vorhanden sein. An diese wie auch an sonstige Anweisungen hat sich R. gehalten. Andererseits irrte R. bei der Tat nicht nur über das Verbotensein seines Tuns, er war vielmehr darüber hinaus in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeengt. Er befand sich in einem engen Beziehungs- und Einwirkungsgeflecht, das die Angeklagten H. und P. zum Zwecke seiner Steuerung ausgenutzt und so eingesetzt haben, daß er sich ihrem bestimmenden Einfluß nur schwer entziehen konnte.“
Aus diesem Grund wurden sowohl Barbara als auch Peter vom Landgericht zu einer lebenslänglichen Haft verurteilt, während der eigentliche Täter mit neun Jahren recht glimpflich davonkam.
Der Bundesgerichtshof bestätigte diese Urteile, denn nach seiner Auffassung hatten sie Michael „kraft ihrer Einwirkung und ihres überlegenen Wissens beherrscht“ und daher zur Tat bestimmt:
„Sie hatten damit die Tatherrschaft, ohne Mittäter zu sein, weil sie entsprechend ihrem Plan wissentlich und willentlich die objektive Tatbestandsverwirklichung R. allein überlassen haben und dieser seine Tathandlung auch keinem von ihnen zurechnen lassen wollte.“
Alle drei waren damit als Täter anzusehen.
Hinsichtlich der Strafzumessung hob der Bundesgerichtshof die Urteile des Landgerichts jedoch auf, da er der Ansicht war, das Landgericht hätte die unterschiedlichen Tatbeiträge der Täter nicht ausreichend unterschiedlich gewichtet, da vor allem Barbara H. die treibende Kraft gewesen wäre. Laut BGH:
„Barbara H. kann als ‚gestörte Persönlichkeit‘ bezeichnet werden. P. ist der ‚intelligenteste der drei Angeklagten‘, hat sich aber ‚nirgendwo einen eigenen Lebensraum mit stabilen und verläßlichen Wertbezügen‘ geschaffen. Die Persönlichkeitsmängel beider Angeklagten führen zwar nicht zur Anwendung des § 21 StGB, sie sind jedoch im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen. Die Möglichkeit dazu hat sich die Strafkammer dadurch versperrt, daß sie die Persönlichkeitsstruktur der Angeklagten (…) nicht mit bedacht hat. Der pauschale Hinweis auf die ‚Täterpersönlichkeit beider Angeklagten‘ reicht jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegenden nicht aus. (…) Diese Mängel führen zur Aufhebung der lebenslangen Freiheitsstrafen. Mit ihnen ist aber auch die gegen den Angeklagten R. verhängte zeitige Freiheitsstrafe aufzuheben, weil nicht auszuschließen ist, daß das Landgericht auch seine Persönlichkeitsstruktur (…) nicht ausreichend erwogen hat (…) Da der Senat nicht auszuschließen vermag, daß das Landgericht bei rechtsfehlerfreier Anwendung des § 23 Abs. 2 StGB hinsichtlich aller Angeklagten zu einem milderen Strafrahmen gelangt wäre, können die Strafaussprüche nicht bestehen bleiben.“
Daher fällte das Landgericht Bochum ein neues, nicht veröffentlichtes Urteil. Die Staatsanwaltschaft Bochum erteilte dazu nur folgende Auskunft:
„ […] in o.g. Strafverfahren wurden folgende Urteile gefällt:
Michael R.: Freiheitsstrafe von 7 Jahren und Unterbringung
gemäß § 63 StGB
Barbara H.: 14 Jahre Freiheitsstrafe
Peter P.: 11 Jahre Freiheitsstrafe
Die Verurteilten wurden des versuchten Mordes schuldig gesprochen. Aus datenschutzrechtlichen und organisatorischen Gründen ist es mir leider nicht möglich, Ihnen weitergehende Auskünfte zu erteilen.“
Quellen:
BGHSt 35, 347ff. Urteil vom 15.09.1988 Az: 4 StR 352/88
Der Kannibale von Rotenburg
Der ehemalige Oberfeldwebel Armin M. war laut seiner Nachbarn und Vorgesetzten ein freundlicher, umgänglicher, überaus zuverlässiger und fleißiger Mann, der die Computer und Geldautomaten der örtlichen Banken wartete. M. lächelte oft und gerne, galt als durchaus charmant und half den Nachbarn, soweit es in seinen Möglichkeiten stand.
Verurteilt wurde der 41-Jährige aus Rotenburg an der Fulda, weil er einen anderen Menschen schlachtete und aufaß.
Der deswegen gegen ihn angestrengte Prozess zeigte der entsetzten Öffentlichkeit ein „Panoptikum der Perversion“, wie es der „Spiegel“ am 1. Dezember 2003 bezeichnete. Dabei handelte es sich allerdings auch um ein großes juristisches Problem, denn der getötete Bernd J. B. ließ sich freiwillig schlachten und aufessen!
Er war ein Masochist.
Das hatten die Gerichte in Deutschland noch nicht erlebt. Kannibalismus ist kein Straftatbestand. War das nun Tötung auf Verlangen, straflose Beihilfe zum Selbstmord, Totschlag, Mord – oder lediglich Störung der Totenruhe?
Knifflige Frage!
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739393247
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2017 (August)
- Schlagworte
- Mord Gericht Sirius Totschlag Urteil Verbrechen StGB Recht Kriminalfälle Gefängnis Kulturgeschichte