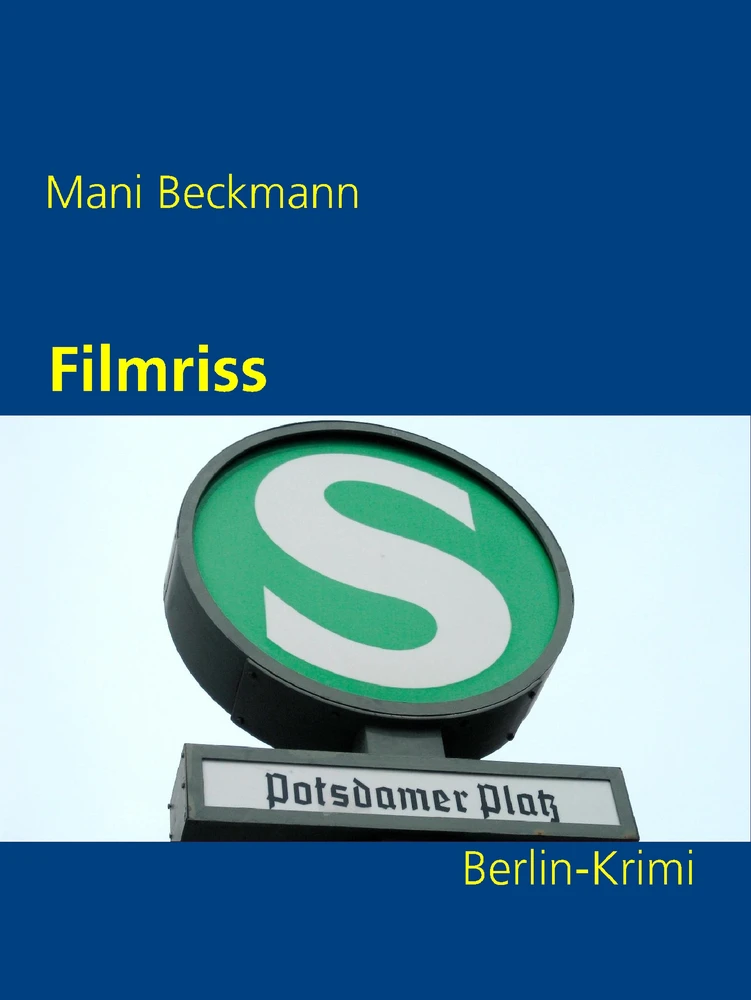Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
–
Dieser Roman erschien erstmals 2003 als berlin.krimi im be.bra verlag, Berlin. Die vorliegende Ausgabe ist vollständig überarbeitet und entspricht den Regeln der neuen Rechtschreibung.
Die Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen und Personen sind nicht beabsichtigt, aber auch nicht auszuschließen. Dennoch ist es nur ein Roman.
Mein besonderer Dank gilt Trini Trimpop, Wieland Speck, Michael Winterbottom, Hermann & Brigade Fozzy und Ina.
M. B.
Weitere Informationen im Internet unter www.manibeckmann.de
Erster Teil
–
1
Albrecht hatte schlechte Laune. Das war an sich nichts Besonderes oder Ungewöhnliches, denn er war eigentlich immer schlecht gelaunt. Er war gut darin. Schließlich wurde er dafür bezahlt, üble Laune zu haben. Albrecht war Filmjournalist und hatte sich seinen Ruf als Berlins bösartigster und meistgehasster Kritiker hart erarbeitet. Vor allem für einheimische Filmschaffende war er seit langem ein rotes Tuch; den „Totengräber des deutschen Films“ nannten sie ihn, was er jedoch als Kompliment verstand. Solange sein Sender, eine lokale Station mit dem einfallsreichen Namen „Berlin-Kanal“, ihm den Rücken freihielt und die Einschaltquoten ihm Recht gaben, kümmerten ihn die kleingeistigen Beschwerden deutscher Filmschaffender nicht. Seine Sendung „Tacheles“ hatte ihren Namen schließlich nicht ohne Grund. Albrecht sprach Klartext, und was konnte man mit dem deutschen Film schon anderes tun, als ihn verreißen?
Mit den unsäglichen Produkten teutonischer Filmkunst hatte seine momentane Missstimmung allerdings nichts zu tun, jedenfalls nicht unmittelbar. Er stand an einer türkischen Imbissbude in der Nähe des Potsdamer Platzes und schaute angeekelt auf den Pappteller in seiner Hand.
„Was soll das, bitte schön, sein?“, wandte er sich an die Türkin hinter dem Tresen, die ihre vor Kälte roten Finger an einem Glas Tee wärmte.
Die Frau antwortete mit einem verständnislosen Blick.
„Ich hatte einen Fleischspieß bestellt“, erklärte Albrecht, und sein Atem hing wie eine Fahne in der eisigen Februarluft.
„Ist Fleischspieß“, sagte die Frau. „Macht zwei Euro fünfzig.“
„Sehen Sie das?“ Er deutete mit dem behandschuhten Finger auf etwas Grünliches, das aus der rotbraunen Tunke hervorlugte. „Das ist Paprika.“
„Paprika“, bestätigte die Türkin und ließ das R rollen.
„Und das da …“ Er stocherte mit der Plastikgabel in dem frittierten Etwas herum, bis er ein bräunliches Stück aufgespießt hatte und der Frau vor die Nase halten konnte. „Das ist Leber.“
„Wenn Sie es sagen“, antwortete sie und nippte an dem Tee.
„Gute Frau“, er knallte den Teller angewidert auf den Tresen, „wenn das da Paprika und das da Leber ist, dann, meine Liebe“, er ließ seinen Finger bedeutsam über dem Essen kreisen, „dann ist das da kein Fleischspieß.“
„Ach“, sagte die Frau, „sondern?“
„Schaschlik!“
„Und?“
„Und?! … Ich höre wohl nicht richtig.“ Er presste empört die Lippen aufeinander, hob die Brauen, zeigte das missfällige Augenrollen, für das ihn sein schadenfrohes Publikum so liebte, und fauchte: „Ich weiß nicht, ob es sich bis zum Bosporus herumgesprochen hat, aber in Deutschland besteht der Fleischspieß aus Fleisch und Zwiebeln, sonst nichts. Keine Paprika und erst recht keine Leber! Und ein Spritzer Worcestersauce kann auch nicht schaden.“ Er sprach „Worcester“ wie ein Engländer aus: Wuhster.
„Worreschester ist aus“, sagte die Frau.
„Sie haben dort auf Ihrer Tafel Fleischspieß ausgepriesen“, rief er und deutete auf ein Schild, auf dem in geradebrechtem Deutsch neben Döner Kebap und Lahmacun auch diverse Köstlichkeiten einheimischer Imbisskultur feilgeboten wurden. „Sie verkaufen aber stattdessen Schaschlik. Das ist Etikettenschwindel, weil Sie nämlich Minderwertiges zu überteuerten Preisen verkaufen! So was ist in unserem Land verboten.“
Die Frau runzelte die Stirn, stellte ihren Tee beiseite und fragte: „Was wollen Sie eigentlich?“
„Ich will einen Fleischspieß“, knurrte Albrecht.
„Fleischspieß haben wir nicht“, antwortete sie, „wollen Sie Schaschlik?“
Albrecht starrte sie feindselig an und schwieg.
Die Türkin zuckte mit den Achseln, nahm den Pappteller und warf ihn kurzerhand samt Schaschlik in den Abfalleimer. Dann beugte sie sich über den Tresen und brüllte: „Und jetzt verpiss dich, du Arschloch!“
Das war’s! Dieser Tag war im Eimer, eindeutig und endgültig im Eimer. Er hatte es ja gewusst. Er hatte es bereits geahnt, als Jupps Schnarchen aus dem Nachbarzimmer ihn jählings aus dem Schlaf gerissen hatte. Verdammter Mist! Warum tat er sich das jedes Mal aufs Neue an? Rausschmeißen sollte er den Kerl. Hochkant. Ein für alle Mal. Und überhaupt: Berlinale! Internationale Filmfestspiele. Dass er nicht lachte! Es war doch immer das Gleiche. Ein einziges Elend.
Der Frühfilm war die obligatorische Katastrophe gewesen, jeder Film, der um neun Uhr morgens gezeigt wurde, konnte nur eine Zumutung sein. Schlechte Filme auf nüchternen Magen vertrug er einfach nicht, Frühstück vor dem ersten Film allerdings auch nicht. Und so hatte er mit knurrendem Gedärm im Kino gesessen und sich damit getröstet, nach überstandener Tortur einen leckeren Imbiss zu sich zu nehmen. In der Sushi-Bar, die er normalerweise besucht hätte, war allerdings ein solcher Andrang gewesen, dass er lieber das Weite gesucht hatte. Außerdem hatte er in der Schlange der Wartenden Martin Brandt entdeckt, den ebenso nervtötenden wie geschwätzigen Filmredakteur des „Berliner Abendblatts“, dem er an diesem Morgen auf keinen Fall über den Weg laufen wollte. Und so hatte ihn das missgünstige Schicksal ausgerechnet an diese türkische Imbissbude verschlagen. Es war bereits nach Mittag, seine Magenwände rieben wie Eisenfeilen aneinander und gaben Geräusche von sich, die an Eisbrecher im Polarmeer erinnerten. Er war kurz davor, einen ausländerfeindlichen Sermon vom Stapel zu lassen oder gar handgreiflich zu werden. Er hatte es ja von Anfang an gewusst!
„Was haben Sie gewusst?!“
Die Stimme der Türkin riss ihn aus seinen Gedanken, und erst jetzt bemerkte er, dass er mit ausgefahrenem Arm und gerecktem Zeigefinger vor der Imbissbude stand, wie eine Statue des Christoph Columbus, der auf das am Horizont auftauchende Amerika weist. Hinter Albrecht kicherten zwei Mädchen und tuschelten miteinander, ein junger Mann mit Baseballkappe und Rapper-Bärtchen betrachtete ihn aus den Augenwinkeln und schien zu überlegen, woher er das Gesicht kannte.
„Ach!“, machte Albrecht, winkte ärgerlich ab, schlug den Kragen seines Mantels hoch und schob sich die Schirmmütze in die Stirn. Er trug die Mütze wie einst Mao oder Thälmann, und nur der Druckknopf auf dem Schirm wies darauf hin, dass es sich eigentlich um das bei Pfeife rauchenden, englischen Rentnern so beliebte Modell handelte. Die Mütze hatte sogar Ohrenklappen, die er aber wohlweislich auf der Innenseite versteckt hatte.
Ohne auf den Verkehr zu achten, spurtete er über die Potsdamer Straße. Ein Taxifahrer ging in die Eisen, es quietschte, und der Mann stieß in seinem Wagen einen unhörbaren Fluch aus. Albrecht ging die Eichhornstraße entlang, ließ das Hotel „Grand Hyatt Berlin“, in dem das Pressezentrum samt Ticket-Counter und Saal für die Pressekonferenzen untergebracht war, links liegen und überquerte den berlinalebeflaggten Marlene-Dietrich-Platz. Insgeheim wünschte er, der ganze verdammte Potsdamer Platz würde sich in Luft auflösen. Nicht dass die Ansammlung unförmiger, farblich verirrter und geschmackloser Bauten die Gegend verschandelte, ärgerte ihn (was gab an dieser trostlosen Gegend schon zu verschandeln?), auch das Jammern der Kollegen über das zentrale Festivalkino, das eigentlich ein Musical-Theater war und dessen Sitze den empfindlichen Journalistenhintern zu unbequem waren, konnte er nicht nachvollziehen. Was ihn jedoch wirklich anwiderte, war die Tatsache, dass sich der Weg von seiner Wohnung zu den Berlinale-Kinos nach dem Umzug des Festivals an den Potsdamer Platz fast verdoppelt hatte. Früher hatte er zu Fuß von der Ansbacher Straße zum Zoo-Palast und den Ku’damm-Kinos laufen können, heute musste er sich mit dem eigenen Auto herumquälen oder ein Taxi nehmen. Natürlich hätte er auch mit der U-Bahn fahren können, die Verbindung vom Wittenbergplatz zum Mendelssohn-Bartholdy-Park war nicht die schlechteste, doch mit der BVG fuhr Albrecht grundsätzlich nicht mehr, seitdem er einmal beim versehentlichen Schwarzfahren erwischt worden war. Weder seine Beteuerung, die Monatskarte befinde sich in seinem anderen Mantel, noch sein Prominentenstatus hatten den Kontrolleur zu nachsichtigem Verhalten bewegen können. Vermutlich gab es ein Kopfgeld für jeden erlegten Schwarzfahrer. So etwas merkte sich Albrecht und nahm es persönlich, in dieser Hinsicht war er wie ein Elefant, und er ließ es gerne mal in seine Fernsehtiraden einfließen.
Er betrat das „Musical Theater Berlin“, das sich während der Festspiele „Berlinale-Palast“ nannte, und wich der Traube von Journalisten aus, die sich linker Hand vor dem Zugang zum Kinosaal drängelten, um sich einen günstigen Sitzplatz zu sichern. Albrecht tat sich diesen ärgerlichen Unsinn nicht mehr an, dieses Drängeln und Hetzen und aufgeregte Plätzefreihalten. Seit Jahren hatte er es sich zur Angewohnheit gemacht, sich auf einen der für die Jury-Mitglieder reservierten Plätze zu setzen. Es waren nie alle Juroren gleichzeitig anwesend, einige Sitze waren immer frei, und noch nie hatte jemand gewagt, ihn von seinem Platz zu verscheuchen. Das sollten sie nur versuchen!
Albrecht ging zu der mit rotem Teppich ausgelegten Treppe, die nach unten zu den Pressefächern führte. Bevor der nächste Wettbewerbsfilm startete, wollte er noch kurz sein Fach leeren und nachschauen, ob womöglich Einladungen für die täglich stattfindenden Partys und Empfänge vorlagen. Wenn er sich schon tagsüber ärgern lassen musste, so wollte er sich wenigstens nächtens dafür entschädigen.
„Ihren Ausweis bitte!“
Albrecht fuhr zusammen und starrte in das Gesicht eines blonden Mannes, der in seinem rot karierten Sakko und der viel zu weiten schwarzen Hose reichlich albern aussah. Wie ein Toilettenmann in einem zu teuren Hotel.
„Wie bitte?“, entfuhr es Albrecht.
„Oh, Entschuldigung, Herr Niemeyer“, sagte der Rotbejackte und machte eine verlegene Miene. „Ich habe Sie nicht gleich erkannt.“
Albrecht lächelte nachsichtig, stieg die Stufen hinab und übersah geflissentlich das Nicken und die grüßenden Handbewegungen der Kollegen, die ihm auf der Treppe entgegenkamen. Er betrat den seltsam geschnittenen, mit unförmigen Pappmascheefiguren und farbigen Stellwänden eingerichteten Raum, der nach oben, zum Treppenhaus hin, offen war und in dem es nach Druckerschwärze und feuchtem Papier roch. Eine Wand von Pressefächern mäanderte durch den Raum und endete an einem Informationsschalter, einer Art Durchreiche, die Albrecht an die ehemaligen Paketannahmestellen der Post erinnerte. Fahrig wirkende Journalisten hetzten herum und suchten nach kostenlosen Probeexemplaren von Tageszeitungen und Filmzeitschriften. Die armen Schweine ohne eigenes Fach fragten die bedauernd achselzuckenden Frauen am Schalter, ob es das Presseheft zu diesem oder jenem Film noch gebe oder ob inzwischen ein Fach frei geworden sei. An einem Tisch in der Mitte des Raumes, auf dem in riesigen Stapeln Flugzettel und fotokopierte Werbebroschüren auslagen, trennten die Kollegen die Spreu vom Weizen. Die Pressehefte, Fotos, Hochglanzmagazine und Einladungen landeten in den hässlichen Umhängetaschen, die alljährlich vom Hauptsponsor verteilt wurden, der Rest des Papierkrams in der überdimensionalen Mülltonne, die gleich neben dem Tisch stand und mehrmals am Tag geleert werden musste. Albrecht starrte verwundert auf die Tasche des Mannes, der neben ihm am Fach stand und hektisch in den Papieren kramte. „Berlinale ’99“, stand darauf, „Sponsored by Mercedes-Benz“.
Es war schon peinlich genug, die jeweils aktuellen Umhängetaschen mit sich herumzuschleppen (und Albrecht wäre lieber gestorben, als sich ein solches Monstrum um den Hals zu hängen), aber wie man so erbärmlich sein konnte, die Taschen der vergangenen Jahre aufzuheben und sogar weiterhin zu benutzen, das wollte Albrecht nicht in den Kopf. Vermutlich hielt sich der Kerl auch noch für besonders originell.
Während er sein Fach leerte und einen großen Stapel von Zetteln und Umschlägen herausfischte, sah Albrecht aus den Augenwinkeln heraus etwas sehr Beunruhigendes die Treppe herunterkommen. Eigentlich hatte er vorgehabt, wie alle anderen Schreiberlinge den täglichen Papierwust zu sortieren und eliminieren (die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, oder war es anders herum?), doch nun klemmte er sich den gesamten Stapel unter die Achsel und suchte nach einem zweiten Ausgang, einem Fluchtweg, dem grünen „Exit“-Schild, das ihn aus dieser Sackgasse herauswies. Er wollte bereits zu dem von zwei Styropor-Löwen bewachten Eingang des „Adagio“ stürzen, dem Café und Treffpunkt für die akkreditierten Gäste, doch es war bereits zu spät!
„Morgen, Albrecht“, sagte Martin Brandt, „ich hab dich vorhin schon beim Japaner gesehen, du hast mich wahrscheinlich nicht erkannt.“
Albrecht lächelte gezwungen und zuckte mit den Schultern. „Kann schon sein“, sagte er und wollte sich an Martin vorbei in Richtung Ausgang zwängen, aber genau in diesem Moment kam es zu einem Stau aus der Gegenrichtung. Eine Kamera-Crew des SFB blockierte die Treppe und machte Aufnahmen von dem heillosen Durcheinander, um zu dokumentieren, wie anstrengend und aufwühlend der Alltag der Festivaljournalisten war. Albrecht steckte inmitten eines Journalistenpulks fest und schaute direkt in die gleißenden Scheinwerfer, um nicht den Mann betrachten zu müssen, dem er seit Wochen aus dem Weg zu gehen trachtete.
„Willst du auch in den nächsten Film?“, fragte Martin Brandt.
Natürlich wollte Albrecht das, aber dennoch schüttelte er den Kopf. Der Stau hatte sich aufgelöst, das Licht war gelöscht, die Kamera verstaut, und Albrecht lief zur Treppe, ohne seinen hartnäckigen Kollegen und Beinahe-Freund abschütteln zu können.
„Hast du es gelesen?“, fragte Martin, als sie das Erdgeschoss erreicht hatten.
Albrecht nickte wahrheitsgemäß und ärgerte sich im selben Moment darüber. Er stapfte zum Ausgang und hoffte, Martin würde sich rechter Hand zu den auf Einlass Wartenden gesellen. Er wusste, dass er dies nicht tun würde. Albrecht hing am Haken.
„Und, wie findest du’s?“ Martin hatte ihn überholt und hielt ihm nun die Tür nach draußen auf. „Ist doch witzig, oder?“
Albrecht hatte sich vorgenommen, höflich zu sein, milde und nachsichtig, mit anderen Worten: er war fest entschlossen gewesen, Martin eine dreiste Lüge aufzutischen, aber dieses „Ist doch witzig, oder?“ war einfach zu viel.
„Kann ich nicht finden“, knurrte Albrecht.
„Im Ernst?“ Martin sah ihn entgeistert an.
„Seh ich aus, als würde ich scherzen?“
Nein, so sah er nicht aus. Nichts weniger als das. Er wirkte etwa so amüsiert wie an jenem Montag vor sechs Wochen, dem Silvesterabend, als Emily mit gepacktem Koffer vor ihm gestanden und ihn verlassen hatte. Nein, er scherzte nicht, ganz gewiss nicht. Er hatte schlechte Laune. Er war hungrig. Er war unausgeschlafen. Er hatte Lust, jemanden zu töten.
„Was gefällt dir daran nicht?“
Alles! Das ganze verdammte Drehbuch ist eine einzige Zumutung, ein schlechter Witz! Dies wäre die schlichte, aber ehrliche Antwort gewesen, doch Albrecht zwang sich, zu schweigen und dem Blick des anderen auszuweichen.
Martin Brandt war ein Musterbeispiel der Gattung des ebenso ambitionierten wie unzufriedenen Journalisten. Er gehörte zu der Schar der Verhinderten! Wie so viele der Kollegen hielt er sich eigentlich für etwas anderes. Albrecht kannte kaum einen Filmjournalisten, der nicht in Wahrheit Regisseur oder Drehbuchautor war, keinen Feuilletonisten, der nicht mindestens ein unfertiges Romanmanuskript oder eine Sammlung unveröffentlichter Gedichte in der Nachttischschublade hatte, keinen Musikkritiker, der nicht im Grunde genommen Gitarrist, Songwriter oder DJ war. Eine einzige Ansammlung verhinderter Künstler. Es war zum Kotzen! Albrecht fand diesen journalistischen Minderwertigkeitskomplex widerlich. Warum sollte er sich für etwas entschuldigen, das er mochte und von dem er etwas verstand? Er war Kritiker und damit basta! Und an der Zahl seiner Feinde konnte er erkennen, dass er nicht der Schlechtesten einer war. Die Kollegen jedoch schienen sich Tag für Tag vorzujammern, was sie alles nicht waren oder erreicht hatten. Als sei ihnen ihr jetziger Beruf peinlich.
Der wesentliche Unterschied zwischen Martin Brandt und dem Rest der Truppe bestand jedoch darin, dass Martin glaubte, Albrecht mit seinen jämmerlichen Autorenergüssen nerven zu dürfen. Sie kannten sich „aus alten Tagen“, wie Martin es gerne nannte, sie hatten in den Achtzigern gemeinsam studiert und die langweiligen Seminare am Lankwitzer Institut für Publizistik über sich ergehen lassen: „Einführung in die Medienökonomie“, „Deutsche Mediengeschichte: Ein Überblick“, „Grundbegriffe der Semiotik“. Damals hatte es einen gemeinsamen Gegner gegeben, eine hassenswerte Institution, gegen die sie sich verbündet und die sie besiegt hatten, indem sie sich nicht von sabotierenden Sekretärinnen und frustrierten, auf der Karriereleiter stecken gebliebenen Dozenten hatten unterkriegen lassen. Doch bereits kurz nach Abschluss des Studiums hatten sie sich eigentlich nichts mehr zu sagen gehabt. Obwohl beide denselben Beruf anstrebten, waren sie sich so fremd wie nur irgend denkbar. Albrecht wollte Karriere machen, er wollte sich nicht nur einen Namen verschaffen, sondern auch ein Gesicht bekommen, und nur das Fernsehen kam dafür in Frage. Martin hingegen war der altmodischen Ansicht, allein durch Inhalte überzeugen zu können. Er wollte etwas Wichtiges sagen, ohne jedoch als Person ins Rampenlicht treten zu müssen. Der anonyme Meister des Wortes. Was für ein Unsinn! Dennoch blieben sie in Kontakt, wider besseres Wissen und ohne jeden Lustgewinn. Martin begann als freier Journalist beim „Berliner Abendblatt“, wo er vermutlich heute noch unbedeutende Zeilen auf den hinteren Seiten füllen würde, wäre er nicht in einen spektakulären Kriminalfall verwickelt gewesen, der ihm einiges an Aufmerksamkeit und Medienpräsenz einbrachte. Auf irgendeiner Urlaubsinsel war er Zeuge oder Beteiligter eines Mordfalles gewesen, der Prozess vor dem Berliner Landgericht beherrschte wochenlang die Schlagzeilen der Gazetten, und als die Schuldigen verurteilt oder auf Nimmerwiedersehen ins Ausland verschwunden waren, hatte sich der kleine unscheinbare Journalist und gesichtslose Wortjonglierer zum Medienstar gemausert, der sich in der Folgezeit geschickt im Gespräch hielt, sogar in Fernsehtalkshows auftrat und fast zwangsläufig den nächsten frei werdenden Redakteursposten beim „Abendblatt“ übernahm. Dass es die Filmredaktion war, war reiner Zufall, und dass Martin alles andere als ein Filmfreak oder Cineast war, fiel nicht weiter ins Gewicht. Er war ein begnadeter Telefonierer und Händeschüttler, ein Meister des „Kontakt-Haltens“ und „Sich-in-Erinnerung-Bringens“. Er kannte Jan und Jedermann, duzte sich mit allen möglichen Kulturschaffenden und Entscheidungsträgern und wuchs wie Efeu an ihrem geduldigen Stamm empor. Dennoch war er unzufrieden, ein Verhinderter. Und Albrecht hatte nun darunter zu leiden.
„Wieso nicht?“
Albrecht hatte von Martins letztem Satz nicht ein Wort mitbekommen, und bevor er etwas Unsinniges antwortete, fragte er: „Was?“
„Wieso du nicht gelacht hast.“
„Weil es nicht komisch ist.“
„Da bist du aber der Erste, der das sagt.“
„Na, umso schöner für dich.“ Albrecht ergriff Martins Bemerkung wie ein Ertrinkender einen Rettungsring. „Wenn sich alle einig sind, dass du der nächste I. A. L. Diamond bist, warum regt dich meine Kritik so auf?“
„Wer ist I. A. L. Diamond?“
Albrecht verdrehte die Augen, schnaufte leise und beschäftigte sich so eindringlich mit dem Stapel Papier auf seinem Arm, als handele es sich um das handgeschriebene Originalmanuskript von „Ninotschka“. Tatsächlich jedoch war es der übliche Werbekram, nur ein einzige Party-Einladung, die Albrecht sofort in der Innentasche seines Mantels verstaute. Außerdem fiel ihm ein dickerer und wattierter Umschlag auf, der keinen Stempel oder Absender aufwies. Die Adresse war mit Maschine geschrieben und lautete: „Albrecht Niemeyer, Pressezentrum, Berlinale“. Es waren keine Briefmarken aufgeklebt, wahrscheinlich war das Päckchen persönlich abgegeben worden. Ein weiteres Manuskript, vermutete Albrecht und stöhnte voller böser Vorahnung. Nicht nur alte Studienkollegen, auch Wildfremde belästigten ihn hin und wieder mit ihren Machwerken und glaubten, weil Albrecht Filmkritiker sei, müsse er sich auch für den geistigen Durchfall unerkannter Talente interessieren. Er nahm den gesamten Stapel, ging zu einer Laterne und stopfte die Papiere kurzerhand in einen der dunkelgrauen Abfalleimer, auf dem die Berliner Stadtreinigung ihre vermeintlich lustigen Werbesprüchlein gepinselt hatte: „Kleines Aschloch“, war auf diesem Exemplar zu lesen.
„Raus hier! Oder wir rufen die Polizei.“
Albrecht und Martin fuhren herum. Sie standen vor McDonald’s und wurden Zeuge, wie zwei Angestellte einen bärtigen Obdachlosen an Händen und Füßen zur Tür herauszerrten und ihm zu verstehen gaben, er könne, wenn er schon nichts kaufe, nicht auch noch die Gäste belästigen.
„Wer belästigt hier wen?“, brabbelte der Obdachlose trunken. Der Mann schien keinen Hals zu haben, der Kopf stak ihm direkt zwischen den Schultern.
„Du stinkst, Meister“, sagte einer der beiden Angestellten und gab dem Mann einen Tritt in den Hintern.
Albrecht grinste und beschloss, den Laden zu betreten.
„Nein, sag doch mal“, beharrte Martin und beeilte sich, dem Freund ins Schnellrestaurant zu folgen. „Warum findest du es nicht komisch?“ Erst jetzt wunderte er sich, wo sie sich befanden, und fragte: „Seit wann isst du denn in einer Frittenschmiede?“
Frittenschmiede! Das war typisch Martin. Ständig verwechselte er Wortwitz mit Plattitüden. Sein Drehbuch wimmelte von solchen ulkigen Wortspielchen und peinlichen Stilblüten. Seine Protagonisten benutzten Ausdrücke wie „volle Kanne“ oder „ohne Ende“, und wenn jemand furzte, dann „stellte er einen Schirm in die Ecke“.
Albrecht reihte sich in eine der Schlangen vor den Kassen ein und maulte: „Ich habe Hunger. Und jetzt hör endlich auf zu nerven.“
„Aber der Titel ist doch gut, oder?“
„’Tot und Mordschlag’?“ Albrecht lachte. „Was soll denn daran, bitte schön, lustig sein? Der Titel ist genauso gewollt und an den Haaren herbeigezogen wie der Rest der Geschichte. Vielleicht solltest du keine Komödien schreiben, Martin. Versuch’s doch mal mit einem Dokumentarfilm.“
„Du glaubst wohl, ich hab keinen Humor, was?“
Ja, genau das glaube ich. Wenn es irgendeinen Menschen auf der Welt ohne den leisesten Sinn für Humor gibt, dann bist du es! Du bist so komisch wie ein Flugzeugabsturz. Der Untergang der Titanic war ein Brüller im Vergleich zu dir! Das hätte Albrecht antworten sollen, und vermutlich hätte es seine Laune beachtlich gesteigert, stattdessen sagte er: „Vielleicht solltest du die ganze Geschichte ein wenig ironischer anlegen.“
„Aber es ist doch ironisch gemeint“, antwortete Martin verständnislos.
„Eben!“
„Das versteh ich nicht.“
„Genau das ist das Problem.“
Und dann ging die Bombe hoch.
Es war ein Knall, sicherlich, aber nicht lauter als ein China-Böller, Marke Kanonenschlag. Und im nächsten Moment war draußen lautes Schreien zu hören. Der Obdachlose kam in den Laden gerannt, hielt seine rechte Hand mit der linken umklammert und reckte sie in die Höhe. Die Hand war schwarz verkohlt und blutig, die Finger sahen aus, als habe er sie in einen Schredder gehalten. Auch das Gesicht des Mannes war schwarz, der Bart angesengt. Der Obdachlose schrie wie am Spieß, aber es klang seltsamerweise nicht schmerzverzerrt, sondern lediglich entsetzt oder erschrocken. Die Leute wichen vor ihm wie vor einem Pestkranken zurück und verfolgten angeekelt das Schauspiel.
„Jetzt tu doch einer was“, rief der Angestellte, der dem Mann vorhin einen Tritt gegeben hatte.
„Ich ruf die Feuerwehr“, antwortete eine Frau hinter dem Tresen.
Plötzlich durchzuckte es Albrecht, und er starrte aus dem Fenster nach draußen. Aus dem grauen Abfalleimer stiegen qualmende Rauchfahnen hoch, Reste verbrannten Papiers ragten wie aus einem Vulkankrater hervor, einige verkohlte Fetzen schwebten wie Konfetti in der eisigen Luft.
„Kleines Aschloch“, stand auf dem Abfalleimer.
Wie von Sinnen lief Albrecht auf die Straße hinaus.
„He!“, rief ihm Martin hinterher. „Wo willst du denn hin?“
Aber er hörte es kaum noch.
–
2
Seit Emily ihn verlassen hatte, war die Wohnung in der Ansbacher Straße viel zu groß für ihn. Und viel zu leer. Zu Beginn des Jahres, drei Tage, nachdem sie samt Koffern aus seinem Leben verschwunden war, hatten drei hünenhafte und an den bloßen Oberarmen tätowierte Möbelpacker vor der Tür gestanden, mit einer langen Liste von Möbeln und Küchengeräten, die Emily gehörten, und hatten alles mitgenommen. Sie selbst war nicht anwesend gewesen, hatte lediglich einem der Männer einen Brief mitgegeben, in dem sie Albrecht bat, keinen Ärger zu machen und „zu kooperieren“.
„Seid ihr von ‚Synanon’?“, hatte Albrecht gefragt und ein verblassendes Frauenportrait auf dem mächtigen Bizeps seines Gegenübers betrachtet. Es hatte Ähnlichkeit mit dem Medusenhaupt.
Der Möbelpacker nickte und rieb sich die Pranken.
„Die Drogen sind im Spiegelschrank über dem Waschbecken“, zischte Albrecht und zog den Mantel an. „Aber macht anschließend den Dreck weg, wenn ihr euch einen Schuss setzt.“ Bevor der Mann sich auf ihn stürzen konnte, nahm Albrecht Reißaus und verschwand im Treppenhaus.
Als er am Abend zurückkehrte, war alles verschwunden, was Emily zu Recht oder Unrecht als ihr Eigentum deklariert hatte. Die Zimmer sahen aus wie teilamputiert, klaffende Lücken überall, und selbst wenn die Wunden heilten, die Narben würden sichtbar bleiben. Albrecht hatte bis heute kein einziges neues Möbelstück gekauft, kein Küchengerät ersetzt und nicht einmal die hellen Flecken an den Tapeten durch Filmplakate abgedeckt. Bis vor zwei Wochen hatte er noch geglaubt, sie werde zu ihm zurückkommen.
„Jupp? Bist du da?“
Keine Antwort. Ein Glück!
Albrecht betrat den Flur, ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen und atmete auf, obwohl es unverkennbar nach abgestandenem Zigarettenrauch roch. Die 4-Zimmer-Wohnung war zu groß für einen Einzelnen, das war unstrittig, aber dennoch hätte er einiges darum gegeben, sie im Moment mit niemandem teilen zu müssen. Vor allem nicht mit einem Chaoten wie Jupp. Natürlich hatte Albrecht ihm bei seiner Ankunft vor vier Tagen gesagt, er solle sich wie zu Hause fühlen, aber das hatte er nur so gesagt, er hatte es nicht wirklich gemeint. Niemand meinte es ernst, wenn er so etwas zu einem Besucher sagte. Es gehörte in dieselbe Kategorie wie „Mach dir nichts draus, das kann doch jedem mal passieren“ oder „Ich dich auch“. Man sagte es, weil es von einem erwartet wurde, aber nicht, weil es der Wahrheit entsprach.
Jupp allerdings war ein Meister darin, achtlos hingeworfene Höflichkeitsfloskeln für bare Münze zu nehmen. Zumindest wenn es ihm in den Kram passte. Und so hatte er sich prompt darangemacht, Albrechts Wohnung in ein Schlachtfeld zu verwandeln, nicht nur Emilys leer geräumtes Arbeitszimmer, das ihm als provisorisches Schlafzimmer diente. Überall in der Wohnung (allerdings selten in einem Aschenbecher) lagen Zigarettenkippen und Jointreste herum, obwohl Jupp nur zu gut wusste, dass Albrecht vor einigen Jahren das Rauchen aufgegeben hatte. Neben dem Klo stapelten sich alternative, meist amerikanische Musikzeitschriften und fotokopierte Independent-Fanzines (Jupp war vermutlich der einzige Mensch über Dreißig, der solchen Mist las), und das Wohnzimmer war übersät mit asiatischen Trash-Videos und uralten Punk-Scheiben (Vinyl, keine CDs!), die Jupp in dubiosen Second-Hand-Läden aufstöberte und wie esoterische Heiligtümer behandelte. Jedes Jahr im Februar, pünktlich zu den Filmfestspielen, seit nunmehr zehn Jahren, tauchte er in Berlin auf, nistete sich bei Albrecht ein und erinnerte ihn an „die guten, alten Zeiten“. In gewisser Weise war Jupp wie Martin Brandt, nur dass diese „alten Zeiten“ noch weiter zurücklagen als die Studienzeit mit Martin. Wenn Albrecht es recht bedachte, so hatte er ein menschliches Altlastenproblem. Ein Entsorgungsdefizit. Er wurde ehemalige Freunde nicht mehr los. Und Jupp war von allen Altlasten die schlimmste und hartnäckigste.
„Warum schmeißt du ihn nicht raus, wenn er dir so auf den Geist geht?“, hatte Emily im vergangenen Jahr gefragt und keck die Augenbrauen gehoben.
„Wir kennen uns so lange“, hatte Albrecht geantwortet.
„Als sei das ein Grund.“
„Glaub mir, es ist einer!“
„Männerfreundschaft, was?“, hatte sie gefrotzelt.
Seltsamerweise hatte Emily Jupp immer gemocht und sich auf seine Besuche sogar gefreut. Sie fand, er sei originell und ein echtes Unikum. Zugegeben, ein Fossil und manchmal ein wenig lächerlich, aber nicht uninteressant. Und nie langweilig.
„In Gegensatz zu mir?“, hatte Albrecht erwidert.
„Das hast du gesagt.“
Jupp gefiel sich in der Rolle des Unangepassten und Nonkonformisten. Er liebte es, unsinnige Theorien oder abstruse Behauptungen in den Raum zu stellen, die er anschließend mit Vehemenz verteidigte und als einzig existierende Wahrheit betrachtete. Hauptsache, er konnte „anders“ sein. Und natürlich besuchte er die Berlinale lediglich, um sich die Filme im „Internationalen Forum des jungen Films“ anzusehen, das offizielle Wettbewerbsprogramm und selbst die Filme im „Panorama“ waren für ihn „kommerzieller Hollywood-Dreck“. Auf Albrechts Entgegnung, ein Großteil dieser Filme stamme aus Europa und sei alles andere als kommerziell erfolgreich, konterte Jupp kategorisch: „Dann ist es eben Möchtegern-Hollywood-Dreck. Das ist beinahe noch schlimmer.“ Und so sah er von morgens bis tief in die Nacht asiatische Gangsterfilme, in denen kaum geredet und viel getötet wurde, afrikanische Polit-Parabeln, die nur Eingeweihten und Entwicklungshelfern verständlich waren, oder europäisches Autorenkino, bei dem die Kamera zu wackeln hatte, der Ton verrauscht war und das primäre Ziel des Filmemachers in der Verbreitung von Langeweile zu bestehen schien. Je trashiger, exotischer oder manierierter, desto besser.
Albrecht warf missmutig den Mantel an die Garderobe, pfefferte seine Schuhe in die Ecke und ging zum Sideboard. Die grüne Leuchtdiode des Anrufbeantworters blinkte. Er drückte auf den Knopf und Jupps näselnde, immer leicht belustigt klingende Stimme war zu hören: „Ich hab dir ’nen Zettel nebens Telefon gelegt. Geil, was? Bis nachher.“
Bei besagtem Zettel handelte es sich um den Ausdruck einer Internetseite, offensichtlich ein Online-Auktionsangebot oder etwas Ähnliches. „Rubrik: Deutscher Punkrock“, stand oben auf der Seite. Jupp hatte eine Zeile mit gelbem Marker angestrichen: „Die Ordensbrüder: Jürgen Bartsch war kinderlieb. Punk Anderson Records 1984. 4 Songs. Guter Zustand. Mit Textblatt und Aufkleber. Mindestgebot: 25 Euro.“
25 Euro?, wunderte sich Albrecht und musste wider Willen schmunzeln. Er hatte noch zehn Exemplare der Platte in einer Kiste im Keller liegen. Vielleicht würden ihm die Ordensbrüder eines Tages doch noch ein bisschen Geld einbringen. Wenn er sich recht erinnerte, hatte „Jürgen Bartsch“ damals nicht einmal die Studiokosten eingespielt. Der Verkauf war armselig gewesen, und GEMA-Einnahmen waren auch nicht geflossen, weil kein Radiosender sich getraut hatte, den Song zu spielen. Albrecht war immer gegen den Titel gewesen, aber Jupp hatte gemeint: „Je provokanter, desto besser.“ Er hatte auch das Cover und den Aufkleber entworfen, auf denen der Kopf des Kindermörders Bartsch mit Mönchstonsur und Heiligenschein zu sehen war.
Das Klingeln des Telefons riss Albrecht aus seinen Gedanken.
„Ja?“
„Herr Niemeyer?“, fragte eine Männerstimme.
„Ja, wer ist denn da?“
„Beim nächsten Mal bist du dran, du Arschloch!“
Es klackte in der Leitung. Albrecht war wie erstarrt und rührte sich nicht von der Stelle. Er hielt den Hörer immer noch in der Hand, hörte das Tuten und stierte auf den hellen Fleck an der Wand, wo einst ein gerahmtes Foto von Emily gehangen hatte. Es war eine Aufnahme aus einem Streichelzoo in Australien gewesen, Emily mit einem verschlagen grinsenden Koala auf dem Arm.
„Verdammt!“
Albrecht knallte den Hörer auf die Gabel und hatte im selben Moment alles wieder vor Augen. Den Penner mit den schwarz verkohlten Fingern und dem angesengten Bart, den rauchenden Abfalleimer mit der albernen Aufschrift, den wattierten und unfrankierten Umschlag mit der maschinengeschrieben Anschrift: „Albrecht Niemeyer, Pressezentrum, Berlinale“.
So seltsam es klang: Als er vor wenigen Minuten seine Wohnung betreten hatte, war er sich beinahe sicher gewesen, dass nichts von alledem wirklich mit ihm zu tun hatte. In den anderthalb Stunden seit der Explosion hatte er es geschafft, die ganze Sache zu verdrängen oder zumindest zu verschleiern. Als habe er einen Schalter in seinem Hirn umgelegt. Es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Und so war ihm der Vorfall wie ein Traum erschienen, ein Film, den er irgendwann in den letzten Tagen im Kino gesehen hatte. Eine Sinnestäuschung.
Der Anruf hatte ihn schlagartig eines Besseren belehrt. Die Explosion war keine Einbildung gewesen, kein Hirngespinst, und sie hatte ihm gegolten. Kein Zufall, keine Verkettung unglücklicher Umstände, kein Versehen. Er hatte es in dem Moment gewusst, als er den Rauch aus dem Abfalleimer hatte aufsteigen sehen. Wie fallende Dominosteine hatte der eine Gedanke den nächsten angestoßen, bis es „Klick“ gemacht und die einzig mögliche Schlussfolgerung in riesigen Lettern vor seinem inneren Auge gestanden hatte: Jemand wollte ihn umbringen. Doch reflexartig hatte er sich gegen diese Erkenntnis gewehrt. Wer sollte so etwas tun? Und warum? Das ergab alles keinen Sinn. Eben doch, schoss es ihm im gleichen Augenblick durchs Hirn. Aber erst jetzt war es ihm möglich, sich dies einzugestehen. Es war möglich, es war sogar wahrscheinlich, und vor allem: es war real!
Beim nächsten Mal bist du dran, du Arschloch!
Er überlegte, wen er in der letzten Zeit besonders hart in seiner Sendung rangenommen hatte, doch er kam zu keinem eindeutigen Schluss. Zu lang war die Liste derer, die er beleidigt, abgekanzelt oder angegriffen hatte. Beinahe jeder deutsche Regisseur, Schauspieler oder Produzent, der etwas auf sich hielt, tauchte darin auf und hätte einen Grund gehabt, verärgert oder verstimmt zu sein. Doch war es tatsächlich denkbar, dass sich ein von ihm Gescholtener auf so perfide Art rächen würde? Sicherlich gehörten Filmschaffende zu den eitelsten und egozentrischsten Personen, die sich denken ließen, sie waren selbstverliebt bis zur Lächerlichkeit, und die meisten von ihnen reagierten auf Kritik wie geschmähte Liebhaber auf einen Nebenbuhler. Aber Albrecht kannte keinen, dem er die kriminelle Energie für solch eine Tat zutraute. Und Anleitungen zur Herstellung von Briefbomben fanden sich bestimmt nicht in Drehbüchern. Obwohl man sich dessen in der heutigen Zeit auch nicht hundertprozentig sicher sein konnte.
Wieder starrte er auf den hellen Fleck an der Wand, und plötzlich kam ihm ein neuer Gedanke. Der Vergleich mit dem Nebenbuhler hatte ihn darauf gebracht. Doch sofort schob er diese Überlegung beiseite. Felgenhauer hatte ihm Emily genommen, wieso sollte er ihm jetzt nach dem Leben trachten? Der Mistkerl hatte schließlich, was er wollte. Das blaue Auge, das Albrecht ihm vor zwei Wochen verpasst hatte, war inzwischen vermutlich in grünliches Gelb übergegangen. Und dennoch! Felgenhauer kam in Frage, auch wenn Albrecht seine Stimme nicht erkannt hatte. Immerhin war der Typ Arzt. Er arbeitete im Urban-Krankenhaus als chirurgischer Orthopäde oder orthopädischer Chirurg. Und die hatten bekanntlich ein Faible fürs Schrauben und Basteln. Von allen Ärzten, die er kannte, hatten Orthopäden und Chirurgen das mit Abstand „technischste“ Bild vom Menschen. Und sie waren fast allesamt Sadisten.
Das Klingeln an der Haustür ließ Albrecht einen spitzen Schrei ausstoßen.
Reiß dich zusammen!, schalt er sich in Gedanken, doch er konnte nicht verhindern, dass seine Hände zitterten. Das seltsame Kribbeln im Nacken, das ihn seit einigen Wochen belästigte, setzte wieder ein, doch diesmal kribbelte es hinunter bis in den kleinen Finger der linken Hand. Reine Nervensache!
Albrecht ging zur Tür und drückte auf den Knopf der Gegensprechanlage.
„Ja?“
„Herr Niemeyer?“, fragte eine Männerstimme.
„Ja, wer ist denn da?“ Der Dialog kam Albrecht beängstigend bekannt vor.
„Hauptkommissar Schalck und Kriminalhauptmeister Schürmann von der Kripo Berlin. Dritte Mordkommission.“
„Mordkommission?“, wunderte sich Albrecht und wusste nicht, ob er aufatmen oder alarmiert sein sollte.
„Delikte am Menschen, wenn Ihnen das lieber ist“, knurrte die Stimme. „Alles eine Familie. Wir würden Sie gern einen Moment sprechen.“
„Kommen Sie rauf! Zweiter Stock, links.“
Er betätigte den Summer, öffnete die Wohnungstür und hörte schwerfälliges Schlurfen im Treppenhaus. Als die beiden Männer im ersten Stock angelangt waren, sagte der eine: „Schickes Haus, was?“ Eine nicht unübliche Reaktion auf den breiten Aufgang, die marmornen Wände, die stuckbesetzten Decken und den Kronleuchter, der nur zur Zierde im Treppenhaus hing.
„Wär mir zu protzig“, erwiderte der andere mürrisch.
Wenige Sekunden später standen sie vor Albrecht und entsprachen so gar nicht der Vorstellung, die er sich bislang von Kriminalpolizisten im Außendienst gemacht hatte. Allerdings kannte Albrecht Kripo-Beamte bislang nur aus dem Fernsehen. Hauptkommissar Schalck war ein pummeliger Mittvierziger mit fettiger Glatze, prallem Bierbauch und einer Leidensmiene, als habe er ein tennisballgroßes Magengeschwür. Ein Griesgram mit tief liegenden, im speckigen Gesicht verschwindenden Augen. Und Kriminalhauptmeister Schürmann sah aus, als sei er Schalcks jüngerer Bruder, ebenso griesgrämig, fett und stiernackig, nur etwa fünfzehn Jahre jünger und mit strähnigem, seitengescheiteltem Haar. Beide wirkten auf Albrecht eher wie Finanzbeamte, aufgedunsen vom ewigen Sitzen, ungepflegt und unmodisch gekleidet, weil sie nie das Büro verließen und nicht mit Menschen in Berührung kamen, die nicht gleichfalls schweißgerändert, unfrisiert und finanzbeamtet waren.
„Sie wissen, weshalb wir hier sind?“, fragte Schalck und schob seinen massigen Körper an Albrecht vorbei durch den Türrahmen.
Keine Begrüßung, kein „Dürfen wir eintreten?“, kein Zeigen der Dienstmarke.
Albrecht nickte und wies aufs Wohnzimmer. „Kommen Sie herein!“
Er folgte den Männern, die sich ungeniert umschauten und sich vor allem für die hellen Flecken an den Wänden und die aus Emilys Regalen geräumten und auf dem Boden gestapelten Bücher zu interessieren schienen.
„Ziehen Sie aus oder ein?“, fragte Schürmann und setzte sich in Albrechts ledernen Fernsehsessel, nachdem er ein dort liegendes Album der englischen Band Discharge unter die Lupe genommen und angewidert beiseite gelegt hatte. Das Cover zeigte eine auf einen Säbel aufgespießte Friedenstaube. Jupps neueste Entdeckung.
„Weder noch“, antwortete Albrecht gereizt.
Schalck, der es vorzog stehen zu bleiben, verschränkte die Arme vor der Brust und sagte: „Herr Brandt war so freundlich, uns Ihre Adresse mitzuteilen. Aber es wäre hilfreicher gewesen, wenn Sie den Ort des Geschehens nicht so überstürzt, oder soll ich sagen fluchtartig, verlassen hätten.“
„Fluchtartig? Was wollen Sie denn damit sagen?“, empörte sich Albrecht und nahm dem sich im Sessel flegelnden Kriminalhauptmeister eine weitere Schallplatte aus der Hand, die Jupp auf dem Fußboden liegen gelassen hatte. Auf der Vorderseite war eine Reihe von Polizisten mit Helm und Schlagstock zu sehen, auf der Rückseite stand in großen Lettern: „Millions of Dead Cops“.
„Sie mögen keine Polizisten, was?“, fragte Schürmann.
Mochte Albrecht Polizisten? Er wusste es nicht. Sie waren ihm unheimlich und verursachten ihm eine Gänsehaut, er hatte nicht allzu gute Erinnerungen an sie und ging ihnen lieber aus dem Weg, aber er konnte nicht wirklich behaupten, dass er sie hasste oder verabscheute. Sie waren ein notwendiges Übel, aber es gab weit unehrenhaftere Berufe. BVG-Kontrolleur beispielsweise.
„Wollen Sie nicht endlich zur Sache kommen?“, raunzte Albrecht und wandte sich an den Hauptkommissar, der sich einmal um die eigene Achse drehte und mit finsterer Miene das übrig gebliebene Mobiliar aus Teakholz und die Pop-Art-Drucke an den Wänden bestaunte. „Sie kommen doch wegen der Bombe.“
„Bombe? Sie sagten Bombe?“ Schalck grinste unangebracht, aber nicht allzu amüsiert. „Wieso denn Bombe?“
„Kommen Sie mir nicht mit solchen Herbert-Reinecker-Dialogen“, knurrte Albrecht und hatte das plötzliche Bedürfnis, sich eine Zigarette anzustecken.
„Wer ist Herbert Reinecker?“
„Der Erfinder von ‚Derrick’“, antwortete Albrecht und zitierte: „Tot? Sie sagten tot? Er kann doch nicht tot sein. Wieso denn tot?“
„Wer ist tot?“, fragte Schürmann, ohne den Blick von einem weiteren Schmuckstück aus Jupps Sammlung abzuwenden. Wenn Albrecht es aus den Augenwinkeln heraus richtig erkannte, war es eine Single der Dead Kennedys: „Nazi Punks Fuck Off“.
Wieder zeigte Schalck sein wenig belustigt wirkendes Grinsen, schnaufte bedeutungsvoll und ließ sich schließlich durch Albrechts flehenden Blick erweichen. „Sie müssen zugeben, dass Ihr Verhalten ein wenig merkwürdig, um nicht zu sagen verdächtig aussieht“, sagte er und setzte sich nun doch aufs Sofa. „Zuerst stecken sie einen Packen Papier in einen Abfalleimer, nur wenige Sekunden später fliegt dieser in die Luft, ein Obdachloser wird dabei verletzt, und Sie türmen, als sei Ihnen der Teufel auf den Fersen.“
„Wer sagt das?“
„Ihr Freund, Herr Brandt.“
„Er ist nicht mein Freund.“
„Aber ein Augenzeuge.“
Albrecht setzte sich zu Schalck aufs Sofa und versank neben ihm in den Polstern, so dass er zu dem Kommissar hochschauen musste, obwohl er im Stehen nicht kleiner als Schalck gewesen war. Ein Sitzriese! Irgendwie erinnerte ihn die Situation an einen Louis-de-Funès-Film, dessen Titel ihm entfallen war.
„Ich bin nicht der Täter“, erklärte Albrecht, „sondern das Opfer. Jemand hat versucht, mich in die Luft zu sprengen.“ Er hielt einen Moment inne, weil er merkte, dass der Ausdruck vermutlich ein wenig zu pathetisch und dick aufgetragen war, und setzte schließlich hinzu: „Warum sollte ich wohl einen Abfalleimer in die Luft jagen wollen?“
„Vergessen Sie den Obdachlosen nicht!“, versetzte Schürmann.
„Merken Sie eigentlich gar nicht, wie absurd das ist?“, erwiderte Albrecht und überlegte, ob die beiden Beamten sich einen Scherz mit ihm erlaubten. Sie sahen allerdings nicht so aus.
„Und warum sollte irgendjemand Sie in die Luft sprengen wollen?“
„Ich bin nicht unbekannt in dieser Stadt, eine Persönlichkeit des öffentlichen Interesses, wie man so sagt“, antwortete Albrecht und schlug die Beine übereinander. Weil er in dieser Position neben dem Kommissar noch kleiner wirkte, setzte er sich wieder aufrecht hin. Er räusperte sich und fügte hinzu: „Und als Filmkritiker habe ich nicht nur Freunde im Geschäft. Man kann es eben nicht immer allen recht machen.“
„Richtig, Sie sind ja beim Fernsehen“, sagte Schürmann ohne den geringsten Anflug von Ironie. „Moderator, nicht wahr?“
„Journalist.“
„Man verdient ganz gut beim Fernsehen“, sagte Schalck, klopfte auf die Sofalehne und deutete auf den Lichtenstein an der gegenüberliegenden Wand.
„Das ist nur eine Reproduktion“, sagte Albrecht und ärgerte sich darüber, dass er sich völlig unnötigerweise zu rechtfertigen begann. Er hatte das Bild vor einigen Tagen aufgehängt, und das nur deshalb, weil Emily es gehasst hatte. Sie hielt Lichtenstein für etwa so originell wie van Goghs Sonnenblumen. Klo-Kalender-Kunst nannte sie es, und Albrecht konnte ihr nicht wirklich widersprechen.
„Wie man hört, soll es Ihrem Sender nicht so gut gehen.“
„So? Hört man das?“, fragte Albrecht. Seit Wochen und Monaten kursierten Gerüchte über eine nahende Insolvenz der „Berlin-Kanal GmbH“. Wie so viele kleine Sender hatte auch der Berlin-Kanal mit der Flaute in der Fernsehbranche zu kämpfen, aber bislang hatte er noch jede Krise überstanden.
„Die Einschaltquoten sind in Ordnung?“ Hauptkommissar Schalck schaute auf seine abgeknabberten Fingernägel, als habe seine Frage keinerlei Hintersinn, als sei sie ihm nur so nebenbei entschlüpft.
„Kann nicht klagen“, knurrte Albrecht. „Danke der Nachfrage.“ Er lächelte gequält und versuchte, sich zu beherrschen, doch das war wahrlich zu viel verlangt. „Was glauben Sie eigentlich, womit Sie es hier zu tun haben?“, platzte es aus ihm heraus. „Denken Sie allen Ernstes, ich fingiere ein Briefbomben-Attentat auf mich, um das Interesse an meiner Person und damit die Quote meiner Sendung zu steigern?“
„Wäre keine so dumme Idee“, sagte Schalck.
„Alles schon mal dagewesen“, fügte Schürmann bedeutungsvoll hinzu.
„Und warum bin ich dann weggerannt, anstatt mich vor der Polizei als Opfer eines Anschlags aufzuspielen und auf die Ankunft der Fotografen und Kameras zu warten?“ Zu spät merkte er, dass dies keine sehr geschickte und vertrauensfördernde Ausdrucksweise gewesen war, und so beeilte er sich hinzuzufügen: „Wenn es mir um die Erregung von Aufmerksamkeit gegangen wäre, hätte ich den Ort des Geschehens doch nicht verlassen.“
„Richtig“, sagte der Kommissar, „und damit wären wir wieder am Ausgangspunkt unseres Gesprächs angelangt: Warum sind Sie weggerannt?“
„Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht“, gestand Albrecht ein und machte eine verkniffene Miene. „Ich habe Panik bekommen. Es war kindisch, ich weiß, aber wenn ich nicht weiterweiß, dann renne ich davon. Eine dumme Angewohnheit.“
Der Hauptkommissar schaute Albrecht lange von der Seite an und wiegte bedächtig seinen fettig glänzenden Kürbiskopf. „Wissen Sie was?“, sagte er schließlich und stieß Albrecht verschwörerisch mit dem Ellbogen in die Seite. „Ich glaube Ihnen.“
Albrecht zuckte zusammen und war zugleich aufrichtig erstaunt.
„So“, grunzte Schalck und zog das O in die Länge, „und jetzt erzählen Sie mal, was eigentlich passiert ist! Und zwar der Reihe nach.“
Albrecht nickte und berichtete von dem unfrankierten und wattierten DIN-A-4-Umschlag, den er in seinem Pressefach gefunden und für das Manuskript eines schreibenden Dilettanten gehalten hatte. Er erzählte von dem Streit mit Martin Brandt und dass er den gesamten Stapel Papier aus seinem Fach in den Abfalleimer gestopft habe, weil er hungrig und genervt gewesen sei. Den Umschlag habe er nur aus Zufall nicht geöffnet, aber er sei sich sicher, dass sich darin die Bombe befunden habe. Vermutlich habe der Obdachlose in dem Abfalleimer gewühlt und dabei sei der Sprengsatz hochgegangen. Wenn er daran denke, wie die verkohlten Hände des Mannes ausgesehen hätten, würde ihm ganz mulmig.
„Ist Ihnen an dem Umschlag irgendetwas aufgefallen?“, fragte Schürmann und begutachtete neugierig etwas auf dem Sofatisch, das entfernt an einen Jointrest erinnerte. Zumindest hatte jemand einen Pappstreifen als Filter in seine Zigarette gedreht. Schürmann roch daran und runzelte die Stirn.
Albrecht suchte eilig nach einem Aschenbecher, wischte mit einer Handbewegung sämtliche Zigarettenstummel vom Tisch, zuckte entschuldigend mit den Schultern und sagte: „Es waren keine Briefmarken darauf, außerdem war die Anschrift mit Maschine geschrieben.“
„Hm“, machte der Kommissar.
„Da fällt mir etwas ein“, sagte Albrecht plötzlich, beugte sich vor und lehnte die Unterarme auf die Knie. „Der Brief war an mich adressiert, allerdings zu Händen des Pressezentrums der Berlinale.“
„Und?“
„Die Pressefächer befinden sich nicht im Pressezentrum im Grand Hyatt, sondern im Keller des Berlinale-Palastes.“
„Aha“, sagte Schürmann. „Und was folgern Sie daraus?“
„Der Mann, der den Brief abgegeben hat, wusste das offensichtlich nicht, also kann es kein Kollege gewesen sein. Und vermutlich niemand aus dem Filmgeschäft, denn im Hyatt liegen Listen mit den Pressefächern aus. Auf dem Umschlag war aber die Nummer meines Fachs nicht angegeben.“
„Warum glauben Sie, dass es ein Mann war?“
„Ich weiß es, weil er mich angerufen hat.“
„Wann?“, fragten Schürmann und Schalck gleichzeitig.
„Vor ein paar Minuten“, sagte Albrecht kleinlaut und rutschte unruhig auf dem Polster hin und her. „Kurz bevor Sie erschienen sind.“
Schalck schaute seinen Assistenten mit vielsagender Miene an, und seine Flappe sah nun aus, als stünde sein Magengeschwür kurz vor dem Durchbruch. Kopfschüttelnd wandte er sich an Albrecht: „Sie sind wirklich keine große Hilfe, Herr Niemeyer!“
„Entschuldigung“, sagte Albrecht, und er meinte es sogar.
„Und was hat der Mann gesagt?“
„Dass ich beim nächsten Mal dran bin.“
„Dann sollte sich der Kerl aber etwas mehr Mühe geben“, rutschte es dem Kriminalhauptmeister heraus.
„Wie bitte?!“ Albrecht fuhr hoch und baute sich vor Schürmann auf. „Sagen Sie das noch mal! Sie sind wohl nicht bei Trost!“
„Gemach, gemach!“, mischte sich der Kommissar ein, ohne sich jedoch vom Fleck zu bewegen. „Was mein Kollege meint, ist Folgendes: Der Sprengsatz war nicht wirklich gefährlich. Keine Metallteile, keine Nägel, nur ein wenig Schwarzpulver. Laut und stinkend, aber nicht sehr effektiv.“
„Nur ein wenig Schwarzpulver?! Ich höre wohl nicht richtig!“ Albrecht fuhr auf der Stelle herum und stieß sich das Schienbein an der Tischplatte. Mit zusammengebissenen Zähnen setzte er hinzu: „Ich hab die Hände des Obdachlosen gesehen. Sie waren schwarz verkohlt.“
„Schwarz waren sie sicher schon vorher, allerdings vor Dreck“, meinte Schürmann grinsend. „Und ‚verkohlt’ trifft die Sache wohl nicht ganz. Ein wenig angesengt vielleicht. Halb so wild.“
„Sie halten das Ganze wohl für einen Scherz?“, zischte Albrecht.
„Ein sehr böser und durchaus krimineller“, gestand Schalck ein und erhob sich schwerfällig. „Aber wir glauben nicht, dass die Briefbombe irgendjemanden töten sollte. Wir müssen natürlich den Bericht des Labors abwarten, aber es sieht eher so aus, als habe jemand seine restlichen Silvesterknaller zu einem üblen Streich benutzt. Herr Menger, so heißt der Obdachlose, konnte bereits nach kurzer ärztlicher Behandlung nach Hause … ähm … also … er musste jedenfalls nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.“
„Das Ding muss einen Zünder gehabt haben“, beharrte Albrecht, als sei es ihm plötzlich gar nicht recht, dass kein Mörder ihm auf den Fersen war. „Ein ziemlicher Aufwand für einen Streich.“
„Anleitungen zum Bombenbasteln finden Sie heute sogar im Internet“, erklärte Schalck, „schauen Sie sich nur die Seiten der Autonomen und Chaoten an. Jeder talentierte Bastler kann so was herstellen.“
„Sie schließen also jede weitere Gefahr aus?“
„Das nicht“, antwortete Schürmann und hatte Mühe, sich aus dem Fernsehsessel zu schälen. „Wir glauben lediglich, dass der Kerl Sie nicht töten, sondern Ihnen einen gehörigen Schreck einjagen wollte. Und das scheint ihm ja auch gelungen zu sein.“
„Er hat gesagt, beim nächsten Mal wäre ich dran.“
„Er wusste also, dass Ihnen nichts geschehen ist?“, folgerte Schürmann.
Albrecht nickte.
„Dann muss er die Explosion gesehen haben“, sagte Schalck und zupfte an seinem schlecht sitzenden Mantel. „Als Sondermeldung im Radio ist der Zwischenfall bestimmt noch nicht gesendet worden.“
Albrecht hatte Lust, dem Kommissar das dämliche Grinsen aus dem Gesicht zu schlagen. Doch dann stutzte er. Ein Augenzeuge, dachte er, und seine Miene verfinsterte sich noch mehr. Falls das überhaupt möglich war.
„Die Ermittlungen gehen natürlich weiter“, sagte Schalck und reichte Albrecht die Hand. „Seien Sie versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um den Kerl zu finden.“ Es war dem Kommissar anzusehen, dass er als Beamter der Mordkommission nicht wirklich daran interessiert war, den in seinen Augen läppischen Fall zu klären. Vermutlich war es unter seiner Würde.
„Wenn Sie die Ermittlungen führen, kann ich ja beruhigt sein“, fauchte Albrecht und übersah beharrlich die Hand des Kommissars. Er hatte genug von diesen beiden Idioten, wies mit der Hand zur Tür und brummte: „Entschuldigen Sie, wenn ich Sie nicht hinausbegleite. Sie kennen ja den Weg.“
Ein peinliches Schweigen entstand.
Dann drehte sich ein Schlüssel im Schloss, die Wohnungstür knallte, und Jupps Stimme war zu hören: „Hey, Ali, du glaubst nicht, was ich beim Trödel um die Ecke gefunden habe!“
Albrecht erstarrte zur Salzsäule. Das Blut schoss ihm in den Kopf. Er sah und hörte die Katastrophe nahen und hatte keine Möglichkeit, sie abzuwenden. Bevor er auch nur einen Ton von sich geben oder im Boden versinken konnte, stand Jupp im Zimmer, griente wie ein Kind zu Weihnachten und betrachtete eine Schallplatte in seiner Hand, als sei sie eine Carrera-Bahn, die er unter dem Christbaum gefunden hatte.
„Der ‚Soundtrack zum Untergang’!“, frohlockte er. „Die unzensierte Fassung von ’82. Der türkische Opa in dem Laden hatte keine Ahnung, was er mir da verkauft. Fünf Glocken wollte der dafür haben, dabei ist das Teil mehr als das Zehnfache wert.“ Erst jetzt sah er die beiden Männer und fragte: „Du hast Besuch?“
„Die Herren sind von der Polizei“, beeilte sich Albrecht zu sagen und gab Jupp ein Zeichen, bloß keine Mätzchen zu machen. „Sie wollten gerade gehen.“
„Bullerei?“ Jupp presste die Lippen aufeinander, hob die Augenbrauen und fragte belustigt: „Hast du was ausgefressen?“
Schalck und Schürmann starrten Jupp an, als betrachteten sie ein RAF-Fahndungsplakat aus den Achtzigern. Zwar war er äußerlich nicht mehr der wilde Punk von früher, die ungewaschenen blondierten Haare waren nicht mit Seife zur Igelfrisur hochgestellt, und die gammelige Lederjacke war weder besprüht noch mit Nieten besetzt, aber Jupp sah aus wie jemand, der subtilere und effektivere Formen gefunden hatte, das verhasste System zu bekämpfen. Eine Verbrechervisage. Ein Subversiver. Ein Anarchist, wie er im Buche stand. Die versteinerten Mienen der Polizisten sprachen Bände. Bei Jupps Anblick stellten sich ihnen die Nackenhaare auf, und wären sie Hunde gewesen, hätten sie geknurrt und die Zähne gefletscht.
„Darf ich?“, fragte Jupp. Ohne auf eine Antwort Albrechts zu warten, ging er zum Plattenspieler und legte das frisch erworbene Stück radikal-alternativer Musikgeschichte auf den Teller. Er drehte sich um, schaute die Kriminalbeamten triumphierend an und sagte: „Das wird die Herren interessieren.“
„Bitte nicht!“, bat Albrecht leise, aber mit Nachdruck. Er wusste, was nun folgen würde. Er kannte den „Soundtrack zum Untergang“, allerdings nur die zensierte, mit Pieptönen verschandelte Version. Als er sah, dass sein Flehen bei Jupp auf taube Ohren stieß, wandte er sich an die Polizisten: „Ich möchte Sie nicht weiter aufhalten. Lassen Sie es mich wissen, wenn es etwas Neues gibt!“
„Einen Moment haben wir sicherlich noch Zeit“, sagte Schalck, der nun einen lauernden Ausdruck im Gesicht hatte. „Wir sind sehr gespannt, was Ihr Mitbewohner uns zu hören geben will.“
„Er ist nicht mein Mitbewohner“, konnte Albrecht noch erwidern, bevor die Nadel über das Vinyl kratzte.
„Bullenschweine, Bullenschweine, in der ganzen Welt!“, schallte es aus den Lautsprechern, und ohne zu wissen wieso, fiel Albrecht plötzlich der Titel des Louis-de-Funès-Films wieder ein: „Hasch mich, ich bin der Mörder!“
–
3
Albrecht hatte im Fremdwörterbuch nachgeschlagen, um zu erfahren, was „Adagio“ überhaupt bedeutete: langsames Musikstück. Als ehemaliger Punkrocker kannte er sich mit langsamer Musik nun wahrlich nicht aus, und obwohl die Zeiten der drei Akkorde und Trommelwirbel längst vergangen waren und er musikalisch gesehen kein solcher Betonkopf wie Jupp war, hatte er den Zugang zu klassischer Musik nie gefunden. Vor einigen Jahren hatte er sich bei einem TV-Shop eine CD-Sammlung mit dem Titel „Best of Classic“ bestellt, aber noch nicht ein einziges Mal hineingehört. Beethoven, Mozart und Konsorten kannte er nur als Hintergrundmusik für Werbespots. Und das reichte ihm.
Das „Adagio“, in dem sich während der Berlinale der „Bärenclub“ (Gott, wie peinlich!) befand und in dem der abendliche Empfang des „Panorama“ mit anschließender Party stattfand, war eine Mischung aus orientalischer Räuberhöhle, barockem Tanzsaal und viktorianischem Landhotel. Das Mobiliar war gediegen bis altertümlich, Tische aus dunklem Holz und Stühle mit unbequem hoher Rückenlehne, persische Teppiche auf dem Boden, am Kopfende des Raumes ein unechtes Kaminfeuer mit Lesesesseln aus Lederimitat. Überall standen Skulpturen und riesige, gusseiserne Ständer mit tropfenden Kerzen herum, vermutlich ausgediente Theaterkulissen. Tiefe Decken aus dunklem Holz wechselten mit vergoldeten Kinkerlitzchen und steinernen Statuen und Säulen ab. Eine seltsame Kombination, die entweder sehr mutig oder schlicht lachhaft war.
Am Eingang, zwischen den beiden Papplöwen, stand eine Frau im rot karierten Kostüm und kontrollierte die Einladungen. Als Albrecht vor ihr stand und sein Kärtchen vorzeigte, hielt sie inne und betrachtete ihn skeptisch. Sie wirkte irritiert, ja beinahe erschrocken. Die kurz geschnittenen, schwarz gefärbten Haare standen ihr strubbelig vom Kopf ab, und zumindest in dieser Hinsicht unterschied sie sich deutlich von den anderen, meist blonden und sehr feminin aussehenden rot karierten Frauen. Den zum Kostüm passenden schwarzen Schlips trug sie lose und etwas nachlässig. Ihre dunklen Augen bohrten sich regelrecht in Albrechts Gesicht.
„Ist was?“, fragte er genervt.
„Könnte ich wohl Ihre Akkreditierung sehen?“
„Wie bitte?“ Er stemmte die Arme in die Seite und traute seinen Ohren nicht. „Genügt Ihnen die Einladung nicht? Wollen Sie auch noch meinen Pass sehen? Oder meine Meldebestätigung samt Blutspendeausweis?“
„Die Akkreditierung genügt mir“, erwiderte die Frau, und ihre Stimme klang nun sehr bestimmt und kalt. „Ich möchte mich nur vergewissern, dass Sie der entsprechende Gast zu der Einladung sind.“
„Wie wollen Sie das kontrollieren, meine Liebe, wenn auf der Einladung gar kein Name vermerkt ist?“, wunderte sich Albrecht und kramte kopfschüttelnd nach seiner rot markierten, mit Foto und Name versehenen Akkreditierungskarte. „Vielleicht habe ich ja die Einladung im Papierkorb gefunden, und Sie könnten es mir trotzdem nicht beweisen.“
Die Frau stutzte einen Moment und machte ein verlegenes Gesicht, sie schien Albrechts Argument nicht von der Hand weisen zu können, zuckte jedoch mit den Schultern und sagte: „Ich folge nur meinen Anweisungen.“
„Das hat Eichmann auch gesagt“, fauchte Albrecht unhörbar, zeigte seine Marke und wollte den „Bärenclub“ betreten.
Die Frau hielt die Akkreditierung fest und fragte: „Albrecht Niemeyer?“
„Soll ich es Ihnen auch noch buchstabieren?“
„Nicht nötig“, antwortete sie und biss sich auf die Unterlippe. „Viel Spaß noch, Herr Niemeyer.“
Albrecht schüttelte verwundert den Kopf, betrat den düsteren, nur mit Kerzenlicht erleuchteten Raum und hielt nach Emily Ausschau. Sie würde hier sein, das wusste er. Schließlich war sie die Assistentin von Wieland Speck, dem Leiter des „Panorama“. Und Emily war der einzige Grund, warum Albrecht heute Abend zu dem Empfang gekommen war. Er wollte mit ihr reden. Das erste Mal seit dem Faustschlag im „Peru“. Auf der Berlinale war er ihr tunlichst aus dem Weg gegangen, mehrmals hatte er sie aus der Ferne gesehen, doch wenn sich ihre Blicke gekreuzt hatten, dann hatte er rasch zu Boden geschaut oder ihr den Rücken zugekehrt. Doch heute musste er sie sprechen. Die Bombe hatte alles verändert. Der Flegel von Kriminalhauptmeister hatte Recht gehabt: Der Unbekannte hatte Albrecht eine Heidenangst eingejagt. Auf dem Weg zum „Adagio“ hatte er sich mehrmals zu Tode erschreckt, als er Schritte hinter sich gehört oder vermeintliche Schatten in Hauseingängen verschwinden gesehen hatte. Sämtliche Passanten hatte er gemustert, als befürchtete er, jeden Moment niedergestreckt zu werden. Die Tatsache, dass die Polizei den Anschlag nicht ernst nahm, beruhigte ihn kaum. Es bedeutete lediglich, dass sie nicht wirklich nach dem Täter suchen würden. Und darum musste er nun mit Emily reden. Wegen Felgenhauer. Und allem.
Leider konnte er sie nirgends entdecken. Es war so duster in diesem Schuppen, dass man keine zehn Meter weit schauen konnte. Linker Hand schien sich das kalte Büfett zu befinden, zumindest nach dem Pulk von Menschen zu urteilen, die dort einen Tisch belagerten. Albrecht erkannte einige Kollegen, die sich um die Lachshäppchen und Geflügelbeine regelrecht prügelten. Wenn es etwas umsonst gab, waren Journalisten nicht weit. Albrecht kannte Kollegen, die den ganzen Tag hungerten, wenn sie abends auf einen Empfang eingeladen waren. Dass sie nicht auch noch die leer gegessenen Teller einsteckten, war alles andere als selbstverständlich. Von Emily keine Spur. Als er sich um die eigene Achse drehte, fiel sein Blick erneut auf den neongrün erleuchteten Eingang. Die Frau mit den Strubbelhaaren starrte ihn an. Ihre Blicke trafen sich. Und dann lächelte sie, als sei sie froh, ihn zu sehen.
Warum hatte sie ihn eigentlich nach der Akkreditierung gefragt?, schoss es Albrecht plötzlich durch den Kopf. Immerhin waren auch Nicht-Journalisten geladen. Und woher wusste sie überhaupt, dass er Journalist war? Er sah an sich hinab und verdrehte die Augen. Am Revers seines Mantel prangte ein silberner Anstecker: „Berlin-Kanal“. Ein Geschenk des Senders. Wie dumm!
„Du hier?“, riss ihn Emilys Stimme aus seinen Gedanken. „Ich hätte nicht gedacht, dass du dich in die Höhle des Löwen traust.“
Albrecht fuhr herum und erstarrte. Sie sah hinreißend aus, betörend, umwerfend. Er sah sie an wie das chinesische Feuerwerk, das gestern Nacht den Potsdamer Platz verzaubert hatte. Ihre Haare hatte sie auf Streichholzlänge abgeschnitten und mit Henna dunkelrot gefärbt, und die neue Frisur stand ihr. „Nur wirklich schöne Frauen können sehr kurze Haare tragen“, hatte Jupp einmal behauptet, „denn sie haben es nicht nötig, mit langen Zotteln von ihrem nichts sagenden Gesicht abzulenken.“ Albrecht hatte damals vehement widersprochen, weil Emilys Haare ihr zu dem Zeitpunkt bis zum Po gereicht hatten. Doch nun gab er Jupp Recht. Er starrte auf das kleine Muttermal auf Emilys Nase, das sie so hässlich und er so niedlich fand. Er schaute in ihr Gesicht, sah das ängstliche Lächeln, das sich darin abzeichnete, und hätte vor Freude heulen können. Er vergaß alles, was er sich vorgenommen hatte. Ihm fehlten die Worte, die er sich so sorgsam zurechtgelegt hatte. Er blieb stumm.
„Redest wohl nicht mehr mit mir, was?“ Sie presste die Lippen aufeinander, und das Lächeln wurde noch ängstlicher. Doch dann hakte sie sich plötzlich bei ihm unter und führte ihn in den Saal, der ein wenig tiefer lag als der Eingangsbereich. Am Kopfende des Raumes, neben dem Kamin, hatte ein DJ sein Pult aufgebaut. Er hielt einen Kopfhörer an sein Ohr, fuhr mit dem Finger über einen Plattenteller, und aus vier riesigen, symmetrisch im Raum verteilten Lautsprechertürmen erklang plötzlich House-Music, die ebenso ohrenbetäubend wie nichts sagend war. Tanzmusik ohne jeden Charakter.
„Eigentlich ist das der Grund, warum ich hier bin“, sagte Albrecht, und weil es so laut war, musste er Emily ins Ohr schreien. Er hatte Lust, ihr ins Ohrläppchen zu beißen, und den Ohrring, den er ihr zum letzten Geburtstag geschenkt hatte, in den Mund zu nehmen. Ihm wurde mit einem Mal ganz übel.
Verdammter Mist.
„Was?“, wunderte sich Emily. „Wegen der Musik?“
„Nein, um mit dir zu reden“, antwortete er und spürte es in seinem Nacken kribbeln. Wie kleine Nadelstiche. Vielleicht sollte er doch mal zum Neurologen gehen. Er konnte Ärzte nicht ausstehen. Nicht nur wegen Felgenhauer. Aber auch wegen ihm. In Albrechts Kopf ging es drunter und drüber, er verlor den Faden, bevor er ihn in der Hand gehabt hatte. Was wollte er eigentlich hier? Was sollte das bringen? Reiß dich zusammen, Mensch!
Er sagte: „Jemand will mich töten!“
„Was hast du gesagt?“ Emily hatte sich gerade zu ihrem Chef umgewandt, der sich von hinten genähert und mit besorgter Miene etwas gefragt hatte.
„Nichts“, sagte Albrecht. „Hallo, Wieland!“
„Hallo, Albrecht. Wie geht’s?“, erwiderte der Angesprochene, wartete jedoch nicht auf eine Antwort und sagte zu Emily: „Du kümmerst dich darum? Und sag Dieter, er braucht nicht auf mich zu warten!“
Emily nickte, Wieland Speck verschwand, und Albrecht fragte: „Kein guter Augenblick?“
„Du siehst ja, was hier los ist“, antwortete sie. „Die Ehrengäste sind noch nicht da, das Büfett reicht nicht, und der DJ ist alles andere als kooperativ.“
Kooperieren war eines von Emilys Lieblingswörtern, und es erinnerte Albrecht an einen tätowierten und muskelbepackten Ex-Junkie, der ihm die Wohnung leer geräumt hatte.
„Ist Felge auch da?“, zischte er.
„Bitte nenn ihn nicht so!“
„Ist er?“
„Yes, goddammit!“ Immer wenn sie sich ärgerte, verfiel sie in ihre Vatersprache. Auf Englisch ließ es sich besser fluchen. Sie deutete zu einer kleinen Bar an der Seite, unterhalb einer Empore, und sagte: „Heinrich ist auch da.“
Heinrich! Albrecht hatte Felgenhauers Vornamen nie behalten können. Schon bei ihrer ersten Begegnung im letzten Sommer war ihm der Name ständig entfallen. Es war auf einer Geburtstagsfeier gewesen, und er hatte ihn abwechselnd Hermann oder Herbert genannt. Weil Felgenhauer höchst pikiert und ohne den geringsten Sinn für Humor auf diese falschen Anreden reagiert hatte, hatte Albrecht aus dem Vergessen eine lieb gewordene Angewohnheit gemacht. Für ihn war der „Doktor“, wie Felge von seinen Freunden genannt wurde, nichts weiter als ein fünfzigjähriges George-Clooney-Imitat mit kurz geschorenem, an den Schläfen angegrautem Haar, männlich markantem Gesicht und eingemeißeltem Ärztelächeln. Ein Fernsehdoktor. Der Kerl war ihm auf Anhieb zuwider gewesen. Er war zu unverbindlich nett, zu gut aussehend, zu verständnisvoll. Gerade so, als hätte Albrecht damals schon gewusst, dass Felgenhauer mit seiner Frau schlief. Er durfte gar nicht daran denken!
„Hermann, altes Haus!“, rief Albrecht und ging mit ausgestreckten Händen zur Bar, als wolle er Felgenhauer um den Hals fallen. Oder an die Gurgel gehen.
„Was willst du?!“ Felgenhauer sprang von seinem Hocker und wich erschrocken zurück. „Rühr mich nicht an!“ Er stieß rücklings an einen Kerzenständer, der bedenklich wackelte, und im Licht der flackernden Kerzen schimmerten sein linkes Auge sowie die Wange in blassen Regenbogenfarben. Eine Schwellung war jedoch nicht mehr zu sehen. Schade, eigentlich!
„Albrecht!“, rief Emily und stellte sich zwischen die beiden.
„Was denn?“, fragte Albrecht, als könne er kein Wässerchen trüben. „Darf man nicht einmal ‚Hallo’ sagen?“ Er reichte Felgenhauer die Hand, weil er wusste, dass dieser sie nicht nehmen würde.
„Cut that crap! Spiel bitte nicht den Hanswurst!“, sagte Emily und schüttelte den Kopf. „Das steht dir nicht.“
„So? Und was steht mir? Der Hahnrei? Der Dämlack?! Der gute Kumpel, der früher mal der Ehemann war?“ Er ärgerte sich über sich selbst und seine unwürdigen Possen. Er hasste sich, wenn er sich so gehen und auf ihr niedriges Niveau herabziehen ließ, aber er konnte nicht anders. Felge und Emily! Es war zum Verrücktwerden. Zum Kotzen! Er wurde zum gekränkten Teenager, wenn er die beiden zusammen sah. Zum wutschnaubenden Berserker. Und in seinem Jähzorn tat und sagte er Dinge, die ihm gar nicht ähnlich sahen und anschließend peinlich waren. Auch wenn er dies niemals und unter keinen Umständen öffentlich eingestanden oder sich gar für seine Ausraster entschuldigt hätte.
Felgenhauer hatte sich inzwischen in großem Bogen um Albrecht herumgeschlichen, sich wieder auf seinen Hocker gesetzt und wandte sich mit einem verkniffenen Lächeln an eine blonde Frau, die neben ihm am Tresen hockte. „Tut mir Leid“, sagte er und hob verächtlich die Augenbrauen.
Allein für dieses „Tut mir Leid“ hätte Albrecht sich auf ihn stürzen sollen, doch die blonde Frau blickte in Albrechts finsteres Gesicht, schien seine Absicht zu erkennen und sagte mit einem charmanten Lächeln: „Herr Niemeyer? Schön, dass ich Sie kennen lerne. Ich bin ein großer Fan Ihrer Sendung.“
Albrecht wusste nicht, ob sie sich über ihn lustig machen oder lediglich schlichtend eingreifen wollte. Er stutzte, ließ Felgenhauer links sitzen und betrachtete die Frau eingehender. Sie war etwa Ende dreißig, hatte schulterlanges Haar und eine ziemlich üppige Figur. Ihr kurzes, blaues Kleid war tief dekolletiert, so dass die vollen Brüste zur Geltung kamen. Albrecht kam nicht umhin, ihr in den Ausschnitt zu starren.
„Sie dürfen mir ruhig ins Gesicht schauen“, sagte sie.
„Gar nicht so einfach, wenn man von der Etage darunter so abgelenkt wird“, rief Albrecht gegen die nun noch lauter werdende Musik an und reichte ihr die Hand. „Freut mich. Ich heiße Albrecht.“
„Das ist Kerstin Harms“, stellte Emily vor. Ihr war die Erleichterung über die ausgebliebene Eskalation anzusehen. „Kerstin ist meine Assistentin.“
„Die Assistentin der Assistentin?“, fragte Albrecht spöttisch. „Also eine Art Praktikantin?“
„Wenn Sie so wollen“, antwortete Kerstin, und das Lächeln in ihrem Gesicht wurde frostig. „Und Sie sind demnach der gehörnte Gatte?“
Albrecht schluckte. Was für ein Biest! Er lachte möglichst laut, um nicht als humorlos zu gelten, und stellte sich zwischen Felgenhauer und Kerstin. „Du erlaubst doch, Herbert?“, fragte er und bestellte beim Barkeeper ein Bier. Norddeutsch, gezapft, null zwei, weil es sonst zu schnell verschalte. Der Mann hinter dem Tresen schien Albrechts alkoholische Vorlieben bereits zu kennen und nickte kommentarlos.
„Emily?! Kannst du mal kommen?“ Von der Tanzfläche her näherte sich Dieter Kosslick, der Leiter der Filmfestspiele, und schickte Hilfe suchende Blicke zur Bar. Obwohl er wie üblich grinste und dabei mit seinen Stoppelhaaren an einen zu groß geratenen Lausejungen erinnerte, schien er sehr erregt zu sein und fuchtelte wie eine Krake mit den Armen. „Emily, hast du Wieland gesehen? Da hinten geht gar nichts mehr. Ein einziges Chaos.“ Er nickte Albrecht kurz zu, ohne ihn wirklich zu erkennen, und fragte: „Wo steckt der bloß?“
„Komme schon“, antwortete Emily, wandte sich entschuldigend an Felgenhauer und meinte: „Bin gleich wieder da.“ Und mit einem Seitenblick zu Albrecht fügte sie hinzu: „Be good!“ Damit verschwand sie samt Kosslick im Getümmel.
„Und was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend?“, fragte Kerstin.
Albrecht fiel auf, dass sie weiche und harte Konsonanten vertauschte. Das b klang wie ein p, das g wie ein k. Und umgekehrt. Er fragte: „Sie kommen aus dem Saarland?“
Sie schien überrascht zu sein. Vermutlich hatte sie bislang geglaubt, dialektfreies Hochdeutsch zu reden. Sie lächelte etwas gezwungen, zündete sich eine Zigarette an und sagte: „Pfalz.“
„Soll ja sehr schön sein“, sagte Albrecht, der sich über die Zigarettenmarke wunderte. Es war eine Roth Händle, filterlos, und wenn man genauer hinschaute, konnte man bräunliche Nikotinspuren an Kerstins Fingern erkennen. Er schob leicht die Unterlippe vor und fragte: „Was meinst du, Hermann?“
Felgenhauer zuckte mit den Schultern und schaute aus der Wäsche, als habe er sich in die Hose gemacht. Immer wieder ruhte sein Blick auf Albrecht, vor allem auf dessen rechter Faust, als führe diese ein Eigenleben. Er rückte ein Stück beiseite und nippte an dem Prosecco, der von livrierten Männern auf Silbertabletts gereicht wurde.
„Wollen Sie tanzen?“, wandte sich Kerstin an Albrecht.
Diesmal kam Albrechts Lachen von Herzen. „Nur über meine Leiche!“, rief er und beobachtete aus den Augenwinkeln, wie Felgenhauer auf diesen Ausdruck reagierte: gar nicht.
„Seien Sie mir nicht böse“, fuhr Albrecht fort und hob die Hände, als wolle er Abbitte leisten, „aber das erste und letzte Mal hat man mich im Jahr 1987 auf der Tanzfläche gesehen. Und damals haben wir Pogo getanzt.“
Kerstin Harms lachte und stieß den Rauch in sein Gesicht, sie schien ihm kein Wort zu glauben.
„Dann helfe ich gerne aus“, beeilte sich Felgenhauer, in die Bresche zu springen. Er schien froh zu sein, aus Albrechts Nähe entkommen zu können, und reichte Kerstin, die kurzerhand ihre Zigarette auf dem Boden entsorgte, die Hand. „Darf ich bitten?“
Während die beiden zur Tanzfläche gingen und sich in den Tross der unkoordiniert Zappelnden einreihten, dachte Albrecht an jenen Tanz aus dem Jahr 1987 zurück. Nein, es war keine Lüge gewesen. Er hasste das Tanzen wie die Pest. Er hatte einfach kein Talent dafür. Dieser eine Tanz war tatsächlich sein erster und einziger gewesen. Dass er sich damals zu Emily auf die Tanzfläche gewagt hatte, war vermutlich der größte Liebesbeweis gewesen, den es überhaupt geben konnte. Und das ausgerechnet zu „This is not a love song“.
Sie waren im „Linientreu“ in der Budapester Straße gewesen, einem Gruftie-Laden, den Albrecht nie recht hatte leiden können, doch dummerweise hatte er Emily die Wahl des Tanzlokals zugestanden. Er selbst hatte das Kreuzberger „Basement“ vorgeschlagen, nicht ganz ohne Hintergedanken, denn er wohnte damals in unmittelbarer Nähe, am Platz der Luftbrücke, und hoffte, sie würde nach dem Discobesuch noch auf einen Absacker oder Kaffee mit zu ihm kommen. Oder einen Joint, weil der immer so schön müde machte. Doch Emily hatte gemeint, sie sollten lieber in Ku’dammnähe bleiben. Es war ihr erstes Rendezvous gewesen, und Albrecht erinnerte sich an jedes Detail dieses Abends: Zuerst waren sie im Kino gewesen („Der Himmel über Berlin“ im „Gloria-Palast“), dann beim Italiener („Pizza Capricciosa“ und „Tortellini Gorgonzola“ in einem Restaurant in der Kantstraße), und schließlich hatte Emily darauf bestanden, im „Linientreu“ einen Verdauungstanz aufs Parkett zu legen. Da Albrecht auf die Schnelle kein unverdächtiger Grund für die umständliche Fahrt nach Kreuzberg eingefallen war, hatte er achselzuckend eingewilligt. Es würde schon nicht so schlimm werden. Kaum hatten sie die von schwarz gekleideten Teufelsanbetern und Leuten mit Brikettfrisuren bevölkerte Disco betreten, schon schmetterten P.I.L. ihr Nicht-Liebeslied in den Saal. Emily war aufgesprungen, hatte vor Freude gejuchzt und Albrecht auf die Tanzfläche zerren wollen, doch er hatte sich mannhaft geweigert. Tanzen? Das kam ja gar nicht in Frage. Zu Public Image Ltd.? Gott bewahre!
Schließlich war sie allein zu dem wie ein Boxring in der Mitte gelegenen Geviert gegangen. Von den höher gelegenen Rängen konnte er ihren Gesichtsausdruck sehen: missgestimmt und enttäuscht. Wie gesagt, es war ihre erste Verabredung. Er war unsterblich in sie verliebt. Er sah seine Felle davonschwimmen. Panik erfasste ihn. Und deshalb folgte er ihr auf die Tanzfläche: unbeholfen, linkisch, selig. Emily schloss ihn in ihre Arme.
„This is not a love song.“
Sie hatten sich in der Mensa in Lankwitz kennen gelernt. Eine ganze verkochte Mahlzeit lang hatte Albrecht ihr gegenübergesessen, ohne den Mut zu finden, sie anzusprechen. Er wartete darauf, dass sich ihre Blicke trafen, doch sie schaute nicht hoch und tat so, als sei er gar nicht anwesend. Erst als sie den letzten Bissen des Nachtisches gelöffelt hatte und das Besteck beiseite legte, fasste er sich ein Herz und sagte etwas Bedeutungsvolles wie: „Schmeckt’s?“
Sie lächelte vage, zuckte mit den Schultern, stand auf und ging.
Er saß wie versteinert da, mit hochrotem Kopf, kaum in der Lage zu atmen. Doch dann sprang er auf und lief ihr hinterher. Er sah noch, wie sie im Haus L verschwand, und folgte ihr wie ein Hund seinem Herrchen, ohne darauf zu achten, wohin sie ihn führte. Sie betrat einen Raum, er tat es ihr gleich, und ehe er sich versah, saß er in einem Seminar mit dem Titel: „Einführung in die Medienökonomie“ und trug seinen Namen in die Referatsliste ein. Neben den ihren: Emily Macpherson. Und einen weiteren: Martin Brandt.
Eigentlich studierte sie Betriebswirtschaft, doch weil an der FU das interdisziplinäre Studieren möglich war, besuchte sie ein Seminar bei den Publizisten und ließ sich den Schein bei den BWLern anrechnen. Albrecht interessierte sich einen feuchten Kehricht für die ökonomischen Aspekte der Medienpolitik, und das Seminar war das mit Abstand langweiligste seiner ohnehin nicht sehr aufregenden Universitätslaufbahn. Und dennoch war es die schönste und vor allem erregendste Veranstaltung, die er in all den Jahren besuchen sollte. Ein ganzes Semester lang saß er neben Emily, ohne auf den staubtrockenen Quatsch zu achten, den die Dozentin, der Tutor oder die Kommilitonen an der Tafel von sich gaben. Er hatte nur Augen und Ohren für SIE, ihre Stimme war wie Sirenengesang, ihr kaum hörbarer englischer Akzent war zuckersüß, ihr Profil brannte sich in sein Hirn ein, und wenn er die Augen schloss, sah er es im Negativ, als habe er zu lange in die Sonne geschaut. Es hatte ihn erwischt, mit aller Macht, wie nie zuvor, und er litt mit Wonne unter der kühlen Reserviertheit, die sie ihm gegenüber an den Tag legte.
Einmal in der Woche trafen sie sich zu dritt in der Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße, um das gemeinsame Referat „Ökonomische Strukturen des Rundfunks“ vorzubereiten. Nie waren sie allein, stets war Martin mit von der Partie, nicht ein einziges Mal schwänzte er die Treffen, allerdings aus anderen Gründen als Albrecht, er schien sich tatsächlich für diesen Wirtschaftsunsinn zu interessieren. Wenn Albrecht Emily fragte, ob sie sich nicht außerhalb der Uni einmal treffen könnten, dann antwortete sie, das täten sie doch, einmal die Woche in der Stabi, mit Martin als Anstandswauwau, und dabei solle es auch bleiben.
Umso überraschter war Albrecht, als Emily direkt nach dem mäßig gelungenen und vor beinahe leeren Rängen vorgetragenen Referat vorschlug, sie könnten sich ja am folgenden Wochenende sehen. Ohne Martin. Wenn er Zeit und Lust habe. Kino sei in Ordnung. Der neue Wenders solle gut sein. Und Tanzen. Vielleicht.
Und dann waren sie im „Linientreu“ gewesen, und er hatte mit seiner zukünftigen Gattin getanzt. Seiner zukünftigen Ex-Gattin.
„Beim nächsten Mal bist du dran!“
Albrecht schrak zusammen und starrte entgeistert in Felgenhauers erhitztes Gesicht. Er hatte rote Flecken auf der Wange und Schweiß auf der Stirn, das Tanzen schien ihn über Gebühr angestrengt zu haben, er hatte sich die Krawatte gelockert. Ein scheußliches Ding in schreienden Farben, das er vermutlich für jugendlich schick hielt.
„Ich sagte: Beim nächsten Tanz bist du dran“, wiederholte Felgenhauer.
Und plötzlich wusste Albrecht, dass Felgenhauer nicht der Mann war, der ihn angerufen hatte. Eigentlich hätte er schon früher darauf kommen können.
Heinrich Felgenhauer war ein gebürtiger Ossi, Ost-Berliner, und wie so viele Bewohner der ehemaligen Hauptstadt der DDR pflegte er den Berliner Dialekt, als sei es eine aussterbende, aber erhaltenswerte indianische Sprache. Während sich im Westteil der Stadt die sozial Arrivierten, Akademiker und Besserverdienenden bemühten, nicht zu sehr nach Weddinger oder Neuköllner Hinterhof zu klingen, waren die Ossis stolz auf ihren Icke-Slang. Selbst Anwälte, Politiker und Ärzte redeten in breitestem Dialekt, und Felgenhauer war in dieser Hinsicht ein Muster-Ost-Icke. „Det is schau“, sagte er und: „Wo jibt’s denn so wat!“ Oder: „Beim neesten Tanz bis du dran.“
Selbst wenn Felgenhauer sich vorgenommen hätte, dialektfrei zu sprechen, das „neeste“ hätte er nicht unterdrücken können. Das Vertauschen von ä und e war ihm so eigen wie ein Muttermal. Wie den meisten Berlinern wäre es ihm nie in den Sinn gekommen, die Aussprache von „Keese“, „Zeene“ oder „Holzspeene“ zu hinterfragen. Doch Albrecht war sich plötzlich sicher, dass der Anrufer nicht „neeste“ oder „neechste“ gesagt hatte. Und wenn er es recht bedachte, hatte der Kerl das Wort irgendwie komisch ausgesprochen. Albrecht hatte einen Dialekt-Tick. Als Westfale in Berlin hatte er oft genug den Spott seiner Mitmenschen ertragen müssen. Ausgerechnet die Berliner hatten sich mit Inbrunst über seine falsche Aussprache lustig gemacht. Als Fernsehjournalist hatte er sogar Sprachtraining genommen, um das in die Länge gezogene i und das zu harte ch loszuwerden.
„Näggstes Mal!“ So hatte der Mann gesagt. Mit kurzem ä! Und zu hartem Konsonant. Ein Süddeutscher.
„Hörst du mir überhaupt zu?“
„Hm?“
Da wo gerade noch Felgenhauer gestanden hatte, stand nun Emily und schüttelte missbilligend den Kopf. „Was ist bloß mit dir los?“, fragte sie. „Die ganze Zeit starrst du Löcher in die Luft, und wenn ich dich etwas frage, redest du Unsinn. Was denn für ein Süddeutscher?“
„Du würdest es ohnehin nicht verstehen.“
„Danke für dein Vertrauen.“
„Warum sollte ich ausgerechnet dir vertrauen?“, fauchte er.
Emily erstarrte. Sekundenlang bewegte sie sich nicht. Nur ihre Lippen bebten. Es schien beinahe so, als fange sie gleich zu weinen an. Doch bevor die Tränen liefen, wandte sie sich ab und fuhr mit dem Ärmel ihres Kleides übers Gesicht.
„Du bist so ein Widerling!“, ereiferte sich Felgenhauer, der die Szene von der Seite beobachtet hatte und nun auf Emily zustürzte.
Diesmal war keine Kerstin da, die Albrecht zurückhalten konnte. Der Faustschlag kam blitzartig und präzise. Aber er brachte Albrecht keine Genugtuung. Nicht mal das.
Emily weinte. Felgenhauer blutete aus der aufgeschlagenen Lippe. Und Albrecht rannte zum Ausgang. Es war wie ein Déjà-vu-Erlebnis.
Zwischen den beiden Löwen wachte niemand mehr. Doch in dem angrenzenden Raum mit den Pressefächern sah er zwei Frauen in einer Ecke stehen. Die eine mit strubbeligen schwarzen, die andere mit langen blonden Haaren und filterloser Zigarette im Mund. Sie starrten ihn an wie einen Geist. Wie eine Erscheinung. Die Rotkarierte versuchte sich an einem dünnen Lächeln, es wirkte beängstigend. Kerstin Harms hingegen war lediglich verlegen oder verwirrt. Kein Wunder, schließlich hielten sich die beiden Frauen an den Händen. Sehr vertraut und zärtlich.
Aber auch das konnte Albrecht nicht wirklich überraschen. Heute nicht.
–
4
Am folgenden Morgen hatte Albrecht keine Schwierigkeiten, zeitig aufzustehen. Er hatte ohnehin kaum und nur sehr unruhig geschlafen. Um sieben Uhr stand er bereits im Bad und rasierte sich, um halb acht saß er mit Pflaster auf der Wange in der Küche und würgte einen Kaffee samt Brötchen herunter, um acht verließ er das Haus und setzte seine Thälmann-Mütze auf, und um Punkt halb neun betrat er den zum Pressebüro umfunktionierten Konferenzraum „Enzo Piano“ im ersten Stock des Grand Hyatt. Frauke Greiner, die Pressechefin der Berlinale, sei nicht anwesend, erfuhr er von einer Mitarbeiterin hinter dem Tresen.
„Noch nicht?“, fragte Albrecht.
„Nicht mehr“, antwortete sie lächelnd.
Wer’s glaubt!, dachte er und fragte: „Wissen Sie zufällig, ob die Polizei gestern nach mir gefragt hat?“
Sie zuckte mit den Schultern, schaute peinlich berührt drein und sagte: „Ich glaube, zwei Herren von der Kripo haben mit Frau Ramin gesprochen.“
Daniela Ramin war die Assistentin von Frauke Greiner.
„Ist Frau Ramin da?“, wollte Albrecht wissen, obwohl er die Antwort zu kennen glaubte.
„Nicht mehr“, sagte die Frau.
„Verstehe“, brummte Albrecht, und da war sie wieder, die schlechte Laune.
Er verließ grußlos das Pressebüro und schritt hinüber zum Ticket-Counter, der zu dieser frühen Stunde noch nicht von Journalisten belagert war. Eigentlich brauchte er für die morgendlichen oder nachmittäglichen Pressevorführungen keine Tickets, seine Akkreditierung reichte völlig, er gehörte sogar zu dem erlauchten Kreis der Berichterstatter, die zu den abendlichen Wettbewerbs-Premieren und Sondervorführungen Zugang hatten, doch er hatte Jupp zu Beginn der Berlinale versprochen, ihm Karten für die Wiederholungsvorstellungen des Forums zu besorgen. Und so stand er jeden Morgen vor der ersten Vorführung mit betretener Miene am Schalter und ließ sich Tickets für die asiatischen und afrikanischen Kunst- und Trashfilme ausdrucken. Nicht dass er einem Freund Karten besorgte, war für ihn ein Problem oder bereitete ihm Gewissensbisse (alle Journalisten versorgten Familie und Freundeskreis mit Tickets), sondern dass dieser spezielle Freund abstruse Forumskarten wollte. Die Mitarbeiter am Ticket-Counter konnten sich denken, dass Albrecht die Karten nicht für den persönlichen Gebrauch wünschte, schließlich kannten viele von ihnen seine Sendung. Und Albrecht hasste es, wenn sie ihm die Tickets mit wissendem Lächeln überreichten, als seien sie Eingeweihte einer konspirativen Operation.
„Guten Morgen, Herr Niemeyer“, sagte der Mann, dessen Gesicht Albrecht schon seit sechs Jahren kannte, dessen Name (der samt Foto auf einem Anstecker an seiner Brust prangte) ihm aber jedes Mal aufs Neue entfiel. „Schön, Sie zu sehen“, setzte der Mann unpassenderweise hinzu und lächelte kokett. „Gestern einen schönen Tag gehabt?“
Nicht schon wieder, dachte Albrecht. Manchmal schien es ihm, als seien alle Berlinale-Mitarbeiter homosexuell. Gehörte es etwa zu den obersten Einstellungskriterien, nur vom eigenen Geschlecht sexuell angezogen zu werden? Im Panorama hatte Albrecht sich inzwischen daran gewöhnt, schließlich war Wieland Specks Homosexualität kein Geheimnis, und diese Tatsache hatte ihn durchaus beruhigt, als Emily ihm vor einigen Jahren von ihrem Job in Specks Büro berichtet hatte. Immerhin war Speck ein gut aussehender Zeitgenosse. Albrecht interessierte sich nicht für Schwule, weder sexuell noch sonst wie, sie waren ihm egal, allerdings irritierte es ihn, dass sie so augenfällig auf ihn standen. Schon oft hatte er diese Erfahrung gemacht. Vielleicht lag es daran, dass er trotz seiner Größe, seines kräftigen Körperbaus und der kurz geschorenen Haare beinahe feminin aussah. Sein Gesicht hatte etwas Weiches, Jungenhaftes und stand damit in krassem Gegensatz zu seinem oft barschen Auftreten. War Felgenhauer ein George-Clooney-Imitat, mit stechenden Augen und männlich hervortretendem Kinn, so war Albrecht ein Cary-Grant-Verschnitt, mit langen Wimpern und feinen Gesichtszügen. Ein Typ, dem sowohl Frauen als auch Männer offensichtlich einiges abgewinnen konnten. In einer Kneipe hatte ein Mann ihm sogar einmal eine Rose geschenkt und ihm anschließend einzureden versucht, auch er sei schwul, wisse nur noch nichts von seiner Homosexualität. Er erinnere ihn an einen Hollywood-Schauspieler aus den Fünfzigern.
„Cary Grant?“, hatte Albrecht gefragt.
„Nein, Rock Hudson.“
Ein absurder, aber beunruhigender Gedanke!
Der Mann hinter dem Counter klimperte mit den Augenlidern, schaute komplizenhaft auf den Zettel mit den angekreuzten Filmen, den Albrecht ihm reichte, entblößte beim Lächeln eine Reihe strahlend weißer Zähne und fragte: „Na, was wollen wir denn Hübsches sehen?“
Albrecht hasste dieses Assistenzarzt-Wir: „Hatten wir heute schon Stuhl?“ Seine Mutter hatte den Erste-Person-Plural mit Vorliebe und Hinterlist benutzt: „Da wollen wir jetzt aber nicht hin! Vor dem Essen waschen wir uns die Hände. Haben wir denn schon zum lieben Gott gebetet?“
„Ich wusste gar nicht, dass wir verabredet waren“, knurrte Albrecht, dem die offensichtlich blendende Laune des Mannes wie ein Schlag ins Gesicht vorkam.
Albrechts Missstimmung prallte an dem Gute-Laune-Panzer des Mannes ab. Er hob vielsagend die Augen, als hätte er nichts gegen eine Verabredung einzuwenden, nickte nachsichtig und sagte: „Dann wollen wir mal schauen.“
Eigentlich hatte Albrecht die Absicht gehabt, die Ticket-Menschen auszuhorchen, ob die Polizei mit ihnen geredet, was sie gesagt oder gefragt hätten oder ob ihnen gestern ein Mann mit einem Päckchen für Albrecht aufgefallen sei. Doch nun verwarf er den Gedanken, das Einzige, das dabei herausspringen würde, wäre eine Einladung zum Abendessen.
„Der Thran-Huy-Film soll sehr gut sein“, sagte der Mann, als er Albrecht die Karten reichte, „allerdings etwas blutig und nichts für schwache Nerven.“ Er hob die Augenbrauen und wedelte bedeutungsvoll mit der Hand.
„Dann ist es genau das Richtige“, antwortete Albrecht und steckte die Karten wie Diebesgut in seine Manteltasche. „Heute will ich Blut sehen.“ Er zwang sich zu einem Lächeln, das allerdings eher an das Zähnefletschen eines Mastinos erinnerte, und machte auf dem Absatz kehrt.
Bloß weg hier!
Er lief den Flur entlang und stieß am Fuß der Treppe beinahe mit einer der Rotkarierten zusammen, die dort die Akkreditierungsausweise kontrollierten.
„’tschuldigung“, murmelte Albrecht und hastete an ihr vorbei.
„Nichts passiert“, sagte die Frau und rief ihm hinterher: „Ach, Herr Niemeyer?“
„Ja?“ Albrecht war bereits auf der Treppe und schaute der Frau von unten in die Nasenlöcher. „Was gibt’s?“
„Haben Sie das Päckchen bekommen?“
Albrecht gefror zu Eis.
„Haben Sie?“
Albrecht nickte.
„Dann ist es ja gut.“
„Wer hat es abgegeben?“ Die Frage kam ihm tonlos über die Lippen.
„Der Mann ohne Hals.“
Albrecht verstand nicht.
„Der Penner, der hier immer am Platz herumlungert.“
„Was?“ Er glaubte, sich verhört zu haben, und schrie: „Das ist nicht Ihr Ernst!“
„Natürlich“, antwortete die Frau verunsichert. Albrechts Ausbruch schien ihr unheimlich zu sein, sie machte einen Schritt zurück und setzte eilig hinzu: „Er hat es mir doch persönlich gegeben. Genau an dieser Stelle. Gestern Morgen. Ich hab das Päckchen einem Kollegen von Ihnen mitgegeben, der zum Berlinale-Palast rüberwollte. Er hat versprochen, es bei den Pressefächern abzuliefern.“ Als sie Albrechts verständnisloses Gesicht sah, fragte sie: „Stimmt irgendetwas nicht? Hätte ich das nicht tun sollen? War das Päckchen beschädigt?“
„Nein, nein!“ Er schüttelte verwirrt den Kopf, winkte ab und ging die Treppe hinunter. „Das ergibt nur alles keinen Sinn.“
Als er auf den Marlene-Dietrich-Platz hinaustrat, blendete ihn die tief stehende Sonne, die zwischen den sandfarbenen Bauten des Mercedes-Komplexes hindurchblinzelte. Er schaute auf seine Uhr, es war kurz vor neun. Der Wettbewerbsfilm begann in wenigen Minuten. Und am späten Nachmittag würde die Sendung aufgezeichnet und er eine Kritik dazu abliefern müssen.
„Tacheles“ wurde eigentlich wöchentlich ausgestrahlt, Sendetermin war der Donnerstagabend, pünktlich zum Kinostart. Während der Berlinale jedoch gab es drei wöchentliche Ausstrahlungen (neben dem Donnerstag auch am Dienstag und am Sonnabend), die sich ausschließlich mit den Filmfestspielen beschäftigten. Das Prinzip und der Ablauf von „Tacheles“ waren denkbar einfach. Zunächst zeigten sie die offiziellen Trailer der Filme, die ihnen von den Verleihern zur Verfügung gestellt wurden, fassten währenddessen kurz den Inhalt zusammen, und anschließend sah man Albrecht an einem Stehpult, hinter sich ein Plakat des Films, der seine Meinung zum Besten gab. Hin und wieder wurde ein Interview eingeschoben oder das Bildmaterial gezeigt, das ein Kameramann in den Kinos oder während der Pressekonferenzen gesammelt hatte, aber grundsätzlich bestand das Ganze aus drei Komponenten: einem Mann, einem Plakat, einer Meinung. Der Erfolg der an sich nicht sonderlich originellen Sendung war neben der Schonungslosigkeit und Rigorosität der Kritiken mit einem kleinen, aus drei Buchstaben bestehenden Wort zu begründen: dem Personalpronomen „ich“. Während andere Filmkritiker sich bemühten, möglichst objektiv zu sein und allgemeingültige Regeln aufzustellen, um einen Film als gelungen oder misslungen einzustufen, versteckte Albrecht sich nicht hinter vermeintlicher Objektivität. Er sagte: „Ich weiß nicht, ich kann mit so einem Schwachsinn nichts anfangen.“ Oder: „Das mag ja alles ganz nett sein, aber es interessiert mich einen feuchten Kehricht.“ Dieses ich war sein Markenzeichen, es machte den Unterschied aus. Allerdings setzte es voraus, dass er den Film, den er derart subjektiv bewertete, zuvor gesehen hatte.
Albrecht zögerte einen Moment, stand ratlos da und haderte mit sich. Dann fuhr er plötzlich herum, ließ den Berlinale-Palast rechts liegen und bog linker Hand in die Neue Potsdamer Straße ein. Er würde Martin Brandt anrufen, beschloss er, und ihn um eine Einschätzung des Films bitten. Niemand würde merken, dass das ich, das den Film kritisierte, nicht sein eigenes war. Letztlich waren sie doch alle nur Schauspieler. Und im Moment gab es Wichtigeres zu tun. Darum ging er zu den Arkaden.
Um diese Uhrzeit waren nur wenige Menschen unterwegs, die Einkaufspassage lag noch verschlafen da, nur die unvermeidlichen Zeitungsabo-Vermittler standen vor den Glastüren, rieben sich die vor Kälte roten Hände und hielten Ausschau nach Opfern. Als Albrecht sich zielstrebig einem der Abo-Leute näherte, hellte sich dessen Gesicht auf, und eine Zeitung schnellte Albrecht entgegen.
„Die ‚Berliner Zeitung’?“, fragte der Mann. „Wollen Sie mal probelesen?“
Albrecht winkte ab.
„Vierzehn Tage umsonst“, beharrte der Verkäufer. „Kostet Sie nur ein Lächeln.“
„Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse“, antwortete Albrecht und fragte mit stoischer Miene: „Haben Sie den Mann ohne Hals heute schon gesehen?“
„Wen?“
„Den Obdachlosen, der sich immer hier herumdrückt. Er hat keinen Hals, einen Bart wie Marx und Klamotten wie Catweazle.“
„Die meisten Penner liegen noch drinnen“, sagte der Zeitungsmensch und deutete auf die Glastüren. „Die Wachmänner drücken im Winter manchmal ein Auge zu. Dann liegen die Kerle im Untergeschoss und stinken die Bude voll.“
„Danke!“ Albrecht betrat die Arkaden und fuhr mit der Rolltreppe nach unten. Die Geschäfte und Cafés öffneten gerade, eifrige Angestellte stellten Werbeschilder vor den Eingangstüren auf, fuhren mit Putzlappen über die Stehtische vor den Imbissen oder verscheuchten einzelne bärtige und vor Dreck strotzende Individuen, die sich über den Abluftschächten aufwärmten. Während Albrecht die Obdachlosen musterte und nach dem Mann ohne Hals Ausschau hielt, versuchte er, den Wirrwarr in seinem Kopf zu ordnen und einen klaren, vernünftigen Gedanken zu fassen. Warum sollte ein Penner ihm eine Briefbombe schicken? Und warum sollte dieser selbe Penner anschließend seine eigene Briefbombe öffnen und sich die Hände verbrennen? Vielleicht hat er gesehen, dass der Sprengsatz ungeöffnet in den Abfalleimer gestopft wurde, dachte Albrecht, und der Kerl wollte seine Bombe retten? Ach was, dummes Zeug! Als Albrecht den Briefumschlag weggeworfen hatte, war der Penner gerade damit beschäftigt gewesen, sich von zwei Restaurantangestellten verprügeln zu lassen. Albrecht ärgerte sich, als ihm auffiel, dass er den Mann in Gedanken „Penner“ nannte. Normalerweise achtete er peinlich genau auf seine Ausdrucksweise, nichts hasste er mehr als verbale Niveau- oder Achtlosigkeit. Oft genug hatte Emily sich darüber beschwert, wenn Albrecht sie auf ihre sprachlichen Fehler hingewiesen hatte. Doch er konnte nicht anders, peinliche Anglizismen (die bei Emily entschuldbar waren) oder Ausdrücke wie „zumindestens“, „Sinn machen“ oder „vollstes“ waren ihm ein Gräuel, dann wurde er zum bekehrenden Prediger und Teufelsaustreiber. Und nun stand er im Untergeschoss der Arkaden und nannte den Obdachlosen einen „Penner“.
Ach, zum Henker!
Er fand den Mann vor der Aldi-Filiale. Menger! Plötzlich fiel ihm der Name wieder ein, den Kommissar Schalck genannt hatte. Der Mann hieß Menger. Albrecht baute sich vor ihm auf und starrte ihn sekundenlang reglos an. Der Mann ohne Hals reckte ihm die verbundenen Hände entgegen. Der Verband war bereits völlig verdreckt, als sei er mehrere Wochen alt.
„Jeben Se ’nem armen Terroropfer“, brabbelte Menger und machte eine Miene, als sei er Barabbas, der von Pilatus die Begnadigung erhoffte. „Sehn Se sich meene Hände an! Inne Luft sprengen wollten die mich. Ick kann froh sein, dass ick mittem Leben davonjekommen bin.“ Als er sah, dass Albrecht sich nicht vom Fleck rührte und keine Miene verzog, änderte er seine Taktik und setzte in weniger Mitleid heischendem Ton hinzu: „’n Euro für ’n Bier?“
Albrecht verharrte in seiner Starre und war völlig verwirrt. Der Mann kannte ihn gar nicht, hatte ihn offensichtlich nie zuvor gesehen. Menger hatte keine Ahnung, dass der Empfänger des Briefumschlags, den er gestern im Hyatt abgegeben hatte, vor ihm stand. Merkwürdig.
„Herr Menger?“, fragte Albrecht.
Der Mann fuhr alarmiert zusammen und erwiderte: „Polente?“
Albrecht grinste unmerklich. Den Ausdruck hatte er seit den Achtzigern nicht mehr gehört. Er schüttelte den Kopf und fragte: „Haben Sie Hunger?“
Menger schaute skeptisch drein, zuckte dann mit den Schultern und sagte: „Vor allem Durst!“
„Kommen Sie“, erwiderte Albrecht, „ich lade Sie ein.“ Der Kerl stank wie eine Kloake, Albrecht würgte und hatte Mühe, den Brechreiz zu überwinden.
„Schweinereien mach ick nich“, sagte Menger, als Albrecht ihn am Ellbogen fasste und in die Höhe hievte. „So eener bin ick nich.“
Albrecht wusste nicht, ob er lachen oder sich übergeben sollte, und sagte: „Nur Frühstück. Ich möchte gern mit Ihnen reden. Da vorne ist ein Café!“
„Nee“, sagte Menger, „McDoof!“
Albrecht erinnerte sich an die gestrige Szene vor dem Schnellrestaurant und verstand. „In Ordnung“, sagte er.
Auf der Rolltreppe steckte er die Nase in den Rollkragen seines Pullovers. Der roch noch ein wenig nach seinem Rasierwasser. Mit einem Taschentuch wischte er sich die Hand ab, mit der er den Obdachlosen angefasst hatte. Wie konnte ein Mensch nur derartig stinken?
Als sie das Schnellrestaurant betraten, schaute sich Albrecht um, ob ihn jemand in Begleitung des Halslosen sah. Doch die Kollegen saßen bereits im Berlinale-Palast, und der Marlene-Dietrich-Platz erwachte gerade erst zum Leben. Auch McDonald’s war beinahe leer, nur ein paar Teenager frühstückten, es war noch keine Hamburger-Royal-Zeit. „McMorning“ las Albrecht auf einem Plakat mit der Frühstückskarte. Er schüttelte den Kopf und schlug vor, sich in den hinteren Teil des Obergeschosses zu setzen, doch Menger protestierte.
„Neben den Klos? Kommt jar nich in Frage!“ Er wollte unten und direkt am Fenster sitzen, damit jeder ihn sehen konnte. Vielleicht befürchtete er immer noch, Albrecht könnte irgendwelche Schweinereien im Sinn haben.
Während sie sich unterhielten und Albrecht an seinem Kaffee im Pappbecher nippte, verspeiste Menger ein „Egg McMuffin“ und schüttete sich ein Bier hinter die Binde. Wegen der Verbände an den Händen hatte der Mann Probleme, Essen und Getränke in die gewünschte Richtung zu bekommen. Albrecht bot seine Hilfe an und war froh, dass Menger jede Art der Annäherung ablehnte. Die Angestellten, die beschäftigungslos hinter der Theke standen, bedachten das seltsame Paar mit argwöhnischen Blicken und tuschelten miteinander. Die Jugendlichen am Nachbartisch, offensichtlich durch den Gestank in ihrem lukullischen Vergnügen beeinträchtigt, würgten das Essen hinunter und verließen eilig den Laden.
„Mein Name ist Albrecht Niemeyer“, begann Albrecht und wartete auf eine Reaktion, die nicht erfolgte. „Sagt Ihnen mein Name nichts?“, fragte er und setzte, da Menger den Kopf schüttelte, hinzu: „Sie haben gestern einen Briefumschlag für mich im Hyatt Hotel abgegeben.“
„Wenn Sie det sagen“, meinte Menger und nickte vielsagend.
Albrecht betrachtete ein Stück Eigelb in Mengers verfilztem Rauschebart, der über der Brust angesengt war, und fuhr fort: „In besagtem Umschlag befand sich eine Briefbombe.“
Es dauerte eine gewisse Weile, bis Menger den Sinn dieser Worte verstand. Er starrte Albrecht ungläubig an, schaute dann auf seine bandagierten Hände und murmelte: „Wat ’n? Sie meinen …?“
„Genau.“
„Quatsch!“
„Keineswegs“, sagte Albrecht und erklärte Menger die Zusammenhänge.
„Ick brauch noch ’n Bier“, sagte der Mann, als der andere geendet hatte.
Albrecht holte das Gewünschte, stellte es auf den Tisch, hielt den Pappbecher jedoch umklammert. „Woher stammte der Brief?“, fragte er, als Menger nach dem Bier griff. „Wer hat Ihnen gesagt, Sie sollen den Umschlag im Hotel abgeben?“
„So ’n Kerl!“ Er grinst verschmitzt, nahm das Bier, trank hastig und setzte hinzu: „Er hat mir ’n Heiermann inne Hand gedrückt und jesagt, ick soll det bei die Presse abjeben. Sonst nüscht. War ja ooch nur ’n Heiermann. Konnt ick doch nich wissen.“ Wieder sah er auf seine bandagierten Hände und setzte ungläubig hinzu: „Wat für ’n Arschloch!“
„Wie sah der Mann aus?“
„Wat soll ick sagen?“ Er zuckte mit den Schultern. „Jung.“
„Hatte er zufällig ein Schild auf der Brust?“ Albrecht deutete auf seinen Akkreditiertenausweis. „So eins? War er von der Presse?“
Menger schob die Unterlippe vor und schüttelte den Kopf.
Wäre ja auch zu schön gewesen!
„Und?“, fragte Albrecht. „Sonst erinnern Sie sich an nichts?“
„Der Kerl hatte so ’n Käppi auf ’m Kopp. Wie Nicki Lauda, aber mit Ohren.“ Er lachte krächzend, und Albrecht sah, wie das Eigelb aus dem Bart auf den Tisch fiel. Er war sich nicht ganz sicher, aber es schien so, als bewege sich etwas Schwärzliches auf dem Eigelb. Menger sah Albrechts Blick, sagte: „Oh!“ und stopfte sich das Eigelb samt lebendem Zusatz in den Mund.
„Eine Baseballkappe?“, fragte Albrecht und verzog angeekelt das Gesicht.
Menger nickte. „Und ’n Bart hat er jehabt, so ’n Türkenteil.“
„Einen Schnauzbart?“
„Nee“, er fuhr sich mit der Bandage ans Kinn. „Wie die jungen Türken. Ums Maul rum. Und nur so ’n Strich. Aber ’n Achmed war det nich.“
Ein junger Mann mit Baseballkappe und Rapper-Bärtchen. Irgendwo tief in Albrechts Kopf regte sich etwas, doch es war zu vage, um „klick“ zu machen.
„Hanoi!“
„Was?“ Albrecht fuhr aus seinen Gedanken auf und sah den Mann ohne Hals fragend an. „Ich verstehe nicht.“
„So hat der geredet“, erklärte Menger: „Ha noi wo ischen des.“
„Ein Schwabe?“
Menger nickte.
Näggstes Mal bist du dran! Albrecht sprang auf. Das Klicken war sehr laut gewesen. Zwei Bilder hatten sich in seinem Hirn zusammengesetzt, zwei Situationen, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Und plötzlich wusste er, verstand er. Der Mann mit dem Rapper-Bärtchen und der Baseballkappe. Er hatte ihn gestern Morgen an der Imbissbude gesehen, bei seinem vergeblichen Versuch, einen Fleischspieß zu bestellen. Der Mann hatte ihn so seltsam angeschaut, und Albrecht hatte gedacht, der Typ kenne ihn aus dem Fernsehen. Das zweite Bild war älter, zwei Wochen alt, und er hatte Mühe, es wieder aufzurufen, denn an diesem Abend hatte er an anderes gedacht, anderes gemacht. Doch nun erinnerte er sich an einen Gast mit Rapper-Bärtchen und Schwabenakzent. Ein Abendessen mit Folgen: einer Scheidung und einer Briefbombe. Nicht schlecht!
„Danke!“, sagte Albrecht, hielt dem Halslosen einen 20-Euro-Schein hin, den dieser trotz Verband behände ergriff, und verließ das Schnellrestaurant.
„Da nich für“, rief ihm der Obdachlose hinterher.
–
5
Das „Peru“ war eines dieser neuen, schicken, überteuerten und fürchterlich angesagten Cafés oder Restaurants in Berlin-Mitte. Albrecht hasste es. Nicht weil es schick und überteuert, sondern weil es im Osten war. Er hatte nichts gegen unverschämte Preise, die zumeist atemberaubender waren als die Speisen und Getränke, die man serviert bekam, solange diese Preise das gemeine Fußvolk fernhielten und einen vor aufdringlichen Blicken schützten. Aber wenn er für viel Geld wenig Leistung bekommen wollte, dann ging er in die „Paris Bar“ in der Kantstraße oder ins „Einstein“ in der Kurfürstenstraße. Er blieb in West-Berlin. Aus Prinzip. In Mitte fühlte er sich unwohl, inmitten der geschmacklos gekleideten und laut plappernden IT-Manager, geräuschvoll auf Handys und Laptops herumhackenden Medienleute oder sich künstlerisch gebenden Möchtegern-Bonvivants, die selbst beim Essen ihren Schlapphut nicht abnahmen und Albrecht an die Bauern in Westfalen erinnerten, denen der Cordhut ebenfalls wie am Schädel festgewachsen schien. Berlin-Mitte war zum Kotzen. Das „Peru“ war Mitte pur. Emily hatte es ausgesucht. Vermutlich war auch das auf Felgenhauers Mist gewachsen.
Es war der letzte Tag im Januar, draußen stürmte es, der Regen peitschte gegen die riesigen Fenster, Passanten unter Schirmen hasteten vorbei, eine „B.Z.“ lag klitschnass auf dem löchrigen Kopfsteinpflaster. Albrecht betrachtete das deprimierende Panorama der dämmrig beleuchteten Straße, um sich von dem noch deprimierenderen Bild im halogenbestrahlten Inneren des Restaurants abzulenken. Sie saßen an einem Ecktisch in einer riesigen Halle, die an einen Bahnhof oder Flughafen erinnerte. Auch wegen der Akustik. Wie in einer Schulaula. Jedes Wort hallte dreimal nach und verlor sich unter den sechs Meter hohen Decken. Da der Laden gerammelt voll war und am Tresen bereits Leute auf frei werdende Tische warteten, war kaum zu unterscheiden, ob man das eigene Echo oder das der anderen Gäste vernahm. Albrecht schloss innerlich die Ohren, um nicht auf Felgenhauers Geschwätz oder auf die Stimme in seinem Kopf zu hören, die ihm sagte, er solle diesen Ort verlassen. Auf der Stelle. Fluchtartig.
„He, Albrecht, was möchtest du?“
Er schrak hoch und sah Emilys fragende Miene. Sie deutete mit den Augen auf eine Bedienung, die am Tisch stand und auf die Bestellung wartete. Die Frau war groß gewachsen, dunkelblond und hatte riesige Augen in einem bleichen, rundlichen Gesicht, wie Heidi in der japanischen Trickfilmserie. Die weiße Schürze, die ihr bis auf den Boden reichte, sah aus wie ein zweimal um den Körper gewickeltes Bettlaken.
„Kaffee im Glas“, sagte Albrecht und starrte wieder aus dem Fenster.