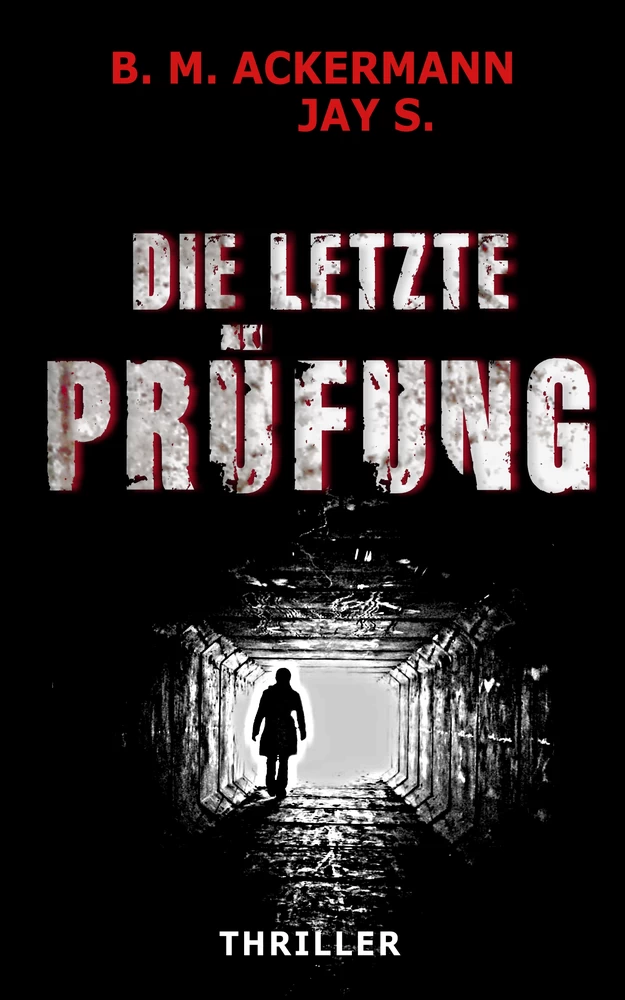Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die letzte Prüfung
von
B. M. Ackermann & Jay S.
Thriller
1
Es wurde still, trügerisch still.
Wo zuvor gedämpfte Schreie und Kampfgeräusche die Nacht erfüllt hatten, herrschte jetzt nur noch Stille. Bis das Quietschen schlecht geölter Scharniere sie wieder durchschnitt.
Lena erstarrte. Doch sie musste fliehen, und zwar schnell, aber ihre Füße schienen in dem vom Regen aufgeweichten Waldboden immer weiter zu versinken. Die zwei hell erleuchteten Fenster im oberen Stockwerk des Hauses starrten sie aus der Finsternis heraus an wie die Augen eines bösartigen Gespensts. In der Mitte darunter stand ein senkrechter Strahl Licht, zwei Gestalten traten hindurch.
Sie kommen!
Lena strich die nassen Haare aus ihrem Gesicht, spannte die Muskeln und schaffte es tatsächlich, sich in Bewegung zu setzen. Sie rannte los, weg von dem Haus, und kämpfte gegen die Versuchung an, zurückzublicken.
Nur weg!
Hinter ihr heulte ein Motor auf, gleich darauf erklang das platschende Geräusch von Reifen auf dem verregneten Asphalt. Panik ergriff sie, die sie dazu zwang, schneller zu rennen. Sie wusste, irgendwo da vorne war eine Art Treppe, die an den teils steilen Stufen eines Bergbachs entlangführte. Dieser Fluchtweg war ihre einzige Chance.
Sie riskierte einen kurzen Blick über die Schulter und sah, wie zwei Lichtkegel die Dunkelheit zerschnitten.
Schneller!
Sie rannte, als wäre der leibhaftige Teufel hinter ihr her, und verpasste prompt die rettende Treppe. Abrupt blieb sie stehen, drehte sich um und lief zurück. Jetzt kamen ihr die Scheinwerfer entgegen. Sie waren nicht allzu weit entfernt, aber nicht nahe genug, um Lena erfassen zu können. Sie bog ab und hastete die steilen Stufen hinunter. Beinahe euphorisch klammerte sie sich an den winzigen Funken Hoffnung, es tatsächlich zu schaffen und dieser Hölle zu entkommen.
Ihre Schritte wurden immer schneller und schneller. Zu schnell. Sie konnte ihre Beine nicht mehr kontrollieren, der Abstieg war viel zu steil und die Steinplatten von Regen und Schlamm überschwemmt. Lena geriet ins Rutschen und bekam gerade so das hölzerne Geländer am Wegesrand zu fassen, ehe sie endgültig den Halt verlor. Hastig rappelte sie sich auf und viele Stufen und Atemzüge später erreichte sie die halb zerfallene Mühle oberhalb des Dorfes. Hier könnte sie sich verstecken und abwarten, bis die Luft rein wäre. Oder, und der Gedanke gefiel ihr noch besser, sie könnte ins Dorf laufen und dort Hilfe suchen.
Der Ort lag nahezu im Dunkeln. Wenige Straßenlampen warfen helle Flecken auf den Asphalt. Die Häuser dahinter schienen sich zu ducken, als wollten sie verhindern, von Lena entdeckt zu werden. Nur hinter dem schmutzigen Fenster eines kleinen Hauses an der nächsten Straßenecke brannte Licht. Sie ging darauf zu und stellte fest, dass es sich um ein Gasthaus handelte. Oder eher um eine heruntergekommene Spelunke.
Die Bilder von vorhin kamen ihr wieder in den Sinn, und ein eiskalter Schauer rieselte über ihren Rücken. Zum Glück verblasste die Szene sofort, als die Tür der Kneipe aufging und zwei torkelnde Gestalten in die Nacht entließ. Sie lallten und lachten, verstummten jedoch sofort, sobald sie Lena bemerkt hatten. Einer der Männer grinste mit einem verklärten Blick, der andere legte die Stirn in tiefe Falten. Im Türrahmen der Kneipe stand ein dritter Mann, bärtig und sicherlich noch älter als die beiden Betrunkenen. Er warf Lena einen angewiderten Blick zu, zögerte einen Moment, doch dann zog er sich ins Innere des Wirtshauses zurück und schloss die Tür. Von ihm brauchte sie keine Hilfe zu erwarten. Auch nicht von den beiden anderen Männern, die bereits ihren Weg die Straße entlang fortgesetzt hatten, laut singend und lachend.
Lena hörte einen Motor, der lauter wurde, und setzte sich wieder in Bewegung. Mit heftig pochendem Herzen rannte sie ein Stück die Hauptstraße entlang und bog dann in eine schmale Gasse ein. Nachdem sie deren Ende erreicht hatte, entdeckte sie den Kirchturm mit dem Kreuz darauf, der keine dreißig Meter von ihr entfernt in den Himmel ragte.
Das konnte kein Zufall sein, dass sie ausgerechnet hier gelandet war. Warum war sie nicht gleich darauf gekommen? Der Pfarrer würde ihr möglicherweise helfen. Wenn nicht er, wer dann?
Sie lauschte in die Dunkelheit. Kein Motor zu hören. Stattdessen herrschte eine beinahe greifbare Stille. Die Luft war so feucht und kalt, dass Lena ihren eigenen Atem sehen konnte, der sich in der Kälte zu weißen Wölkchen materialisierte, um sich sofort wieder in Luft aufzulösen. Ihr Blick fiel wieder auf den Kirchturm, dann fasste sie sich ein Herz und marschierte zielstrebig auf das Pfarrhaus zu, das direkt neben der Kirche stand.
Obwohl im Haus kein einziges Licht brannte, betätigte sie die Klingel und wartete. Nichts. Sie läutete ein weiteres Mal, dann noch einmal, aber erst nach dem fünften Klingeln sah sie durch ein kleines Fenster neben dem Eingang, wie im Inneren des Hauses Licht anging. Kurz darauf wurde die Tür gerade soweit geöffnet, dass Lena die rechte Hälfte eines runden Gesichts sehen konnte. Trotzdem erkannte sie Pfarrer Warth sofort. Sie hatte schon öfter seine Gottesdienste besucht.
»Ja bitte?«, fragte er und musterte Lenas Gesicht ganz genau. Dann schien er beschlossen zu haben, dass von ihr keine Gefahr ausging, und machte die Tür ganz auf. »Junge Dame, was ist denn passiert? Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Er klang ernsthaft besorgt.
»Ja. Im Heim, diese Leute, sie ...«, stammelte sie herum und hasste sich dafür, dass sie es ausgerechnet jetzt nicht schaffte, einen ganzen Satz herauszubringen.
»Sie sind von dem Heim dort oben«?«, hakte der Pfarrer nach und runzelte die Stirn. »Ist dort etwas vorgefallen?«
Wieder sah sie die furchtbaren Bilder vor sich, riss sich dann aber zusammen und versuchte, ihre Gedanken in sinnvolle Worte zu packen. »Kevin ist ... weg. Er wurde verschleppt.«
Der Pfarrer sah sie zunächst etwas verstört an, doch dann schlich sich etwas wie Verständnis in seinen Blick. »Jemand wurde entführt und sein Name ist Kevin?«
Sie nickte. »Ja. Bitte ... Sie müssen mir helfen. Und ihm.«
Pfarrer Warth streckte die Hand nach Lena aus. »Soll ich die Polizei anrufen?«
Lena dachte darüber nach, war sich aber nicht sicher, ob das gut war. Und es war ohnehin zu spät, überhaupt irgendwas für sie zu tun. Das wurde ihr bewusst, als sie das Dröhnen eines Motors hörte. Entsetzt blickte sie über ihre Schulter und sah zwei Scheinwerfer, die um die Ecke bogen und sich dem Pfarrhaus näherten.
»Oh nein, sie haben mich gefunden«, sagte sie leise. »Sie kommen, um mich zu holen.«
»Wer?«, fragte der Pfarrer.
»Die vom Heim.«
»Und was haben die jetzt vor?«
»Die wollen mich zum Schweigen bringen. Bitte, helfen sie mir!«, flehte sie ihn an und glaubte, in seinem Blick von Herzen kommendes Mitgefühl zu erkennen. Doch wie sollte er ihr jetzt noch helfen?
Der Pfarrer machte einen Schritt zurück ins Haus und Lena dachte schon, dass er ihr gleich die Tür vor der Nase zuknallen und sie ihrem Schicksal überlassen würde. Doch das tat er nicht. Stattdessen zog er die Tür ganz auf und sagte: »Schnell ins Haus mit Ihnen.«
Lena zögerte keinen Augenblick und trat an dem Pfarrer vorbei ins Hausinnere. Er führte sie durch einen langen, schmalen Flur in die Küche, wo es nach angebrannten Zwiebeln roch. An der Wand flackerte in einem Glas eine einsame Kerze, die ein Bild der heiligen Maria beleuchtete.
»Möchten Sie sich setzen?«, fragte der Pfarrer.
Lena schüttelte den Kopf.
»Wie wäre es, wenn Sie mir erst einmal Ihren Namen verraten?«
»Lena, mein Name ist Lena ... Lena Wieland. Bitte, Sie müssen mir helfen, Kevin zu finden, es könnte jeden Moment ...«, begann sie, doch ihre Stimme versagte, bevor sie den Satz beenden konnte.
»Ja, Lena, das versuche ich, aber ...«
Das laute Surren der Türklingel brachte ihn zum Schweigen. Jetzt war er es, der entsetzt dreinblickte, während er Lena zuflüsterte, sie solle sich ruhig verhalten, solange er nachsehe, wer da an der Tür sei.
Doch das wusste Lena bereits, brachte aber kein Wort mehr heraus. Sie setzte sich auf den Boden, kauerte sich zusammen und versuchte, so leise wie nur möglich zu atmen, damit sie hören konnte, was an der Haustür vor sich ging. Zunächst waren da nur die Schritte, dann das Öffnen der Tür und zuletzt die Stimme des Pfarrers.
»Herr von Hohberg, was für eine Überraschung«, sagte er. »Was führt Sie mitten in der Nacht zu mir?«
»Ich suche einen meiner Schützlinge, und ich glaube, dieser ist vor zwei Minuten in ihr Haus eingedrungen«, antwortete Christian von Hohberg, den Lena sofort an der eindringlichen Stimme erkannte. Er war der Leiter des Heims. »Eine junge Frau. Ich bin für sie verantwortlich und werde sie jetzt mitnehmen.«
»Sie wirkt ein wenig erschrocken«, sagte Pfarrer Warth. »Ist irgendetwas passiert dort oben?«
»Nein, Herr Pfarrer, es ist nichts passiert. Also?«
Schweigen breitete sich aus, und Lena wurde bewusst, dass der Pfarrer ihr letztendlich doch nicht helfen konnte, egal, ob er wollte oder nicht.
Sie hörte Schritte, die näher kamen und neben ihr verstummten. Ihr Herz begann zu rasen, sie schaffte es nicht mehr, ruhig zu atmen. Vielmehr fiel es ihr von Sekunde zu Sekunde schwerer, überhaupt noch Luft zu bekommen.
»Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen kann. Sie wirkt sehr verstört«, setzte der Pfarrer zu einem letzten Hilfeversuch an.
»Machen Sie sich keine Gedanken, Herr Pfarrer, Lena ist immer verstört, aber sie ist bei uns in guten Händen. Nicht wahr, Lena?«
Lena resignierte, es war vorbei. Langsam stand sie auf, stolperte dem Heimleiter entgegen und ließ sich von ihm zur Tür führen. Dort nahm sie einer der Betreuer aus dem Heim in Empfang.
»Vielen Dank für Ihre Kooperation«, sagte Christian von Hohberg zum Pfarrer. »Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.«
Lena nahm auf der Rückbank des Wagens Platz und ihr wurde endgültig bewusst, dass sie ihrem Albtraum nicht entrinnen konnte.
Der Mercedes wendete am Pfarrhaus, und sie sah, dass Pfarrer Warth ihr zunickte. Und wenn sie sich nicht getäuscht hatte, war ein aufmunterndes Lächeln über seine Lippen gehuscht.
2
Tragisches Ende einer Abhängigkeit
Am vergangenen Samstagmorgen wurde in einem Hinterhof in der Nähe der Marienkirche der leblose Körper eines jungen Mannes entdeckt. Polizeiberichten zufolge wurden bei seiner Leiche keinerlei Ausweise oder sonstige Hinweise auf seine Identität gefunden. Zahlreiche äußerliche Merkmale deuten auf eine exzessive Drogenabhängigkeit hin. Bisher wurde keine Vermisstenanzeige erstattet, die auf sein Profil zutrifft. Die Kriminalpolizei geht aufgrund der bisherigen Erkenntnisse davon aus, dass der Tod auf eine Überdosis der verheerenden Kultdroge Crystal Meth zurückzuführen ist. Die Polizei Stuttgart ruft Zeugen oder Personen mit Hinweisen dazu auf, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.
Lukas Schwartz wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und blickte von dem eineinhalb Jahre alten Zeitungsartikel auf die beiden Kerzen, die vor seinem Wohnzimmerfenster heftig zu flackern begonnen hatten, sich aber kurz darauf wieder beruhigten. Er hatte diese Kerzen für seine verstorbenen Eltern angezündet und fragte sich jetzt, ob er nicht doch eine dritte Kerze dazustellen sollte. Für Valentin, seinen drogensüchtigen Bruder, der vielleicht, genau wie der unbekannte Junkie aus dem Zeitungsbericht, nicht mehr am Leben war.
Seit achtzehn Monaten hoffte Lukas auf ein Lebenszeichen seines kleinen Bruders, erhielt aber keins. Kein Wunder, ihre Wege hatten sich nach einem heftigen Streit getrennt. Seitdem sammelte er Zeitungsberichte über Drogentote, verfolgte jede Spur, die ihn zu Valentin führen könnte, und ständig rechnete er damit, seinen Bruder in einer Leichenhalle oder tot in der Gosse wiederzufinden. Todesursache: der goldene Schuss.
Mittlerweile zählte er über dreißig kürzere und längere Berichte, aber nicht jeder Todesfall, der auf Drogen zurückzuführen war, schaffte es in die Zeitung. Alleine in Baden-Württemberg waren im vergangenen Jahr über einhundertzwanzig Menschen wegen Drogenkonsums verstorben. Tendenz steigend. Von den dreißig, über die berichtet worden war, hatte Lukas die Namen herausfinden und den Artikeln zuordnen können.
Er ging davon aus, dass sein Bruder keinen Platz in der Statistik der über hundert Drogentoten gefunden hatte, aber mit Sicherheit sagen konnte er es nicht. Erneut dachte er darüber nach, eine Kerze für Valentin zu entzünden, ließ es dann aber sein, weil er die Flamme der Hoffnung, die er in sich trug, nicht erlöschen lassen wollte.
Er blätterte in seinem Ordner, in dem er wichtige oder selbst verfasste Artikel aufbewahrte, ein paar Seiten zurück und stieß auf eine weitere Schlagzeile, die ihn daran erinnerte, dass das Schicksal mitunter äußerst brutal zuschlagen kann.
Ehepaar schlittert in den Tod
Den Rest des Artikels brauchte Lukas nicht zu lesen, er kannte ihn auswendig.
Vor zwölf Jahren, in der Nacht des ersten Novembers, waren seine Eltern in ihrem Porsche tödlich verunglückt. Sie hinterließen zwei Söhne, der eine achtzehn, der andere vierzehn Jahre alt. Ihr Wagen hatte auf der regennassen Fahrbahn in einer Kurve die Bodenhaftung verloren, das Geländer einer Autobahnbrücke durchbrochen und war zwanzig Meter in die Tiefe gestürzt. Von seinen Eltern war nicht viel übrig geblieben, und die letzte Erinnerung, die Lukas an sie hatte, waren ihre toten, vom Unfall gezeichneten Gesichter, als er sie im Leichenschauhaus identifizierte.
Beim Gedanken daran begann Lukas zu frösteln. Aber vielleicht lag es auch nur an der kalten Luft, die durch das Kippfenster hinter ihm hereinströmte und ihm in den Nacken zog. Er stand auf und schloss das Fenster. Anschließend nahm er das leere Weinglas vom Wohnzimmertisch und ging leicht schwankend in die Küche, um es wieder aufzufüllen.
Doch bevor er dazu kam, die zweite Weinflasche dieses Abends zu öffnen, spürte er ein Vibrieren in seiner Hosentasche. Er zog sein Handy heraus und meldete sich.
»Lukas Schwartz.«
»Hallo, Lukas, hier spricht Pfarrer Hannes Warth. Weißt du noch, wer ich bin?«, kam eine Stimme aus dem Hörer, an die Lukas sich sehr wohl erinnerte. Allerdings war er derart überrascht, dass er vollkommen vergaß zu antworten.
»Hörst du mich, Lukas?«, fragte der Pfarrer.
»Ja, ich höre dich sehr gut, Hannes. Was willst du?« Er bemerkte, dass er ein wenig lallte. Vermutlich wäre es doch besser gewesen, die Flasche Rotwein nicht auf einmal leer zu trinken. Er schüttelte den Kopf, um ihn einigermaßen freizubekommen.
»Ähm, ist alles in Ordnung mit dir? Störe ich gerade?«
»Nein, nein, alles bestens«, erwiderte Lukas. »Ich bin nur etwas, na ja, verwundert, dass du mich anrufst. Ich habe lange nichts von dir gehört.«
»Das stimmt, ungefähr eineinhalb Jahre?«
Seit ich ihm ein paar echt üble Dinge an den Kopf geworfen habe, dachte Lukas und sagte: »Ja, das könnte hinkommen. Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht erwartet, jemals wieder von dir zu hören.«
»Ich habe es mir auch gut überlegt, ob ich dich anrufen soll, und bin zu dem Schluss gekommen, dass unsere Freundschaft nicht länger unter diesem überflüssigen Streit leiden sollte«, sagte Hannes. »Wollen wir Frieden schließen?«
Darüber brauchte Lukas nicht lange nachzudenken. Er hatte schon zu viele wertvolle Menschen verloren, dieses Friedensangebot konnte er unmöglich zurückweisen.
»Ja, das ist eine gute Idee, Hannes. Es tut mir leid, was ich alles zu dir gesagt habe. Du wolltest ja nur helfen, nachdem ich mich mit Valentin zerstritten hatte. Und ja, ich weiß mittlerweile auch, dass ich vieles falsch gemacht habe.«
Er fragte sich, warum er das plötzlich einfach so zugeben konnte, aber dann fiel sein Blick auf die leere Weinflasche. Die erklärte alles.
»Nur leider bringt mir das meinen Bruder nicht zurück«, fügte er hinzu.
»Dann hast du in letzter Zeit also nichts von Valentin gehört?«
»Nein, leider nicht. Du vielleicht?«
»Nein, aber wegen Valentin rufe ich auch gar nicht an.«
»Okay, worum geht es dann?«
»Na ja, wo soll ich anfangen. Die Sache ist in der Tat ein bisschen seltsam«, stammelte der Pfarrer herum.
Lukas bemerkte, wie ihm schwindelig wurde. Rasch setzte er sich auf die Couch im Wohnzimmer und wartete, ob Hannes noch etwas hinzufügen würde. Weil er das nicht tat, forderte er ihn dazu auf, deutlicher zu werden.
»Du hast mir mal gesagt, dass du an merkwürdigen Geschichten interessiert bist«, sagte Hannes.
Das stimmte. Er hatte in seiner Laufbahn als Journalist schon so manche Dinge ans Licht gebracht, die im Verborgenen hätten bleiben sollen. An so etwas hatte er immer Interesse, zumal er seit Monaten in seinem Job auf der Stelle trat.
»Und du hättest da so eine Geschichte für mich?«, fragte er.
»Ja, möglicherweise hätte ich da etwas. Es ist tatsächlich ein wenig seltsam und auch persönlich, weil es um dieses Reintegrationsheim geht, über das du dich vor zwei Jahren erkundigt hattest.«
Lukas erinnerte sich an das Heim für ehemalige Drogensüchtige, das im südlichen Schwarzwald oberhalb jenes Dorfes lag, in dem Hannes Warth sein Amt als katholischer Pfarrer ausübte. Eine sehr spärlich besiedelte Gegend, wo es kaum etwas gab, außer Bäumen, Hügel und überall verstreute Holzhütten. Vor zwei Jahren war Lukas dort gewesen, um sich dieses Heim genauer anzuschauen, weil er darüber nachgedacht hatte, seinen Bruder dort einweisen zu lassen. Bei der Gelegenheit hatte er Pfarrer Hannes Warth kennengelernt, der sich für diese Einrichtung positiv ausgesprochen hatte. Aus der Bekanntschaft war so etwas wie Freundschaft geworden.
»Und was ist mit dem Heim?«, fragte Lukas.
»Ich weiß nicht so recht, aber ich denke, irgendetwas stimmt da nicht. Letzte Nacht stand plötzlich eine junge Frau vor meiner Tür«, antwortete Hannes. »Zuerst dachte ich ja, das ist eben so eine, die leicht durcheinandergeraten ist. Du weißt schon, wegen der Drogen. Aber irgendwas war da in ihrem Blick, das mir zu denken gab. Na, wie auch immer. Sie stand im strömenden Regen, mitten in der Nacht vor meiner Tür und bat mich um Hilfe.« Er machte eine kurze Pause, vielleicht, um sich zu sammeln. Dann fuhr er fort. »Sie sagte, Kevin sei verschleppt worden. Wahrscheinlich ihr Freund oder so etwas. Ich wollte ihr helfen, aber dann haben die Leute vom Heim sie aufgegriffen und mitgenommen. Heute früh habe ich mich nach ihr erkundigt. Der Heimleiter persönlich hat mir versichert, dass so eine Ruhestörung in Zukunft nicht mehr vorkäme. Und der jungen Frau gehe es bestens. Sie sei jetzt wieder unter Kontrolle. Sie heißt übrigens Lena. Lena Wieland.«
»Okay. Lena hat also behauptet, ihr Freund sei entführt worden?«
»Ja genau.«
»Und warum hast du die Polizei nicht verständigt?«
»Habe ich mir auch überlegt«, sagte Hannes. »Aber was, wenn ich die junge Dame damit in noch größere Schwierigkeiten bringe? Sie hätte auch direkt zur Polizei laufen können. Aber nein, sie hat an meine Tür geklopft. Oder besser gesagt, sie hat mich aus dem Schlaf geklingelt. Außerdem ist da noch dieser Unfall, um den sich die Polizei nicht wirklich gekümmert hat. Im Grunde kümmert sich kein Mensch um dieses Heim.«
»Moment, mal. Du hast von einem Unfall geredet?« Lukas’ Neugier wuchs. »Was genau ist dort passiert?«
»Vor ungefähr vier Wochen wurde ein junger Mann aus einem Gebirgsbach gefischt. Er war tot.«
»Und er war aus dem Heim? Ein Junkie?«
»Wenn du ihn unbedingt so nennen musst.« Hannes seufzte tief. »Es hieß, er sei davongelaufen und in eine tiefe Schlucht gestürzt.«
Lukas schwankte zwischen Interesse und Ablehnung und dachte darüber nach. Ein Toter und eine Entführung. Nun, jedenfalls eine vermeintliche Entführung. Möglicherweise hatte diese Lena zuvor Drogen konsumiert. Doch kaum hatte er den Gedanken zu Ende gebracht, schämte er sich schon dafür. Genau wegen solcher Vorurteile war die Beziehung zu seinem Bruder zerbrochen.
»Lukas?«, fragte Hannes.
»Ja?«
»Was hältst du von der Sache?«
»Hört sich nicht uninteressant an. Aber wie stellst du dir das vor, wie ich in dieses Heim reinkomme, um mich dort ein wenig umsehen zu können?«
»Ich kenne einen Psychologen, er ist ein alter Freund von mir. Der könnte dich schnell dort unterbringen. Wenn ich ihm sage, dass du ganz dringend in dem Heim dort einen Platz brauchst, erledigt er das für mich. Du müsstest nur kurz mit ihm reden und ihm glaubhaft machen, dass du den Platz unbedingt brauchst.«
Lukas unterdrückte ein Seufzen. Wie sollte er einem Psychologen weiß machen, dass er ein Drogenproblem hatte. Ausgerechnet er, der nichts mehr verabscheute als Drogen.
»Also ich weiß nicht so recht«, sagte er unentschlossen.
»Du musst dich ja nicht sofort entscheiden«, erwiderte Hannes. »Du kannst gerne eine Nacht drüber schlafen und mir dann Bescheid geben. Aber mehr Zeit haben wir nicht, fürchte ich.«
Lukas dachte über den Vorschlag nach, was ihm mit dem Alkohol im Kopf schwerfiel. »Ja, ich melde mich morgen.«
»Gut. Bis dann.«
Hannes Warth legte auf und ließ Lukas mit einem Gefühl zurück, das er schon eine Weile nicht mehr verspürt hatte. Da war dieses Kribbeln in seinem Bauch, diese leichte Erregung, die ihn immer dann befiel, wenn er eine gute Story witterte. Allerdings wusste er noch nicht, ob er sich tatsächlich darauf einlassen sollte.
3
Sie saßen nebeneinander auf der Holzbank am Waldrand und lauschten dem Rauschen der Blätter in den Baumkronen über ihnen.
Seit Lena ihm nähergekommen war, hatte sie wieder so etwas wie Hoffnung verspürt. Eines Tages würden sie beide es geschafft haben und von hier verschwinden können. Vielleicht würden sie in ein paar Jahren sogar zusammen Kinder haben. Niemand müsste wissen, was für eine Vergangenheit sie beide hatten, doch sobald ihre Kinder alt genug wären, könnten sie sie davon abhalten, denselben Fehler zu begehen.
Die Strahlen der Herbstsonne erwärmten ihre Haut, Kevins Hand lag sanft auf ihrer Schulter, was ihr trotz der unmittelbaren Nähe zu diesem Ort, an dem sie nichts durfte, außer sich dieser militärhaften Struktur zu fügen, ein Gefühl der Geborgenheit schenkte.
»Komm, lass uns ein wenig spazieren gehen, in Ordnung?«, fragte Kevin.
Lena blickte in seine dunkelblauen Augen, die so sehr leuchteten, dass sie beinahe unecht wirkten. Einige Strähnen seiner lockigen, blonden Haare fielen ihm in die Stirn. Das Gefühl, das sie empfand, war tief, ja, es musste Liebe sein.
»Was ist? Wollen wir?«, hakte Kevin lächelnd nach.
Lena nickte, ließ sich von seiner Hand führen und folgte ihm über die grüne, verwilderte Wiese neben dem Wald. Sie lächelte. Sie war glücklich. Unendlich glücklich. Bis zu dem Moment, in dem sie plötzlich realisierte, dass er ihre Hand losgelassen hatte. Sie blickte um sich.
»Kevin? Kevin!«
Panik breitete sich in ihr aus.
»Kevin!! Das ist nicht witzig!«
Lena blieb stehen, starrte auf die Holzbank, auf der sie eben noch gesessen hatten. Das Rascheln der Blätter war verstummt, das Licht der Herbstsonne verschwand, um sie herum wurde es mit jeder Sekunde dunkler.
Ein Vibrieren unter ihren Füßen ließ sie zusammenschrecken und kurz darauf losrennen. Die Wiese war bereits in Dunkelheit getaucht, sie erkannte nichts mehr um sich herum, rannte immer schneller, ihre Lunge begann zu schmerzen, das Atmen fiel ihr immer schwerer.
Plötzlich verwandelte sich die Vibration unter ihren Füßen zu einem lauten Beben, der Boden fiel auseinander, Stück für Stück. Lena ruderte mit den Armen, suchte verzweifelt nach Halt, nach irgendetwas, was sie vor dem Sturz retten konnte. Im nächsten Moment spürte sie etwas Hartes an ihrem Hinterkopf. Sie öffnete die Augen, doch noch immer war alles dunkel um sie herum. Bis auf eine kleine Stelle am anderen Ende des ... war es ein Zimmer? Ein Haus?
Es roch nach abgestandenem Schweiß, die Luft war warm und dick, sie musste durch den Mund atmen, um den Geruch zu ertragen. Mit letzter Kraft kämpfte sie sich auf die Beine.
Dieses Licht, oder eher dieses Flackern, wie von einer jeden Moment erlöschenden Kerze, zog sie magisch an, und sie ging hinüber zu der Ecke des Raumes, aus dem es kam. Sie kniete sich neben das, was von der einst riesigen, blutroten Kerze übrig geblieben war, und betrachtete die schwache Flamme, als wäre sie ein äußerst seltenes Tier, das sie so eben entdeckt hatte. Sie verstand nicht, weshalb dieses flackernde Licht sie derart in seinen Bann zog.
»Le ...«
Lena zuckte zusammen. Wessen Stimme war das? Und wieso klang sie so beängstigend nah?
»Lena ...«, hörte sie die Stimme nun deutlicher. Und erkannte sie.
»Kevin! Sag mir, wo du bist, ich hole dich da raus!«
In diesem Moment erlosch das Licht der Kerze endgültig, und Lena erkannte ihre eigene Hand vor dem Gesicht nicht mehr.
»Kevin! Sag doch etwas!«
Stille. Kein Ton, nichts. Als wäre die Stimme nie da gewesen.
Lena tastete sich auf allen vieren über den Holzboden, bis plötzlich etwas Spitziges sich in ihre Handfläche bohrte und sie aufschreien ließ. Mit der anderen Hand griff sie nach dem Gegenstand, von dem sie zunächst sicher gewesen war, dass es nur ein fieser, langer Holzsplitter gewesen sein konnte. Sie spürte, wie warmes Blut aus ihrer Handfläche floss, während sie den Splitter mit einem Ruck herauszog und begriff, was es wirklich war.
Eine Spritze.
Was machte eine verfluchte Spritze an diesem Ort, und wo war sie hier überhaupt? Und wo war Kevin? Verzweifelt schrie sie immer und immer wieder seinen Namen, spürte eine Träne der Verzweiflung über ihr Gesicht rollen.
Plötzlich ließ sie ein fester Druck um ihre Hand neue Hoffnung schöpfen.
»Kevin? Bist du es?«
Der Druck an ihrer Hand wurde fester. Lena öffnete die Augen und blickte in das Gesicht einer Frau. Dr. Schenker? Ja, es war Dr. Schenker. Sie lächelte sanft und tupfte mit einem kalten, feuchten Tuch über Lenas verschwitzte Stirn.
»Alles ist gut, Lena. Es war nur ein böser Traum.«
Lena blickte sich um. Sie lag im Büro des Heims auf dem Bett, das mehr einer Pritsche glich und nur für Notfälle gedacht war. Zum Beispiel, wenn jemand besondere Aufsicht benötigte. Warum war sie in diesem Zimmer? Und wann hatte der Albtraum überhaupt begonnen? Wo war Kevin?
»Wo ist Kevin?«, fragte Lena die Psychiaterin mit skeptischem Blick.
Wieder lächelte Dr. Schenker. »Wie wäre es, wenn du kurz duschen gehst und dann nach unten kommst? In fünfzehn Minuten treffen sich alle am großen Tisch. Es gibt tolle Neuigkeiten für die Gemeinschaft.«
Lena starrte Dr. Schenker an und grübelte. Das letzte Mal, als sie sich so verwirrt gefühlt hatte, war, als sie vor Jahren morgens an einen Geldautomaten gelehnt erwacht war. Sie hatte sich nicht mehr im Entferntesten an etwas erinnern können, was sie in jener Nacht erlebt hatte, doch irgendwann schien ihr Körper resigniert zu haben.
Resignation. Nichts anderes war es, das Lena schließlich dazu bewog, Dr. Schenker zu gehorchen und aufzustehen.
Ein böser Traum ...
So musste es sich anfühlen, wenn man neunzig Jahre alt war und nach einer Nacht im Krankenhaus oder Altersheim, in der man mit unzähligen Schlaf- und Schmerzmitteln vollgepumpt worden war, morgens aufstehen musste, dachte Lena bitter und verließ hinter der Ärztin das Büro.
***
Erst als es zum dritten Mal energisch an der Tür klopfte, zwang sich Lena, das warme Wasser auszuschalten, sich abzutrocknen und diese verwaschenen Kleider anzuziehen, zu denen sie absolut keinen Bezug hatte. Lena vermisste ihre alten, löchrigen Jeans, ihre viel zu großen Shirts, die alte schwarze Wolljacke ihrer Schwester.
Es sei nicht gut, die Kleider zu tragen, die einen mit der Vergangenheit verbanden, hatte man ihr erklärt, als sie ihr bei ihrer Ankunft alles genommen hatten, das ihr etwas bedeutete. Lena war sich sicher, diese Heimleute wollten nur eins; neue, ihren Vorstellungen entsprechende Mustermenschen erschaffen.
Sie hatte mindestens zwanzig Minuten im Bad verbracht, fünfzehn davon wie versteinert unter der Dusche, hatte es geschafft, alles Grauenhafte aus ihrem Kopf zu verbannen, doch jetzt plötzlich drangen die ganzen furchtbaren Bilder von vergangener Nacht zurück in ihr Bewusstsein. Kevin. Sie wollte sich nicht ausmalen, was diese Schweine ihm möglicherweise angetan hatten.
»Du weißt doch genau, wie sauer der Heimleiter wird, wenn wir zu spät kommen?!«, zischte Lenas Zimmergenossin Céline energisch, als Lena mit immer noch nassen Haaren aus dem Badezimmer kam.
»Und wenn schon«, erwiderte Lena. »Ist mir doch egal.«
Céline strich sich mit einer genervten Geste die dünnen, hellblonden Haare aus dem Gesicht und wandte sich von Lena ab. »Musst du wissen, ich lass mich heute nicht zwanzig Minuten über moralische Grundsätze zulabern«, sagte sie, während sie das Zimmer verließ, ohne sich dabei noch einmal umzudrehen.
***
»Lena, geht es dir gut?«, drang eine fürsorglich, fast mütterlich klingende Stimme zu ihr durch.
Lena zuckte zusammen und versuchte, sich auf einen bestimmten Punkt auf dem riesigen, in der Mitte der Wand hängenden Foto der Gemeinschaft zu konzentrieren, um die aufkeimende Panik zu unterdrücken. Panik, weil sie nicht wusste, wie sie in diesen Raum und an diesen Tisch gekommen war. Doch auch der Anblick dieser verlogenen, falschen Glückseligkeit, die dieses Foto ausstrahlte, half ihr nicht dabei, sich zu erinnern, sondern saugte auch noch den letzten Rest Farbe aus ihrem Gesicht. Sie fühlte, dass sie wieder mal leichenblass wurde.
Dr. Schenker schaute Lena einen Moment lang so besorgt an, dass Lena ihre Fürsorge beinahe für echt hielt.
»Lena? Lena? Hörst du mich? Bist du noch bei uns?«, fragte die Ärztin, die zwischen dem Heimleiter und Ben saß. Ben war Mitte zwanzig und schon seit einigen Jahren in diesem Heim. Er gehörte schon fast zum Inventar. Ihm machte das nichts aus, wie er immer wieder beteuerte, ihm schien es in diesem Heim zu gefallen, und Lena hasste es, wie er sich ständig als Chef aufspielte.
»Entschuldigung, ja, ich bin … bin … da«, stotterte Lena leise, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, doch dafür war es bereits zu spät. Alle Augen im Raum waren auf sie gerichtet. Sie wusste, was alle über sie dachten. Dass sie nicht ganz richtig im Kopf war. Nur einer hatte das nicht gedacht, nur er hatte sie so respektiert, wie sie eben war. Und da fiel ihr alles wieder ein.
»Wo ist er? Wo ist Kevin, was habt ihr mit ihm angestellt?«, platzte es aus ihr heraus.
»Aber Lena, das habe ich doch gerade eben verkündet«, sagte der Heimleiter und setzte ein Lächeln auf, das vermutlich Mitgefühl hätte ausdrücken sollen.
»Ist es heute wieder etwas schlimmer, Lena?«, mischte Dr. Schenker sich ein. »Wie wäre es, wenn wir nach der Verkündungsrunde unter vier Augen darüber reden, hm?«
Lena ignorierte die Worte der Ärztin und starrte in das Gesicht des Heimleiters, den sie bis heute nicht hatte durchschauen können. Normalerweise fiel es ihr leicht zu verstehen, wie die Menschen tickten. Doch er machte ihr in letzter Zeit nur noch Angst. Seine schwarzen, für ihren Geschmack viel zu glänzenden Haare reichten beinahe bis zu seinen Augen, die er hinter einer professorenhaften, leicht getönten, runden Brille versteckte. Er wirkte wie jemand, der um jeden Preis wie ein alter, weiser Mann und zugleich wie ein junger, cooler Sportlehrer wirken wollte. Lena fragte sich, wie viel er von dem wusste, was hier vor sich ging, oder ob er wirklich so ahnungslos war, wie er vorgab zu sein.
Während er sie mit seinen Blicken durchbohrte, fühlte sie, wie ihr Puls immer mehr beschleunigte. Am liebsten wäre sie in diesem Moment aufgesprungen, aus dem Haus und zurück zum Pfarrer gerannt. Sie war sich ziemlich sicher, dass er ihr geglaubt hatte. Da war etwas in seinen Augen gewesen, was sie schon lange nicht mehr bei einem Menschen gesehen hatte. Menschlichkeit, Offenheit, Hilfsbereitschaft. Und vielleicht ein klein wenig Mitleid.
Lena sah, wie Dr. Schenker sich an den Heimleiter wandte und ihm etwas zuflüsterte. Nicht leise genug, Lena verstand jedes Wort.
»Mach dir keine Sorgen, Christian, ich werde mich später um sie kümmern.«
Christian nickte und wandte sich wieder an den Rest der Gemeinschaft.
»Nun, habt ihr nicht etwas vergessen? Habe ich euch nicht gerade gesagt, dass Kevin aufgebrochen ist, um seine letzte Prüfung zu bestehen?«, fragte er in die Runde. »Seid ihr nicht auch so überzeugt wie ich, dass Kevin es schaffen wird? Es schaffen wird, ein neuer Mensch zu werden, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen?«
Niemand schaute fragend, alle wussten, was sie zu tun hatten, und so stand einer nach dem anderen auf. Alle stellten sich um den riesigen, mit Zeichnungen und Mustern verzierten Massivholztisch, falteten ihre Hände vor dem Bauch und warteten auf die Gesangseinstimmung des Heimleiters. Alle außer Lena. Das Letzte, was sie tun wollte, war, diesen Leuten das Gefühl zu geben, dass sie ihnen ihre Geschichte glaubte. Eher würde sie sterben.
Der Heimleiter schloss die Augen, einige Bewohner taten es ihm gleich. Dann erklang ein gänsehauterregendes Summen. Eine von lateinischen Versen begleitete Melodie, die Lena immer an Friedhof und Tod erinnerte, erfüllte den Raum.
Als sie die Melodie nicht mehr ertragen konnte, hielt sie sich mit den Händen die Ohren zu, presste die Augen zusammen und wurde kurz darauf von Mikael, der dicht neben ihr stand, sanft wieder zurück in die Realität gerüttelt. Wäre es jemand anderes als er gewesen, wäre Lena jetzt vermutlich ausgerastet. Doch Mikael war anders als die anderen. Er schien sich seit seiner Ankunft vehement dagegen zu wehren, sich von diesen Leute das Gehirn waschen zu lassen und machte seit jeher gute Mine zum bösen Spiel. Vielleicht sollte sie ihm erzählen, was sie gesehen hatte. Vielleicht würde er ihr glauben.
Als das Lied endlich ein Ende nahm, brachte der Heimleiter den riesigen Krug, der schon die ganze Zeit über dem knisternden Feuer des Kamins gekocht hatte, und stellte ihn auf die handgewobene Unterlage, auf die ein zielsicherer, auf einem Hügel stehender Schütze genäht worden war.
Marita, die Assistentin des Heimleiters, nahm den Krug und füllte nacheinander die Tassen, die pingelig genau in der Mitte vor ihren Besitzern auf dem Tisch standen.
»Heute ist Allerheiligen, deswegen wollen wir noch der Toten gedenken, all jenen, die eine große Lücke in unserem Leben hinterlassen haben«, sagte Christian, warf einen bedeutungsvollen Blick in die Runde und hob seine Tasse. »Lasst uns noch einmal an Pascal denken, der auf tragische Weise von uns gegangen ist, kurz bevor er sein neues Leben beginnen konnte.«
Lena sah von Christians Worten ergriffen auf, fühlte, wie ihr Tränen in die Augen schossen, und musste wieder an Kevin denken. Ihre Sorge um ihn wurde immer größer.
»Und jetzt trinken wir auf Kevin,«, fuhr der Heimleiter fort, »einen Menschen, der uns den Weg weist. Ein Freund, einer von uns, der uns allen beweisen wird, dass sich der Kampf lohnt. Er war ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft.«
***
Er war ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft.
Immer wieder rezitierte Lena im Geiste diesen Satz. Kevin war ein wichtiger Teil, nicht: Kevin ist ein wichtiger Teil. Dabei war doch noch gar nicht klar, ob er die letzte Prüfung bestehen würde. Im Augenblick hielt er sich an irgendeinem Ort auf, ganz alleine, wo er etwas tun musste, über das nicht gesprochen wurde. Zumindest wurde das so behauptet, Lena jedoch glaubte ihnen kein Wort.
»Lena, ich weiß, es ist schwierig für dich, weil Kevin nicht mehr da ist. Aber er hätte dir den Erfolg doch genauso gegönnt, meinst du nicht auch?«, fragte Dr. Schenker, die Lena auf dem Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtischs im Büro gegenübersaß. »Aber dir müsste doch klar sein, dass dieser Weg, den Kevin gegangen ist, dir noch viel mehr Schwierigkeiten bereitet. Finde dich damit ab und versuche dein Bestes.«
Lena versuchte, dem Blick der Ärztin auszuweichen. Sie wollte nicht hier sein, wollte sich diesen Mist nicht schon wieder anhören und hatte vorhin noch versucht, Dr. Schenker zu entkommen. Ohne Erfolg.
Sie fragte sich, wieso diese Frau überhaupt hier arbeitete? Was hatte eine Psychiaterin an einem Ort wie diesem verloren? Hatte man sie etwa nur wegen der sogenannten Fälle, wie sie, Lena, angeblich einer war, hier eingestellt?
»Du solltest wenigstens genügend trinken«, fuhr Dr. Schenker fort und füllte Lenas Tasse mit Tee. »Nur zu, der Tee wird dir bestimmt zur Ruhe verhelfen.«
Lena trank die lauwarme Brühe fast in einem Schluck aus. Sie hasste diesen elenden Pfefferminztee, den sie hier jeden Tag tranken. Doch wenn sie sich dieses bittere Zeug antun musste, damit man sie in Ruhe ließ, machte sie das eben.
Sie fühlte, wie der Tee zu wirken begann, ihr Puls sich beruhigte, und ihre Augenlider immer schwerer wurden.
»Also, Lena, sind wir uns jetzt einig?«, hörte sie Dr. Schenkers Stimme wie aus weiter Ferne.
Worüber?, wollte Lena fragen, aber auch ihre Zunge war schwer. Und ihre Lippen schienen aneinanderzukleben.
»Du weißt jetzt, dass Kevin an einem Ort ist, wo es ihm sehr gut geht, ja? Er wollte die letzte Prüfung ablegen, das war ihm sehr wichtig, und ich denke, er wird sie bestehen. Und deswegen wirst du dir nicht noch länger den Kopf über ihn zerbrechen. Versuche, es ihm nachzumachen, Lena, versuche, dein inneres Gleichgewicht zu finden. Auch wenn es dir schwerfällt.«
Die Stimme entfernte sich immer weiter von Lena, und sie dachte ein letztes Mal an Kevin, ihren Kevin, mit dem sie so viele Pläne gemacht hatte. Kevin war fort, okay, aber er war an einem Ort, an dem es ihm gut ging. Dort wollte sie auch hin.
Mit diesem Vorsatz schloss sie die Augen und spürte, wie eine wohlige Wärme ihren Körper durchströmte. Ein Gefühl, das sie zuversichtlich machte. Zuversichtlich, dass auch sie es schaffen konnte, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und die nächste Stufe auf der Leiter in die Freiheit zu erklimmen, um bald ein neues Leben beginnen zu können.
4
»Bist du bereit, ein neues Leben zu beginnen?«
Wie oft hatte er diese Frage jetzt schon gehört, seitdem er in diesem Drecksloch eingesperrt war? Kevin wusste es nicht, aber er fragte sich, wie lange sie dieses Spiel noch mit ihm treiben wollten. Vielleicht so lange, bis er die Dunkelheit nicht mehr ertragen könnte und alles tun würde, um dieser vermeintlich ausweglosen Lage zu entkommen. Er war sich ziemlich sicher, dass das bei ihm nicht lange dauern würde, denn er hasste die Dunkelheit von ganzem Herzen. Nicht, weil sie ihm Angst machte, sondern weil sie ihn an etwas erinnerte, das er seit Langem zu verdrängen versuchte.
»Ja oder nein?«, fragte diese heiser flüsternde Stimme, die von der anderen Seite des Raumes zu ihm herüberdrang. Von dort, wo ab und zu eine Tür aufging und einen Streifen Licht hereinließ, der ihn daran erinnerte, dass es noch etwas anderes als dieses Dunkel gab. Ein Leben dort draußen. Ein neues Leben vielleicht?
Natürlich wollte er ein neues Leben beginnen, nur deswegen war er vor über einem Jahr in dieses Heim gekommen. Das war doch das Ziel, oder? Die anderen Prüfungen zu bestehen, war ja nicht allzu schwierig gewesen. Aber das hier? Eingesperrt in einem nach Moder und Schimmel müffelnden Raum mit einer Campingtoilette in der Ecke, die nicht nur nach Chemie stank.
Kevin wusste nicht genau, wie lange er schon hier war, ob es ein oder zwei Tage waren, er wusste nur eines, er wollte hier so schnell wie möglich wieder raus. Aber bisher hatte er keine Fluchtmöglichkeit gefunden, und ihm wurde schlagartig bewusst, dass er keine andere Wahl hatte, als mitzuspielen.
»Ja«, sprach er es deshalb endlich aus. »Ich bin bereit, ein neues Leben zu beginnen.«
Ein lautes, beinahe erleichtertes Seufzen erfüllte den Raum, das zugleich unheimlich und fremdartig klang. Jetzt begann Angst durch Kevins Glieder zu kriechen. Zuerst schwach, und beinahe unerträglich wurde es, als er Schritte hörte, dann ein Knarren, wie von schlecht geölten Scharnieren und zuletzt das Geräusch einer zufallenden Tür. Hatten sie ihn doch wieder alleine gelassen?
Es wurde still, zumindest für ein paar endlos erscheinende Sekunden. Dann hörte Kevin ein Zischen, gleichzeitig flammte ein Streichholz auf und eine Kerze wurde entzündet. Es war doch jemand im Raum geblieben, von dem aber nicht viel zu erkennen war. Nur eine Gestalt mit einer Kapuze auf dem Kopf hinter einer grellen Flamme, die Kevin dazu zwang, die Augen zusammenzukneifen. Erneut fragte er sich, was das alles sollte, aber er sprach seine Gedanken nicht aus, weil ihn die Furcht noch immer fest im Griff hatte.
Er erwartete, dass die Gestalt jeden Moment etwas zu ihm sagen würde, doch stattdessen blieb sie einfach reglos stehen. Die Zeit verging, ohne dass irgendetwas geschah, doch dann spürte er auf einmal eine unheimliche Müdigkeit, die ihn beinahe lähmte. Er machte ein paar Schritte zurück, ohne dabei die Gestalt aus den Augen zu lassen, ließ sich neben der kalten Steinmauer auf die mit Heu ausgelegte Fläche nieder und schloss die Augen.
Plötzlich erfüllte ein lautes Summen den Raum. Kevin riss die Augen auf und sah noch immer das gleiche Bild vor sich wie zuvor. Eine lodernde Flamme, dahinter die dunkel gekleidete, vermummte Gestalt. Im ersten Moment fragte er sich, ob er jetzt schon halluzinierte, doch dann erkannte er das Lied, das die Gestalt anzustimmen begann. Ave Maria! Das Lied war ihm im Heim bereits nach zwei Wochen auf den Wecker gegangen, doch jetzt löste es nur noch Panik in ihm aus. Wieso musste es ausgerechnet dieses seltsame Lied sein? Passierte das jetzt alles nur, weil er Ja gesagt hatte? Ja, zu einem neuen Leben?
Er presste die Hände auf seine Ohren, um den immer lauter werdenden Gesang ertragen zu können, und wünschte sich an einen anderen Ort. Sein Wunsch wurde ihm nicht erfüllt, aber zumindest verstummte der Singsang nach ein paar Minuten. Vorsichtig ließ er die Hände wieder herabsinken und wartete mit angehaltenem Atem darauf, was als Nächstes passierte.
»Ich und die gesamte Gemeinschaft heißen dich herzlich willkommen zu deiner letzten Prüfung«, begann eine Stimme zu sprechen.
Er konnte sie nicht wirklich einordnen, es klang wie eine Frau, die ihre Stimme verstellte, um wie ein Mann zu klingen. Konnte das vielleicht ...? Nein, unmöglich. Sie hatte doch überhaupt nichts mit den Prüfungen zu tun. Wobei er sich nie wirklich sicher gewesen war, ob die Gerüchte, die im Heim über die letzte Prüfung verbreitet wurden, überhaupt stimmten.
»Fürchte dich nicht vor dem, was dir in den kommenden Tagen auferlegt werden wird. Es ist Teil deines Weges. Ein Kapitel im Buch deines Lebens, welches unumgänglich und zugleich von großer Bedeutung ist. Du wirst in diesem Kapitel nicht viele Worte, doch dafür viele Antworten finden, wenn du sie zulässt. Die nächsten Tage sollen ein Spiegel deiner dunkelsten Zeiten sein, die bereits weit hinter dir liegen. Wir sind froh, dass du dich dazu entschlossen hast, auch jene Dunkelheit hinter dir zu lassen, für die du dich zunächst entschieden hattest. Jetzt bist du bereit, weiterzugehen.«
Mit diesen Worten beendete die dunkle Gestalt ihre Rede. Die Flamme erlosch, kurz darauf hörte er das Geräusch des Türschlosses, gefolgt von dem fast ohrenbetäubend lauten Knarren der alten Holztür. Er rechnete damit, dass grelles Licht den Raum erfüllte, sobald die Tür geöffnet wurde, doch auch außerhalb seines Gefängnisses war es jetzt dunkel. Die Tür fiel mit einem Klicken zurück ins Schloss.
Er setzte sich auf, lehnte sich gegen die Wand und starrte auf die Stelle, an der zuvor noch die Gestalt gestanden hatte. Auch wenn sie ihm ganz und gar nicht geheuer gewesen war, hatte er sich in ihrer Gegenwart wenigstens nicht so einsam gefühlt.
Die Dunkelheit, für die er sich zunächst entschieden hatte? Wann war das gewesen? Er konnte sich nicht daran erinnern, aber es war eindeutig zu lange her, sonst hätte sein Überlebensdrang sich niemals eingemischt und ihn dazu gebracht, nachzugeben. Eigentlich wollte er diese verdammte Prüfung gar nicht ablegen, doch jetzt blieb ihm wohl nichts anderes mehr übrig, als genau das zu tun. Er hätte nachfragen sollen, ob ihm die vergangenen Stunden oder Tage in der Dunkelheit auf die kommende dunkle Phase angerechnet wurden, oder wie lange sie noch dauerte, aber er hatte sich nicht getraut, und jetzt waren sie wieder fort. Ihm blieb also nichts anderes übrig, als die Zeit totzuschlagen.
Einfach um irgendetwas zu tun, tastete er nach der Flasche, die immer wieder aufgefüllt und neben seinen Schlafplatz gestellt wurde, während er schlief. Zumindest bekam er nie mit, wann sie das taten. Er nahm einen kräftigen Schluck des ungesüßten, kalten Tees, verzog angewidert das Gesicht, leerte aber dennoch die halbe Flasche. Danach holte ihn diese unerklärliche Erschöpfung wieder ein, seine Augen fielen zu, und er legte sich auf den Steinboden, dessen fast schmerzhafte Kälte sich durch das wenige Heu in seinen Körper bohrte.
5
Lukas saß an seinem Schreibtisch in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung und starrte auf das leere Dokument auf seinem Bildschirm. Der Cursor blinkte beinahe hypnotisch vor sich hin, und Lukas wusste nicht, ob die sich plötzlich in ihm ausbreitende Müdigkeit daher rührte oder von der kurzen Nacht, die hinter ihm lag.
Er hatte nur schlecht in den Schlaf gefunden, immer wieder waren seine Gedanken zu Hannes Warth abgeschweift. Der Anruf des Pfarrers war nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Ganz im Gegenteil hatte er Erinnerungen und Sorgen heraufbeschworen, die Lukas lange Zeit erfolgreich verdrängt hatte. Doch jetzt wollte ihm das nicht mehr gelingen. Warum hatte Hannes ausgerechnet ihn angerufen und um Hilfe gebeten? Und warum hatte er das Gefühl, dass der Pfarrer ihm irgendetwas verschwiegen hatte.
Es war noch nicht einmal acht Uhr, behauptete die digitale Anzeige rechts unten am Monitor. Selten hatte es ihn so früh in die Redaktion gezogen, heute auch nur deshalb, weil er sich ablenken wollte. Nur dumm, dass der Artikel über Stuttgart 21 nicht vorankam, den er schreiben musste. Oder besser gesagt, dass ihm nichts dazu einfallen wollte. Alle Informationen über die Nachlässigkeit der Bahn zu dem Projekt waren schon längst zur Presse durchgesickert. Lukas war wieder einmal viel zu spät dran, und genau das hatte sein Redakteur ihm schon vergangenen Freitag unter die Nase gerieben. Er brauchte eine Story, eine wirklich gute Story, sonst könnte er seinen Beruf demnächst an den Nagel hängen.
Eine Story? War die nicht greifbar nah? Lukas öffnete den Internetbrowser, um zu sehen, ob es neue Informationen über das Reintegrationsheim im Schwarzwald gab. Zunächst fand er nichts Besonderes, doch dann stieß er auf einen kurzen, aber interessanten Bericht in einer vier Wochen alten Ausgabe der Badischen Zeitung.
Und manchmal stürzen sie dann doch wieder ab
Vergangenes Wochenende fanden zwei Wanderer eine Leiche in einer Schlucht im Schwarzwald. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um einen jungen Mann, der im Haus Sonnenschein, einem Reintegrationsheim für Ex-Drogensüchtige, untergebracht gewesen war. Man geht von einem tragischen Unfall aus, die polizeiliche Untersuchung ist aber noch nicht abgeschlossen. Der Leiter des Heims gab keinen Kommentar zu der Tragödie ab. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freiburg zu melden.
Lukas sah von dem Text auf und schüttelte den Kopf. Seine Einstellung gegenüber Drogensüchtigen war wahrlich nicht die Beste, aber die Überschrift des Artikels fand er einfach nur geschmacklos. Er musste an Valentin denken, der mehr als einmal abgestürzt war. Immer und immer wieder war er trotz mehrmaligem Entzug rückfällig geworden. Daher auch Lukas’ damaliges Interesse an diesem Heim, das mit dem Versprechen lockte, ehemaligen Drogensüchtigen zu einem neuen, drogenfreien Leben zu verhelfen.
An einem stürmischen Herbsttag war Lukas in dieses Dorf im Schwarzwald gefahren, um sich die Einrichtung anzuschauen, obwohl er zuvor am Telefon abgewiesen worden war. Der Alltag der Heimbewohner dürfe auf keinen Fall gestört werden, teilte ihm seine Gesprächspartnerin telefonisch mit, was ihn allerdings nicht davon abgehalten hätte, von außen einen Blick auf das Heim zu werfen. Doch leider machte ihm das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Die Zufahrtsstraße zum Heim war wegen mehrerer umgestürzter Bäume gesperrt.
Das Heim bekam er also nicht zu sehen, dafür lernte er Hannes Warth kennen, als er in der Kirche Schutz vor dem Regen suchte, während er das Dorf besichtigte. Der Pfarrer konnte einiges über die Einrichtung erzählen und berichtete nur Gutes. Deswegen und auch wegen der hohen Erfolgsrate schlug Lukas seinem Bruder vor, sich in dieses Heim einweisen zu lassen. Doch leider entschied Valentin sich nach anfänglichem Interesse schließlich doch dagegen.
Lukas überflog die Berichte, die im Internet über das Reintegrationsheim zu finden waren, neue Informationen erhielt er aber kaum. Dass dieses Heim seit über einem Jahrzehnt existierte, wusste er bereits. Auch, dass außer diesem noch zwei weitere Heime dieser Art existierten. Eines im Bayerischen Wald und eines in den deutschen Alpen nahe der österreichischen Grenze. Alle drei wurden durch eine Stiftung finanziert, die vor allem Projekte unterstützte, die der Drogensucht den Kampf angesagt hatten. Alle Einrichtungen konnten Erfolge vorweisen. Viele Drogenabhängige schafften nach dem Programm, das sie dort zu absolvieren hatten, zurück in ein geregeltes Leben. Manche auch nicht, aber das schien ganz normal zu sein. Ebenso normal war es, dass ab und zu der ein oder andere Exjunkie sich aus dem Staub machte.
Lukas öffnete Google Earth und gab die Adresse des Heims ein, um sich die Lage noch einmal vor Augen zu führen. Das Satellitenbild zeigte ein größeres Gebäude. Das Haupthaus. Dahinter zog sich eine Wiese bis zum Waldrand hinauf. Kleinere Gebäude, vermutlich Ställe und Scheunen waren auf dem Gelände verteilt. Eine Straße zog sich wie eine Schlange den Berg hinauf, am Heimgebäude vorbei auf ein weiteres Haus zu. Aus der Vogelperspektive war nicht ersichtlich, um was für ein Gebäude es sich handelte. Es konnte ein Wohnhaus sein oder eine größere Scheune. Dort jedenfalls endete die Straße und Lukas’ Eifer, sich noch länger mit dem Satellitenbild zu beschäftigen.
Er klickte den Browser weg und betrachtete wieder das leere Dokument auf seinem Bildschirm, aber trotz redlichem Bemühen gelang es ihm nicht, auch nur einen einzigen Satz zu formulieren. Dann, vollkommen unerwartet, traf ihn etwas Hartes am Hinterkopf, und er fuhr auf seinem Drehstuhl herum. Zuerst sah er eine riesige Umhängetasche, das Objekt, das ihn getroffen hatte. Die anfängliche Wut verflog und machte Verlegenheit und Frustration Platz. Er kannte diese Tasche. Das war die Lieblingstasche seiner Freundin, oder besser gesagt Ex-Freundin.
»War das Absicht?«, fragte Lukas und erhob sich von seinem Stuhl. So konnte er auf seine Ex herunterschauen, weil er gut einen halben Kopf größer war als sie.
»Was meinst du?«, erwiderte Nicole angriffslustig. Aus ihren Augen schossen kleine Pfeile mitten in Lukas’ Herz. Sie hatten sich nach einer zweijährigen Beziehung erst vor gut drei Wochen getrennt. Na ja, eigentlich hatte sie ihn verlassen, weil er mit einer anderen Frau geflirtet hatte. Zumindest hatte sie sein Gespräch mit der neuen Sekretärin des Redakteurs so interpretiert.
»Du hast deine Tasche gegen meinen Kopf gehauen«, sagte er. »War das nötig?«
Sie breitete die Hände aus und grinste hinterlistig. »Ach, habe ich dich erwischt? Tut mir leid, das war selbstverständlich keine Absicht.«
Lukas runzelte die Stirn und blickte ihr in die Augen. »Warum bist du immer noch wütend. Ich habe nichts getan.«
»Stimmt, du bist das Unschuldslamm schlechthin. Das war ja schon immer so. Aber im Grunde ist es zwischen uns ja schon länger nicht mehr so gut gelaufen.«
»Aha. Und warum bist du dann hier? Um mir das zu sagen?«
Sie lachte. »Sehr witzig. Nein, ich fange heute hier in der Redaktion an. Hat man dir das nicht gesagt?«
Ihr Grinsen wurde immer breiter, und Lukas fragte sich, warum sie ihm das antat. Ihm jedenfalls war nicht nach Lachen zumute. Er vermisste ihre Nähe, die tiefgründigen Gespräche, den hemmungslosen Sex.
»Gratuliere, dann bist du ja glatt aufgestiegen«, brachte er trotz zusammengebissener Zähne heraus. Bisher hatte sie nur Polizeiberichte verfasst, in Lukas’ Abteilung wurden richtige Artikel geschrieben. Artikel, die Recherchearbeit brauchten, und für die man tagelang, manchmal wochenlang unterwegs war.
Sie kniff die Augen zusammen, das Grinsen wich aus ihrem Gesicht. »Genau, und pass bloß auf, dass ich dir deinen Job nicht wegnehme, das habe ich mir nämlich fest vorgenommen. Die brauchen dringend etwas frischen Wind hier.«
Jetzt wandelte sich seine Frustration wieder in Wut. Blanke Wut darauf, dass sie ihn grundlos verlassen hatte, weil er niemals fremdgegangen wäre. Er hatte sich doch nur mit einer neuen Kollegin unterhalten. Aber Nicole war von Anfang an krankhaft eifersüchtig gewesen. Möglich, dass er sie mit seiner Aktion provoziert hatte. Jetzt erzählte sie überall herum, er hätte mit einer anderen Frau geschlafen, was überhaupt nicht stimmte.
»Verdammte Scheiße noch mal«, fluchte er. »Was ist nur in dich gefahren? Willst du mich fertigmachen oder was? Das kannst du vergessen, meine Liebe. Bevor das passiert, wirst du heulend von dannen ziehen.«
Sie sog die Luft geräuschvoll durch die Nase ein. »Du wirst schon sehen.«
Mittlerweile hatte sich ein siebenköpfiger Halbkreis um sie gebildet. Sechs Kolleginnen und Kollegen, die siebte Person in der Runde war Lukas’ Redakteur. Er räusperte sich, Lukas blickte ihn wütend an.
»Und was wollen Sie jetzt?«, fragte er und bereute sofort seinen viel zu scharfen Tonfall.
»Ich warte seit Freitagabend auf Ihren Artikel. Haben Sie ihn endlich fertig?«, antwortete der Redakteur erstaunlich gelassen.
Lukas fühlte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Alle um ihn herum schauten ihn erwartungsvoll an, in Nicoles Augen sah er Genugtuung und Triumph. Er war kurz vor dem Explodieren, riss sich aber zusammen. Anstatt irgendetwas zu sagen, schaltete er seinen PC aus, nahm seine Jacke und verließ schnellen Schrittes das Büro. Sein Chef rief ihm noch nach, er habe noch keine Pause, doch das war Lukas egal. Er brauchte jetzt ganz dringend frische Luft.
Den Kopf voller Gedanken und mit jeder Menge Wut im Bauch marschierte er die Calwer Straße hinunter, vorbei an den Restaurants, Cafés und Kneipen. Die meisten hatten um diese Uhrzeit noch geschlossen. Ein frischer Wind pfiff um die Häuser, der Himmel war wolkenverhangen und erste Regentropfen fielen herab. Lukas beschloss, etwas Warmes trinken zu gehen und steuerte das nächste Starbucks an.
Nachdem er sich einen großen Kaffee gekauft hatte, nahm er an einem der Tische am Fenster Platz. Die ledernen Sessel waren gemütlich, und es wäre ihm beinahe gelungen sich zu entspannen, aber eben nur beinahe. Immer wieder kreisten seine Gedanken um die Szene in der Redaktion, die ihm jetzt nur noch peinlich war. Wie ein kleiner Junge hatte er sich benommen, trotzig und beleidigt. Dann war da noch der Anruf von Hannes Warth, der ihm auch im Kopf umherschwirrte. Dieses Heim im Schwarzwald beschäftigte ihn doch mehr, als ihm lieb war. Er dachte an die Schlagzeile des kurzen Artikels in der Zeitung über den Tod eines ehemals drogensüchtigen jungen Mannes. Lukas wusste nicht warum, aber plötzlich sah er das Gesicht seines Bruders vor sich und den tiefen Schmerz in dessen Augen, bevor er sich nach ihrem letzten Streit abwandte und fortging.
Lukas zog sein Handy aus der Hosentasche und betrachtete das schwarze Display, als könnte ihm das eine Antwort darauf geben, was er jetzt tun sollte, was jetzt das Beste für ihn wäre. Ein bisschen Abstand. Genau, Abstand zu seiner Ex-Freundin und Abstand zur Redaktion. Außerdem brauchte er endlich mal wieder eine ordentliche Story. Nicht nur für die Zeitung, auch für sich selbst.
Lukas öffnete die Kontakte in seinem Smartphone und wählte die Nummer von Hannes Warth.
6
Eigentlich hätte Lena panische Angst haben, aufstehen und nach Hilfe schreien müssen. Doch stattdessen breitete sich ein warmes, wohliges Kribbeln in ihrem ganzen Körper aus. Sie fühlte sich zufrieden, unbesorgt, geborgen. Nicht einmal die Tatsache, dass sie nicht in der Lage war, Arme und Beine zu bewegen, konnte ihr diese befremdende, doch zugleich unheimlich beruhigende Gewissheit, dass alles in Ordnung war, nehmen.
Das Geräusch eines klickenden Türschlosses hallte durch den Raum. Lena nahm es nur wie aus weiter Ferne wahr, und auch als jemand einen Stuhl zu ihrem Bett zog und sich neben sie setzte, hielt sie ihre Augen geschlossen. Sie wollte diese innere Ruhe, das Gefühl des Seelenfriedens festhalten und nie wieder loslassen.
»Wie fühlst du dich?«, erklang die ruhige Stimme einer Frau neben Lena.
»Geht es dir besser?«
Lena nickte und spürte, wie die Frau ihren Arm anhob und etwas Weiches, Kühles um ihn herumwickelte.
»Das ist nur ein Blutdruckmessgerät, also lass dich davon nicht erschrecken, ja?«, sagte die Frau, doch Lena bekam davon kaum etwas mit. Auch nicht von den weiteren Untersuchungen, welche die Frau immer wieder kommentierte.
Zuletzt setzte sich die Frau wieder neben Lena. »Was kannst du mir über die letzten paar Tage erzählen, Lena? Ist irgendetwas passiert, das dich beschäftigt?«
Lena versuchte nachzudenken, sich an irgendetwas zu erinnern. Doch da war nichts. Vermutlich hatte man sie in ihr Zimmer gebracht und sich um sie gekümmert. War sie krank gewesen? Hatte sie Fieber gehabt? Oder war sie umgekippt? Fühlte sich ihr Körper deswegen so schwer an?
»Ich ... warum? Was soll passiert sein?«, fragte Lena schließlich irritiert. »Bin ich krank? Wie lange bin ich schon in diesem Raum?«
»Mach dir keine Sorgen Lena. Du hattest einen kleinen Nervenzusammenbruch. Aber jetzt geht es dir sehr viel besser. Alles ist gut.«
In diesem Moment verkrampfte sich ihr Körper. Diese Worte.
Alles ist gut.
Sie lösten etwas in ihr aus, das Gefühl der Sorglosigkeit und Entspannung verschwand schlagartig. Es fiel ihr schwer, aber sie schaffte es, sich ein wenig aufrichten, doch die Frau, die noch immer an ihrem Bett saß, drückte ihren Oberkörper sanft aber bestimmt zurück auf das Bett. Lena öffnete ihre Augen, blinzelte, sah aber nur einen dunklen Raum und die verschwommene Silhouette einer Person dicht vor ihr. Wer das war, konnte sie nicht erkennen.
Plötzlich spürte Lena etwas Spitziges, das ganz langsam, mit einem unterschwelligen Schmerz in ihren Unterarm glitt. Ihre Glieder wurden wieder schwer, sie atmete tief ein und wieder aus und ließ sich ohne Gegenwehr zurück in diesen tranceartigen Zustand fallen.
***
»Hört auf! Hört auf! Bitte! Bitte hört auf!«, schrie Lena verzweifelt.
Sie stand an derselben Stelle wie damals, in dieser schwülwarmen Sommernacht vor sechs Jahren in der Mannheimer Innenstadt. Sie wollte ihrem Freund helfen, diese elenden Arschlöcher vertreiben, schaffte es aber nicht. Wie festgewachsen stand sie neben dem Eingang der längst geschlossenen Bar und musste mit ansehen, wie sie zu dritt auf Steffen losgingen. Er lag schon am Boden, war ohnmächtig, reglos. Und doch ließen sie nicht von ihm ab, traktierten ihn mit Fußtritten. In den Bauch, in die Brust, auf seinen Kopf, keine Stelle ließen sie aus.
Lena hasste sich, sie hasste sich so sehr dafür, dass sie nicht in der Lage war, ihm zu helfen, und dabei zusehen musste, wie sie seinem Leben innerhalb weniger Minuten ein Ende setzten.
Hätte sie es nur irgendwie geschafft, sich aus ihrer Starre zu lösen und die Polizei zu rufen. Immer wieder versuchte sie, sich selbst glauben zu lassen, dass es nichts geändert hätte, dass sie viel zu spät gekommen wären, um es zu verhindern. Doch vielleicht hätte es diese elenden, seelenlosen Monster eingeschüchtert und sie hätten doch von ihm abgelassen.
»Bitte! Ich flehe euch an!«, war das Letzte, was sie zu ihnen sagte, bevor sie selbst realisierten, dass da nichts mehr war, was sie noch aus ihm hätten herausprügeln können. Danach verschwanden sie einfach so in der Dunkelheit.
Das Einzige, was in ihr zurückblieb, waren Verzweiflung, Machtlosigkeit und die bittere Endgültigkeit dessen, was passiert war.
»Nein! Das darf nicht sein! Nein!«, schrie sie aus tiefstem Herzen. Und erwachte in diesem Moment von ihrer eigenen Stimme.
***
Ruckartig richtete Lena sich auf und mit einem Schlag wurde ihr bewusst, wo sie sich befand. Dieser Raum, sie kannte ihn. Hier war sie schon oft gewesen, öfter als alle anderen. Der Spezialbehandlungsraum, wie Kevin einmal zu ihr gesagt hatte.
Sie versuchte ihre Arme anzuheben. Es funktionierte. Auch ihre Beine konnte sie wieder bewegen. Dabei spürte sie, dass kalter Schweiß ihren Körper überzog, und sie begann zu zittern. Dann hörte sie wieder das Klicken des Türschlosses. Instinktiv sank Lena zurück auf die Liege, schloss die Augen und stellte sich schlafend. Jemand betrat den Raum, setzte sich neben sie ans Bett und legte etwas an ihren Unterarm. Es fühlte sich kalt und spitzig an.
»Alles ist gut«, hörte sie eine vertraute Stimme flüstern.
7
Als Lukas aus dem Taxi stieg, waren seit dem Anruf bei Hannes Warth noch keine acht Stunden vergangen. Vor ihm lag ein langes Stück Schotterweg, an dessen anderem Ende dieses Reintegrationsheim stand, in das er seinen Bruder hatte stecken wollen. Jetzt war er selbst hier und das fühlte sich irgendwie seltsam an. Außerdem kroch ein Anflug von Nervosität durch seine Glieder.
Am Telefon hatte Hannes gesagt, dass es wirklich kein Problem darstelle, falls er einen Platz in dem Heim haben wolle. Ein mit ihm befreundeter Psychologe könne sofort alles mit der Heimleitung klar machen.
»Du wärst nicht der erste dringliche Fall«, hatte Hannes gesagt. »Für Härtefälle haben die immer einen Platz frei, so etwas planen die ein. Sag mir nur, ob du das wirklich tun willst, und mein Bekannter kümmert sich um alles andere. Du müsstest ihn nur anrufen und selbst mit ihm sprechen. Das ist alles, du musst nicht mal in seine Praxis.«
»Okay, ich ruf ihn an, erzähl ihm meine Lebensgeschichte, jammer ein bisschen rum und so. Und dann wird der alles klar machen?«
»Ja, genau, wie gesagt, wir sind schon lange befreundet.«
»Na schön, ich versuche es. Aber er muss mich unter meinem Decknamen ins Heim einweisen. Ich hoffe, das macht keine Probleme. Kannst du ihm Bescheid geben, dass ich das so haben möchte?«
»Ich sage ihm, dass du eine Person des öffentlichen Lebens bist und deswegen nicht deinen richtigen Namen benutzen kannst, okay?«, hatte Hannes vorgeschlagen und Lukas hatte nichts dagegen einzuwenden. »Und wie willst du dann heißen?«
»Lukas Schmidt.«
»Okay, Lukas Schmidt, dann machen wir das so.«
Lukas hatte das Gespräch beendet, wenig später mit dem Psychologen telefoniert, und bereits um vierzehn Uhr war er in den Zug in Richtung Freiburg gestiegen.
Und jetzt war er hier, obwohl ihm noch immer nicht klar war, worauf er sich da eingelassen hatte. Für einen Rückzug aber war es endgültig zu spät. Das wurde ihm bewusst, als er das Aufheulen eines Motors und das Knirschen von Reifen auf Kies hörte.
Lukas blickte zurück und sah, wie das Taxi, das ihn vom fünfundzwanzig Kilometer entfernten Bahnhof in Freiburg hergebracht hatte, davonrollte. Er schulterte seinen Rucksack, in den er nur das Nötigste gepackt hatte, und ging langsam den Weg entlang, der zwischen laublosen Bäumen und kargen Sträuchern hindurchführte. Die Stimmung war bedrückend, aber Lukas versuchte sich einzureden, dass das lediglich an der Jahreszeit lag. Es war Herbst, kein Wunder also, dass die Welt um ihn herum zusehends an Farbe verlor und deswegen düster wirkte. Außerdem hatte die Abenddämmerung bereits eingesetzt, und leichter Nebel hing in der Luft, die sich hier noch kälter anfühlte als die Luft in Stuttgart vor wenigen Stunden.
Lukas erreichte die Eingangstür des Heimgebäudes, das an eine zu groß geratene Almhütte erinnerte. Neben dem Eingang war ein Schild angebracht.
»Herzlich willkommen im Haus Sonnenschein – wir helfen zurück ins Leben«, stand mit leuchtend roten Buchstaben auf dem hellblau lackierten Holzbrett.
Lukas starrte noch wie gebannt auf dieses Schild, als neben ihm eine blecherne Stimme ertönte. Erschrocken zuckte er zusammen.
»Lukas Schmidt? Unsere Tür steht dir offen.« Sie drang aus dem Lautsprecher neben der Türglocke.
So langsam wurde es albern, befand Lukas, ging aber trotzdem die drei Stufen zum Eingang hinauf, drückte die Türklinke und stand wenig später in einer Art Vorraum des Hauses. Dort kam ihm auch schon jemand entgegen. Eine Frau. Sie trug legere Jeans und darüber einen rotgelbblau gestreiften Rollkragenpullover, der aussah, als hätte sie ihn selbst gestrickt. Ihre Füße steckten in weißen Lederpantoffeln, und ihr blondes Haar hatte sie zu einem lockeren Pferdeschwanz zusammengebunden. Das Brillengestell auf ihrer Nase war knallrot, und Lukas fand, dass diese Frau wie ein wandelnder Farbeimer inmitten eines düsteren Gemäldes wirkte. Leicht deplatziert.
Die Wände des Raums waren hellgrau gestrichen, der dunkle Holzfußboden sah stellenweise morsch aus. So manche Ritze zwischen den Dielen war so breit, dass eine Maus gemütlich hindurchschlüpfen konnte. Die Sitzgruppe auf der rechten Seite bestand aus zwei Sofas und zwei Sesseln mit Gestellen aus hellem Kiefernholz und Polstern aus dunkelbraunem Cord. Dazwischen stand ein Kiefernholztisch, auf dem gar nichts lag. Auch sonst gab es nichts in diesem Raum, keine Pflanzen, keine Bilder an den Wänden. Links ging es in einen langen Flur mit mehreren Türen. Rechts führte eine Treppe ins Obergeschoss.
»Herzlich willkommen«, rief die Frau und kam freudestrahlend auf Lukas zu. Sie reichte ihm die Hand, in die er zögerlich einschlug. »Mein Name ist Marita Oelkrug. Ich bin die Assistentin des Heimleiters und freue mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast.«
Lukas lächelte verhalten und hoffte, dass er dabei aussah wie ein verunsicherter Exjunkie, der dringend Hilfe benötigte, um nicht rückfällig zu werden. So ähnlich jedenfalls hatte er seine Geschichte Hannes’ Bekanntem am Telefon aufgetischt. Es war ihm nicht einmal schwergefallen, einen Mann vorzugaukeln, der kurz vor dem Absturz stand. Er hatte sogar angefangen zu schluchzen, als er erwähnte, wie Nicole ihm den Laufpass gegeben hatte. Wobei ihm die Tränen von ganz alleine gekommen waren, sie waren echt gewesen.
»Komm mit, wir gehen ins Büro und besprechen alles, was wichtig ist. Danach zeige ich dir dein Zimmer«, riss Marita Oelkrug ihn aus seinen Gedanken.
Lukas nickte und folgte ihr ins Büro, das sich in der ersten Etage am Ende eines langen Flurs befand und im Gegensatz zum Eingangsbereich sehr freundlich gestaltet war. Vor den Fenstern standen gepflegte Topfpflanzen, an den Wänden hingen Landschaftsgemälde. Vor der rechten Zimmerwand stand ein schmales Bett und in der Mitte des Raums befand sich ein Schreibtisch aus hellem Eichenholz.
Lukas nahm auf einem gepolsterten Holzstuhl vor dem Tisch Platz, Marita in einem ledernen Bürosessel dahinter. Zuerst klärte sie ihn darüber auf, dass er sich an gewisse Regeln halten müsse. Er sei zwar freiwillig in dem Heim, dürfe aber das Gelände trotzdem nicht ohne Erlaubnis der Heimleitung verlassen. Danach erzählte sie ihm etwas über die Essenszeiten und betonte, dass alle Heimbewohner zu den Mahlzeiten zu erscheinen hätten. Des Weiteren müsse Lukas einmal täglich an den Gruppensitzungen teilnehmen. Über alles andere solle er aber erst im Laufe der nächsten Tage mehr erfahren.
Während des Gesprächs versuchte Lukas, sich ganz auf Marita Oelkrug zu konzentrieren. Er versuchte, sie zu durchschauen, konnte hinter ihre freundliche Fassade aber irgendwie nicht blicken. Ihre Augen wirkten kalt und hart, was aber auch an der stahlblauen Iris liegen konnte. Immer wieder zupfte sie den Kragen ihres Pullovers zurecht, während sie den Blick nicht von Lukas abwandte, als versuchte sie ihrerseits herauszufinden, was in ihm vorging. Er erinnerte sich daran, dass er jetzt die Rolle des verzweifelten ehemals Drogensüchtigen zu spielen hatte, weswegen er begann, Maritas Blick auszuweichen.
»Im Bericht deines Arztes steht, dass du vor zwei Jahren einen Entzug gemacht hast. Du hattest wohl ziemlich viel Methamphetamin konsumiert, richtig? Wieso hast du zu Drogen gegriffen?«
Auf diese Frage war er vorbereitet. »Ich hatte ziemlich viel Stress im Beruf. Immer dieser Leistungsdruck und Konkurrenzkampf. Na ja, irgendwie hat das Zeug geholfen, das alles besser durchzustehen. Es hält einen wach. Zumindest am Anfang. Später nicht mehr, da hat auch das nicht mehr geholfen. Es entwickelte sich zu einem Horrortrip.«
»Okay, aber du warst in einem Entzug. Hattest du dich selbst eingewiesen?«
Lukas nickte. »Als ich gemerkt habe, dass es nur noch bergab geht. Müssen wir das alles durchkauen?«
»Nein, das genügt schon. Nur noch eines, warum genau denkst du, dass du jetzt unsere Hilfe brauchst, Lukas?«, fragte sie. »Du bist doch eigentlich clean, oder?«
»Jedenfalls noch, aber die Versuchung ist groß. Ich bin total am Ende, fühle mich ausgelaugt. Kein Job, meine Freundin hat mich verlassen. Ich stehe unter Druck, dieser ständige Druck, der Norm zu entsprechen«, sagte er mit gesenkter Stimme, ohne Marita anzusehen. »Das verführt. Ich habe das schon mal durchgemacht, will aber nicht wieder schwach werden. Verstehen Sie das?«
»Ja, das verstehe ich sehr gut. Deine Entscheidung, zu uns zu kommen, war richtig. Ach, noch etwas anderes, bis auf wenige Ausnahmen sind wir hier alle per du. Wir sind eine große Gemeinschaft.« Sie wartete kurz, dann nickte sie, als versuchte sie, sich von ihren eigenen Worten zu überzeugen. »Deswegen ist auch unser Erfolg sehr groß, Lukas. Du wirst schon sehen. Jetzt brauche ich noch deinen Ausweis für meine Unterlagen, solange du hier bist.«
Lukas zögerte einen Moment, dann holte er seine Geldbörse aus der Jackentasche, öffnete sie und fischte seinen Ausweis heraus, nicht seinen richtigen, sondern den gefälschten, den er sich vor einigen Jahren beschafft hatte. Manchmal war es einfach besser, wenn man seine wahre Identität schützen konnte. Laut dem Ausweis hieß er Lukas Schmidt und war achtundzwanzig Jahre alt, zwei Jahre jünger als tatsächlich.
Marita warf nur einen knappen Blick auf den Personalausweis, schob ihn in eine Klarsichthülle und heftete diesen in den Aktenordner ab, der vor ihr auf dem Tisch lag. Dann reichte sie Lukas ein Schriftstück und bat ihn, es gründlich zu lesen, und danach zu unterzeichnen, wenn er mit allem einverstanden war.
Lukas überflog, was dort geschrieben stand. Das Schriftstück enthielt seine Daten und einen Passus, dass er mit seiner Unterschrift alle Regeln anerkannte, die in dem Heim galten. Im Grunde willigte er dazu ein, sein altes Leben hinter sich zu lassen, sich in die Hände des Mitarbeiterteams zu geben und alles zu tun, was man ihm auftragen würde, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ein bisschen mulmig wurde ihm zwar dabei, aber schließlich unterschrieb er das Schriftstück mit seinem falschen Namen, ohne zu zögern.
»So, Lukas, jetzt musst du noch eine Urinprobe abgeben und etwas Blut«, sagte Marita, während sie das Dokument in der Mappe verschwinden ließ.
»Ist das nötig?«, fragte er.
»Ja, Lukas, das ist so üblich bei uns. Aus versicherungstechnischen Gründen müssen wir nachweisen können, dass jeder, der zu uns kommt, clean ist, da wir keinen Entzug anbieten, sondern euch stark für das Leben machen. Das Blut nehme ich dir persönlich ab. Keine Sorge, ich bin gelernte Krankenschwester. Möchtest du dich dafür hinlegen?«
Das wollte er nicht, schließlich war er kein Weichei. Ohne zu murren, zog er den Ärmel seines Pullovers nach oben und ließ die Blutabnahme über sich ergehen. Danach ging er zur Toilette und erledigte auch die Urinprobe.
Nachdem die Aufnahmeprozedur erledigt war, führte Marita Oelkrug Lukas wieder hinunter und im Erdgeschoss herum, das menschenleer war, und Lukas fragte sich schon, wo die anderen Bewohner alle waren, als Marita ihn darüber aufklärte.
»Die Mitglieder unserer Gemeinschaft sind heute draußen unterwegs. Sie befinden sich auf so einer Art Schnitzeljagd. Kennst du das aus deiner Kindheit?«
Lukas dachte darüber nach, kam aber zu dem Schluss, dass er niemals auf Schnitzeljagd gegangen war. Weder seine Eltern noch seine Freunde hatten sich mit so einem Quatsch abgegeben. Wer wollte schon querfeldein, womöglich in der Kälte und bei Regen, Spuren verfolgen?
»Äh, eher weniger«, antwortete er und versuchte ein Lächeln, das ihm aber sofort wieder entglitt, als er Maritas Blick bemerkte, der sich mitten in seine Seele zu bohren schien. »Meine Eltern haben keinen Wert auf so etwas gelegt. Es passte nicht in ihr Weltbild«, fügte er rasch hinzu.
Marita zuckte die Achseln. »Dann wirst du es bei uns vielleicht zum ersten Mal tun.«
Lukas wusste nicht, was sie damit meinte. »Was zum ersten Mal tun?«
»Na, auf Schnitzeljagd gehen«, antwortete Marita. Ihr Mund verzog sich zu einem verschwörerischen Grinsen. »Entweder jagen oder gejagt werden.«
Warum nur hatte er mit einem Mal das Gefühl, dass er eher zu den Gejagten gehören würde? So ein Quatsch, was bildete er sich bloß wieder ein? Rasch wischte er seine bescheuerten Gedanken fort und folgte dem wippenden Pferdeschwanz der Assistentin die Treppe nach oben in den ersten Stock. Gegenüber des Büros am Ende des Flurs öffnete sie eine Tür und bat Lukas, einzutreten. An zwei Wänden lehnten jeweils zwölf hölzerne Spinde, in der Mitte dazwischen standen einfache Holzbänke. Gegenüber der Tür befand sich ein sechstüriger Kleiderschrank, ebenfalls aus Holz, der die ganze Wand ausfüllte. Die Einrichtung erinnerte an einen Umkleideraum, und, wie sich herausstellte, war es genau das.
»Du kannst dich hier kurz umziehen.« Marita betrachtete ihn abschätzend. »Kleidergröße L dürfte passen, oder?«
Lukas verstand zwar nicht, was das zu bedeuten hatte, nickte aber und sah zu, wie sie zu dem Schrank gegenüber ging, ihn öffnete, darin herumwühlte und mit einem Stapel Hosen, T-Shirts und Pullovern zurückkam. Sie legte die Sachen auf die Sitzbank.
»Ab sofort trägst du nur noch die Kleidung von uns. Du musst alles über Bord werfen, das dich an deine Vergangenheit erinnert. Auch deine eigenen Hosen, Pullover und so weiter. Nur so kannst du zu deiner inneren Ruhe finden und die Prüfungen bestehen.«
Die Prüfungen? Von Prüfungen war nicht die Rede gewesen, aber Lukas versuchte so zu tun, als wüsste er über alles Bescheid.
»Ja. Dann hoffe ich mal, dass ich schnell zu mir finden werde«, murmelte er.
»Du darfst deine eigenen Unterhosen und Socken behalten, wenn sie nicht zu sehr auffallen. Aber alles andere musst du jetzt ausziehen und hier verstauen.« Sie wies ihm einen Spind auf der rechten Seite zu. »Deine Sachen bleiben da drin, bis du uns wieder verlassen darfst. Auch dein Rucksack.«
Verlassen durfte? Lukas gefiel nicht, wie sie das betonte, aber es blieb ihm wohl nichts anderes übrig, als sich zu fügen. Marita wartete, bis er seine Sachen ausgezogen hatte, was ihm ein wenig peinlich war, weil sie ihn mit prüfendem Blick begutachtete. Anscheinend hatte sie nichts gegen seine Boxershorts und schwarzen Sportsocken einzuwenden, also wählte er rasch eine blaue Stoffhose, ein weißes T-Shirt und einen grauen Wollpullover aus dem Kleiderstapel und schlüpfte hinein. Die Kleidungsstücke passen so einigermaßen, fühlten sich aber so steif an, als hätte man sie nach dem Waschen mit Zement gestärkt.
»Und was ist mit der Jacke?«, fragte er und schielte auf seinen nagelneuen, warm gefütterten, schwarzen Parka. »Und meinen Schuhen?« Auf die er eher verzichten konnte, weil sie schon ziemlich ausgetreten waren.
»Die Sportschuhe sind erst mal okay, zumindest für den Sport. Nach passenden Stiefeln für die Arbeit draußen muss ich noch schauen. Eine Jacke bekommst du noch von mir und auch Hausschuhe.« Marita grinste, als sie erneut zum Kleiderschrank ging und eine mausgraue Daunenjacke herauskramte, die vermutlich noch aus dem letzten Jahrhundert stammte. Die Hausschuhe, die sie ihm noch reichte, erinnerten an Jesuslatschen aus der Hippiezeit, aber sie passten perfekt. Lukas unterdrückte ein Stöhnen, kramte seine Unterwäsche und Socken aus dem Rucksack und packte ihn zu seinen anderen Habseligkeiten in den Spind. Danach nahm er seine Turnschuhe, die Daunenjacke und den Stapel Klamotten und folgte Marita aus dem Umkleideraum.
Zuletzt zeigte sie ihm sein Zimmer, das er sich mit einem anderen Mitglied der Gemeinschaft, wie Marita betonte, teilen musste. Der Raum lag ungefähr in der Mitte eines langen Flurs, war nicht besonders groß, aber zumindest standen die Betten versetzt zueinander, sodass jeder ein klein wenig Privatsphäre für sich hatte. Außerdem gab es zwei Stühle und einen Tisch, alles aus Holz, und ein Fenster, durch das man eine leicht trostlose Aussicht hatte. Zumal es mittlerweile fast dunkel geworden war.
Während Marita noch immer auf Lukas einredete, und ihm alles erklärte, was er wissen musste, beobachtete er die Nebelschwaden, die den Berg heruntergekrochen kamen und die weiter entfernt stehenden Fichten und Tannen zu verschlingen schienen. Der Nebel bewegte sich über eine breite Wiese und auf die zahlreichen kleineren Äcker zu, wo vermutlich von Frühjahr bis Herbst Gemüse und Obst angebaut wurden. Es lagen noch einzelne Kürbisse herum, die man wohl vergessen hatte abzuernten. Lukas’ Blick blieb auf dem aus Ziegelsteinen erbauten Schuppen hängen, der sich am Waldrand unter zwei stattlichen Tannen versteckte.
»Und da auf den Äckern bauen wir unser Gemüse selbst an«, riss Marita Lukas aus seinen Gedanken und bestätigte damit das, was er sich bereits zusammengereimt hatte. »Wir kaufen fast gar nichts im Dorf. Nur das Nötigste.«
»Aber ihr seid hier keine Vegetarier, oder?«, wollte Lukas wissen. Er hoffte inständig, das Fleisch würde nicht selbst produziert.
»Nein, natürlich nicht. Wir haben auch ein paar Schafe und Hühner hier oben. Jedenfalls im Sommer hatten wir die noch.«
Lukas riss die Augen auf, doch Marita beruhigte ihn. »Keine Sorge, wir haben sie nicht gegessen. Den Winter über sind die Tiere in einem Stall bei einem Bauern im Dorf. Die Hühner spenden uns Eier, die Schafe fressen das Gras ab und geben Milch, aus dem man leckeren Käse machen kann. Vor ein paar Jahren hat ein Bauer uns dafür seinen Käsekeller zur Verfügung gestellt. Aber der hat sein Geschäft leider aufgegeben und ist weggezogen. Die Alm fällt inzwischen fast auseinander und ist sozusagen Sperrgebiet.«
Lukas atmete kaum hörbar auf und versuchte ein Lächeln. »Dann ist’s ja gut. Ich esse ungern etwas, das ich vorher gekannt habe.«
Sie lächelte. »Hast du noch eine Frage?«
»Im Moment nicht. Danke.«
Marita nickte ihm zu und verließ den Raum. Lukas richtete seinen Blick wieder zum Fenster hinaus und betrachtete den Wald, der oberhalb der Wiese begann und sich den ganzen Hang hinaufzog. Der Anblick faszinierte ihn und zugleich löste er einen Anflug von Melancholie in ihm aus. Seine Eltern hatten meistens Urlaub in den Bergen gemacht. Entweder in den Alpen oder im Schwarzwald. Sie liebten es zu wandern und zu klettern, je steiler und felsiger, umso besser. Lukas hatten diese Urlaube auch gefallen, nur Valentin war immer maulend hinterhergelaufen. Er hatte sich lieber irgendwo hingesetzt und in die Ferne gestarrt.
Lukas lächelte bei dem Gedanken an die alten Zeiten, doch kaum empfand er so etwas wie Freude, wurde sie bereits wieder von seinem schlechten Gewissen überrollt. Zum Glück wurde er von seinen dunklen Gedanken abgelenkt, als er sah, wie eine größere Gruppe Männer und Frauen aus dem Wald heraustrat und langsam über die Wiese schritt. Dahinter kam eine zweite Gruppe, die aber nur aus vier jungen Kerlen bestand. Die letzte Gruppe bestand nur noch aus zwei Personen. Eine junge Frau mit langen, schwarzen Haaren und ein Mann um die Vierzig, der energisch auf die Frau einredete. Die jedoch schien gar nicht darauf zu reagieren. Sie hatte ihre Arme vor der Brust verschränkt, und ihr Blick war auf irgendeinen Punkt in der Ferne gerichtet.
Lukas beobachtete die Leute, bis sie alle im Haus verschwunden waren, dann wandte er sich vom Fenster ab, setzte sich auf sein Bett und stellte fest, dass er sich selten so einsam gefühlt hatte. Er war noch keine zwei Stunden in diesem Heim und schon jetzt wünschte er sich, dass er es bald wieder verlassen konnte.
8
Nachdem Lukas seine neuen Kleider im Schrank verstaut und versucht hatte, die ersten Eindrücke zu verarbeiten, wurde er bereits zum Abendessen gerufen. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, bevor er den gemeinschaftlichen Essraum betrat, aber auf keinen Fall war es das gewesen, was er vorfand.
Fröhlichkeit, Ausgelassenheit und nichts, das darauf hingedeutet hätte, dass die schätzungsweise zwölf jungen Männer und sechs jungen Frauen, irgendwelche Probleme in sich trugen. Sie saßen um einen riesigen Tisch, lachten und sangen, was beinahe ansteckend war. Hätte es da nicht inmitten dieser scheinbar blühenden Oase etwas gegeben, das Lukas’ Aufmerksamkeit auf sich zog. Oder besser gesagt, jemand, eine junge Frau.
Sie stand abseits der Gruppe am Fenster und blickte hinaus. Ihr langes Haar war schwarz und zu einem Zopf geflochten, ihr Gesicht auffallend blass, mal abgesehen von den dunklen Schatten unter ihren Augen. Das schwarze Shirt, das sie trug, verstärkte ihre Blässe noch mehr, und es war ihr mindestens zwei Nummern zu groß. Genau wie die ausgeleierte schwarze Baumwollhose, die an ihr hing wie ein Sack. Lukas fragte sich noch immer, weshalb man in diesem Heim dazu gezwungen wurde, diese abgewetzten Sachen zu tragen, aber ihm passten die Hose und der Pullover wenigstens so einigermaßen.
Die blasse Frau schien seinen Blick zu spüren, denn sie drehte sich ihm zu und sah ihn aus zwei dunkelbraunen Augen unverwandt an. Er fragte sich, was in ihrem Kopf vorging, und überlegte gerade, ob er zu ihr gehen sollte, um sie darauf anzusprechen, als er eine Hand auf seiner Schulter spürte. Lukas fuhr erschrocken herum und blickte in das Gesicht eines jungen Mannes.
»Hey, ich bin Ben«, sagte er. »Man hat dich schon angekündigt. Herzlich willkommen in unserer Runde. Du musst Lukas sein.« Ben lächelte und strich sich mit der linken Hand durch seine blonden Engelslocken. Seine blauen Augen funkelten vor Freude. Oder vielleicht auch wegen etwas anderem. Rasch wischte Lukas den letzten Gedanken aus seinem Kopf, er hatte sich vorgenommen, nicht voreilig zu urteilen.
»Ja, genau, ich bin Lukas.« Er nickte den anderen zur Begrüßung zu und fragte Ben, ob es eine bestimmte Sitzordnung gebe.
Ben führte ihn auf die andere Seite des Tisches. »Du kannst hier sitzen, der Platz wurde vor Kurzem frei.«
»Wie meinst du das?«, erkundigte sich Lukas.
»Nun ja, sagen wir mal so, er wird nicht zurückkommen«, kam die Antwort, die ein wenig wehmütig klang. »Einer, der es nicht geschafft hat.«
»Was nicht geschafft hat, die Finger von den Drogen zu lassen?« Lukas unterstrich seine Worte mit einem wissenden Lächeln.
Bens Augenwinkel zuckte, nur ganz kurz, dann hatte er sich wieder unter Kontrolle. Aber er ging nicht auf Lukas’ Frage ein. Er sagte nur: »Setz dich doch.«
»Danke.« Lukas setzte sich auf den freien Stuhl und beobachtete, wie Ben um den Tisch herumging und sich auf der anderen Seite niederließ.
Kurz darauf ertönte ein Gong, so sanft wie ein Glockenspiel im Wind, und dennoch zuckte Lukas zusammen. Die junge Frau mit den schwarzen Haaren kam eilig an den Tisch und setzte sich neben Ben, der ihr nur einen knappen, aber deutlich missbilligenden Blick zuwarf.
Alle warteten stumm. Worauf, wusste Lukas nicht, aber er wartete ebenfalls, und wenn es nur das Essen war. Immerhin war der Tisch eingedeckt, mit Tellern und Besteck und Tassen, die aussahen, als wären sie von den Bewohnern des Heims selbst getöpfert worden. Lukas betrachtete die Tasse, die an seinem Platz stand, genauer, traute sich aber nicht, sie in die Hand zu nehmen. Dennoch fielen ihm die Buchstaben auf, die am unteren Rand des Gefäßes eingeritzt worden waren. PL. Oder war der erste Buchstabe ein F?
Wem diese Tasse wohl gehört hatte? Vielleicht Lukas’ Vorgänger, vielleicht war es ja üblich, dass sich jeder irgendwann während seines Aufenthalts so eine Tasse töpferte. Lukas schaute die anderen Tassen an, jede davon war einzigartig. Sein Blick blieb auf einer schwarz bemalten Tasse hängen. Sie stand an dem Platz Lukas gegenüber und gehörte der schwarzhaarigen Frau, die auf ihren leeren Teller starrte, als gäbe es dort etwas sehr Wichtiges zu studieren.
Doch plötzlich sah sie auf und musterte sein Gesicht. Er fühlte sich ertappt und lächelte verlegen. Sie starrte ihn ernst an, ganz kurz nur, dann widmete sie sich wieder ihrem Teller, oder dem, was sie darauf sah.
»Um die brauchst du dich nicht zu kümmern«, riss eine flüsternde Stimme von rechts Lukas aus seinen Gedanken, und er zuckte ganz leicht zusammen. »Die ist nicht ganz richtig im Kopf.«
Lukas drehte sich seinem Tischnachbarn zu. Ein junger Bursche, Anfang zwanzig, mit vernarbtem Gesicht, vermutlich von einer ausgewachsenen Akne im Teenageralter.
»Und warum denkst du das?«, fragte Lukas.
»Schau sie dir doch an. Wie blass die ist, und die Schatten unter den Augen. Ich glaube, die hat irgendwo einen Vorrat versteckt.« Zur Unterstreichung seiner Worte riss er die Augen auf und zeigte Lukas jede Menge roter Äderchen, die den Augapfel von den Lidern bis hin zur grünen Iris durchzogen. Lukas fragte sich, ob es nicht eher sein Tischnachbar war, der einen Drogenvorrat versteckte, so wie dessen Augen glänzten.
»Du solltest niemandem etwas unterstellen«, murrte er und warf einen Blick auf die Tasse. »Und wem hat dieser Becher gehört? Einem, der es geschafft hat?«
»Na ja, zumindest hat er die ganze Kacke hinter sich, wenn du verstehst, was ich meine«, kam die Antwort. »Ich bin übrigens Kai.«
Lukas stellte sich seinerseits vor, wollte sich aber nicht vom Thema ablenken lassen. Er hob die Tasse an und zeigte Kai die Initialen. »PL oder FL? Wem hat die Tasse gehört?«
»Pascal Leonhardt. Aber er wird nicht zurückkommen, du kannst das Ding also guten Gewissens benutzen. Und falls es dich interessiert, es ist handgefertigt, wie alle anderen hier. Normalerweise nimmt man seine Tasse mit, sobald man die letzte Prüfung geschafft hat und nach Hause gehen darf.«
Lukas fragte sich, was aus diesem Pascal geworden war? Ob er davon gelaufen war, oder was sonst mit ihm passiert sein konnte. Kai schien seine Gedanken zu lesen und antwortete prompt.
»Pascal hat wohl gedacht, er könnte fliegen. Man hat ihn vor einem Monat im Bach gefunden. Mit dem Gesicht nach unten, und da war er schon ziemlich mausetot und wohl leicht angefressen.«
Kai schien sich beim letzten Teil des Satzes zusammenreißen zu müssen, weil er ihn wohl ziemlich witzig fand. Doch Lukas war nicht nach Scherzen zumute, schon gar nicht, wenn es um so etwas ging. Aber zumindest wusste er jetzt, dass der Name des Verunglückten, über den er in der Zeitung gelesen hatte, Pascal Leonhardt gewesen war.
Am liebsten hätte Lukas diese Tasse jetzt weit von sich geschoben, denn sie war etwas Persönliches, etwas, das einem verstorbenen Menschen gehört hatte, einem jungen Mann mit einer Vergangenheit, die er nicht hatte bewältigen können. Hatte er sich womöglich umgebracht? Weil er die letzte Prüfung nicht geschafft hatte? Oder einfach so? Das konnte doch nicht Sinn und Zweck dieser Einrichtung sein. Warum hatten sie nicht besser auf Pascal aufgepasst?
Lukas wandte sich wieder Kai zu. »Du sagst, er lag im Bach. Und wie ist Pascal dort hingekommen?«
»Hab ich doch gesagt, Mann. Hast du nicht zugehört? Er ist runtergesegelt. Hat wohl gedacht, er hätte Flügel oder so etwas. Was weiß denn ich. Uns hat man das nicht genau gesagt. Nur, dass er es eben nicht geschafft hätte, und wir sollten mal gründlich darüber nachdenken, was das zu bedeuten hat.«
»Und? Was schließt du daraus?«
Kai zuckte die Achseln. »Einen Scheißdreck. Ich denk nicht über so was nach. Aber du scheinst ziemlich neugierig zu sein. Das wirst du dir hier bestimmt bald abgewöhnen.«
»Ah ja? Ich wollte mich ja nur ein bisschen unterhalten«, sagte Lukas hastig. »Und wie lange bist du schon hier?«
»Zu lange, glaub mir, viel zu lange.« Kai senkte die Stimme. »Aber ich werd’s schaffen. Irgendwann, ganz bestimmt, komme ich hier raus.«
Lukas war sich da nicht so sicher, und irgendwie hatte er langsam den Eindruck, dass nicht nur die schwarzhaarige Frau auf der anderen Seite des Tisches ein bisschen durchgeknallt war. Aber was hatte er denn erwartet? Er befand sich in einem Reintegrationsheim, und nicht in einem Golfclub. Das sollte er besser nicht außer Acht lassen.
Das Glockenspiel, das bereits vor wenigen Minuten eingeläutet worden war, ertönte erneut, und sofort wurde es wieder still am Tisch. Alle Augen richteten sich wie gebannt auf die offenstehende Tür, durch die eine Sekunde später ein Mann trat, gefolgt von zwei Frauen. Die eine Frau war Lukas bereits bekannt, sie war die Assistentin des Heimleiters, Marita Oelkrug.
Die Frau neben ihr war etwas älter, vielleicht Anfang vierzig, etwa ein Meter siebzig groß und schlank. Sie trug eine blaue Jeans und darüber einen einfachen, schwarzen Pullover, der ihre Kurven betonte. Ihr rotes Haar war schulterlang und gewellt, ihre hellgrünen Augen wirkten klar und entschlossen, während sie ihren Blick über alle Anwesenden gleiten ließ, als versuchte sie, innerhalb kürzester Zeit herauszufinden, ob alles mit ihnen in Ordnung war. Auf Lukas blieben ihre Augen besonders lange haften, und er musterte sie ebenso neugierig, wie sie ihn. Schließlich nickte sie ihm zu, offenbar hatte er ihre erste Prüfung bestanden. Er schien von ihr akzeptiert worden zu sein.
»Das ist Dr. Schenker, falls es dich interessiert, unsere Seelenklempnerin. Sie besteht darauf, von uns gesiezt zu werden, spricht uns aber beim Vornamen an. Sei auf der Hut, die durchschaut dich sofort«, flüsterte Kai so leise, dass Lukas ihn kaum verstehen konnte.
»Und wer ist der Mann?«
Kai grinste verhalten. »Der Big Boss, der Leiter des Heims. Christian von Hohberg. Er ist eigentlich ganz in Ordnung.«
Na, das war doch wenigstens etwas, dachte sich Lukas, während er beobachtete, wie der Big Boss sich zwischen den beiden Frauen am Kopfende des Tisches niederließ. Kaum saßen alle auf ihren Stühlen, ging eine andere Tür auf, und eine junge Frau schob einen Metallwagen herein, auf dem mehrere Auflaufformen standen. Das Essen. Lukas Magen knurrte, doch als er sich vorstellte, wie der Besitzer der Tasse, Pascal Leonhardt, mit dem Gesicht voran in einem Bergbach lag, zudem angefressen, wie Kai behauptet hatte, verging ihm der Appetit. Dabei hatte er diesen Pascal nicht einmal gekannt.
»Das Mädel heißt Emilie «, flüsterte Kai. »Sie ist eine von uns und hat heute für uns gekocht. Zum Glück, sie kann das echt gut. Also, wenn ich koche, kriegst du den Fraß nicht runter. Sei also gewarnt.«
Emilie stand mittlerweile neben Lukas und gab ihm ein großes Stück Lasagne auf seinen Teller, die wirklich sehr lecker aussah. Dann ging Emilie weiter und legte Kai ein Stück auf den Teller, und so setzte sie ihren Weg um den ganzen Tisch herum fort. Währenddessen herrschte eine beinahe knisternde Stille. Lukas fragte sich, ob man während der Essensausgabe nicht reden durfte, und beschloss, es drauf ankommen zu lassen.
Er wandte sich wieder Kai zu und sagte leise. »Darf ich dich noch etwas fragen?«
Kai nickte. »Klar.«
»Kennst du einen Kevin?«
Wieder ein Nicken. »Warum willst du das wissen?«
»Ach nur so. Hab gehört, er macht bald den Abflug.«
Ein Räuspern vom linken Teil des Tisches durchschnitt die Stille. Lukas fuhr zusammen und drehte den Kopf. Sein Blick traf den von der Psychiaterin, Dr. Schenker.
»Dürften wir alle hören, was es zu bereden gibt?«, fragte sie in einem Tonfall, der Lukas an seine Schulzeit erinnerte. Er kam sich vor wie ein Junge, der beim Abschreiben erwischt worden war.
»Äh, na ja«, stammelte er. »Ich wollte nur etwas wissen. Mir ist noch nicht ganz klar, wie das hier alles so läuft.«
»Ah ja?« Ihr Blick heftete sich auf Kai, der auf seinen Teller starrte. »Kai, worum ging es gerade? Konntest du unserem Neuankömmling bei seinem Anliegen helfen?«
Kai schüttelte den Kopf und sagte, ohne dabei aufzusehen: »Er wollte wissen, ob es hier einen Kevin gibt, und ob der bald den Abflug macht.«
Lukas atmete tief ein und wieder aus und suchte hektisch nach einer plausiblen Erklärung für seine Frage wegen Kevin. Dr. Schenker sah aus, als hätte sie Lunte gerochen, doch dann passierte etwas, mit dem Lukas nicht gerechnet hatte, und wohl auch sonst niemand im Raum.
Zuerst hörte man, wie ein Stuhl mit lautem Krachen umfiel, dann ein entrüstetes Schnauben von gegenüber. Die Frau mit den schwarzen Haaren war aufgesprungen, ihre Augen funkelten angriffslustig, als sie sich Dr. Schenker zuwandte.
»Jeder weiß das von Kevin, und dass er bald den Abflug macht, oder ist das vielleicht doch ein Geheimnis?« Jetzt standen ihr Tränen in den Augen, eine löste sich aus ihrem rechten Augenwinkel und kullerte über die Wange. Sie wischte sie nicht ab.
»Lena, würdest du bitte den Stuhl aufrichten und dich draufsetzen?«, erwiderte die Psychiaterin mit ruhiger Stimme. »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass mit Kevin alles in Ordnung ist. Es geht ihm gut.«
Lena? Lukas starrte die Frau gegenüber an. Das also war die junge Frau, die Pfarrer Warth um Hilfe gebeten hatte.
Lenas Mundwinkel zitterten, während sie immer tiefer sanken. Eine weitere Träne kullerte über ihr Gesicht, und dann noch eine, bald glichen sie einem Strom, der nicht versiegen wollte. Aber anscheinend war ihr das egal. Ihre Augen huschten hin und her, suchten den Raum ab, vielleicht suchten sie nach etwas, das ihr Halt geben konnte. Schließlich blieben sie auf Lukas hängen, nur ganz kurz, für den Bruchteil einer Sekunde, bevor Lena sich umdrehte und im Laufschritt den Raum verließ. Niemand folgte ihr.
»Lasst uns jetzt beten, bevor wir anfangen zu essen«, übernahm Marita Oelkrug das Wort. »Lasst uns Lena in unser Gebet mit aufnehmen.«
Die schwere Holztür fiel laut krachend ins Schloss, und Lukas senkte den Blick. Während er Maritas Gebet nur am Rande mitbekam, betete er nicht nur für Lena, er dankte ihr, weil sie ihn mit ihrem Ausbruch vor weiteren Fragen der Psychiaterin bewahrt hatte.
9
Lena schlug die Tür zum Essraum hinter sich zu und versuchte, sich zu beruhigen, was ihr nicht gelang. Sie musste raus, fort von hier, zumindest erst mal an die frische Luft. Keine Sekunde länger hielt sie es in diesem verfluchten Heim aus, unter diesen ganzen hirngewaschenen, naiven und falsch lächelnden Menschen. Und dieser Neue, der so gar nicht an diesen Ort passte, verunsicherte sie noch zusätzlich. Warum hatte er Kai all diese Fragen gestellt? Oh ja, sie hatte das Meiste davon mitgehört. Möglich, dass in ihrem Kopf manchmal Chaos herrschte, auf ihre Ohren jedoch konnte sie sich verlassen. Und dann, nachdem der Name Kevin gefallen war, war dieses Gefühl wieder in ihr hochgekocht. Dieses brennende Gefühl, dass an diesem Ort etwas nicht stimmte.
Nachdem sie einen Blick über die Schulter geworfen und festgestellt hatte, dass ihr niemand folgte, verließ sie im Laufschritt das Gebäude. Draußen war es mittlerweile dunkel, die Luft kalt und von Nebelschwaden durchzogen. Der Halbmond ging hinter dem östlichen Berg auf und schaffte es, die Nacht zumindest ein klein wenig heller zu machen.
Lena fröstelte, aber nicht wegen der Kälte, es lag an diesem Ort. Dieses Heim, in das ihre Eltern sie verfrachtet hatten, weil sie, so die Worte ihres Vaters, ausgetickt war. Er behauptete, ihre Psychosen kämen von den Drogen. Doch da lag er falsch. Ihr Drogenproblem resultierte aus ihren psychischen Problemen, das sagte jedenfalls Dr. Schenker, und obwohl Lena die Psychiaterin nicht mochte, glaubte sie ihr mehr als ihrem Vater, der doch sowieso nur an sich selbst und seinem guten Ruf interessiert war. Wo war er denn all die Jahre gewesen, wenn sie nach Hilfe geschrien hatte? Was hatte er denn jemals für sie getan, außer sie mit Geld und anderem materialistischem Kram zu füttern, der ihr nichts bedeutete. Sie hasste ihn dafür, aber sie hatte absolut keine Macht über ihn, musste sich seinen Entscheidungen fügen. Und solange er nicht zur Vernunft kam, hing sie hier fest. Eine verzwickte Lage, aus der sie nicht entkommen konnte. Ihr Vater hatte noch immer das Sagen, obwohl sie schon lange erwachsen war. Sie hatte die Nase voll davon, wollte endlich eigene Entscheidungen treffen, ein Leben nach ihren Wünschen beginnen, ein Leben mit …
Kevin!
Sie erinnerte sich an die Nacht, als sie fortgelaufen war, ins Dorf, zum Pfarrer, der sie mit seinen gütigen Augen angesehen und ihr zugenickt hatte. Sie fragte sich, ob er sie wirklich ernst genommen hatte. Hätte dann nicht schon längst jemand in dem Heim nach dem Rechten sehen müssen? Nein, nicht, wenn der Pfarrer ihr nicht geglaubt hatte, oder noch viel schlimmer, wenn die vom Heim ihm erzählt hatten, dass sie geistesgestört war? Plötzlich kam ihr ein noch viel schlimmerer Gedanke: Was, wenn es nur Einbildung gewesen war, dass sie mit dem Pfarrer gesprochen hatte?
Ihre Lunge begann heftig zu schmerzen, während sie durch die Dunkelheit auf den Waldrand zurannte. Irgendwo über ihr kreischte etwas, neben ihr im Unterholz knirschte und raschelte es. Aber nicht einmal das konnte sie stoppen.
Als sie endlich ihres und Kevins gemeinsames Versteck ein Stück vom Heimgelände entfernt erreichte, brannten ihre Lungen wie Feuer. Erschöpft ließ sie sich im Schutz eines wild wachsenden Strauchs auf eine alte Holzbank fallen und drückte instinktiv die Hand auf ihre Brust. Sie versuchte, möglichst ruhig zu atmen und sich zu beruhigen. Das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte, wäre ein Asthmaanfall. Sie hatte ihr Cortisonspray nicht eingesteckt, weil sie es in den letzten Wochen kein einziges Mal benutzt hatte. Kevins Anwesenheit schien sogar ihr Asthma gelindert zu haben. Doch jetzt war sie wieder allein.
Kevin ...
Sie schloss die Augen, versuchte, alles auszublenden und sich auf Kevin zu konzentrieren. Das Rauschen des Windes in den Baumkronen und die kühle Luft auf ihren erhitzten Wangen schenkten ihr ein paar Sekunden innere Ruhe. Plötzlich spürte sie, wie sich jemand neben sie setzte, ihre Hand nahm und streichelte.
Kevin ...
Sie presste ihre Augenlider fester zusammen, um auf keinen Fall den Fehler zu machen, diesen Moment wieder loszulassen. Er war bei ihr, sie konnte ihn spüren, und sie hörte ihn auch.
»Diese Prüfungen sind doch total bescheuert, ich mache das nicht mehr mit. Außerdem werde ich nicht ohne dich von hier weggehen. Wir hauen zusammen ab, ich habe auch schon einen Plan. Vertraust du mir?«
Kevin fragte sie tatsächlich, ob sie ihm vertraute. Wusste er denn nicht, dass er der einzige Mensch auf der Welt war, dem sie vertraute? Sie wäre ihm überall hin gefolgt. Doch Lena war sich nicht sicher, ob ihre verzweifelte Angst, ihm könnte bei der Prüfung etwas zustoßen, ihn zu der Entscheidung gebracht hatte, die Prüfung nicht antreten zu wollen und mit ihr abzuhauen, oder ob er sie tatsächlich so sehr liebte wie sie ihn.
»Bald sind wir von hier weg, Lena. Vertrau mir einfach«, klang seine Stimme in Lenas Ohren, doch dann verhallte sie leise in den Windungen ihres Gehirns. Sie hatte ihm vertraut, aber jetzt war er weg, und sie war immer noch hier. So war das nicht geplant gewesen.
Lena sah die Erinnerungen vor sich, die sie die vergangenen zwei Tage zu verdrängen versucht hatte, weil sie zu sehr schmerzten, und weil Dr. Schenker ihr einredete, dass sie wieder einmal halluzinierte. So wie jetzt, als sie Kevins Hand auf ihrer spürte, seine Worte in ihrem Ohr, und sein warmer Atem auf ihrer Haut. Lena hielt ihn fest, sie wollte ihre Augen nicht öffnen, nur um zu sehen, dass er nicht existierte, jedenfalls nicht mehr.
Kevin!
Was war passiert? Erneut holte sie die Bilder zurück in ihr Bewusstsein.
Da waren die Freude und Hoffnung, mit der sie zum vereinbarten Treffpunkt hinter dem alten Schuppen schlich. Die Zuversicht, die sie nach langer Zeit endlich wieder spürte, als sie sich an die Mauer lehnte, durch die Äste der hohen Tannen in den nachtschwarzen Himmel starrte und auf Kevin wartete.
Und dann kam dieser verfluchte Moment, als sie die Stimmen hörte. Sie ging geduckt um den Schuppen herum zur Vorderseite und sah, wie Kevin in ein Auto gezerrt wurde. Er hatte einen Sack über dem Kopf, und er wehrte sich. Seine Schreie drangen zu ihr herauf. Aber seine Gegenwehr war zu schwach.
Jetzt wollte Lena doch die Augen öffnen, um das alles nicht noch mal sehen zu müssen, schaffte es aber nicht. Sie starrte auf die Szene, solange, bis die Rücklichter des Autos in der Dunkelheit verglühten. Kevin war fort.
Vertraust du mir?
Sie hatte ihm vertraut, auf jeden Fall. Aber tat sie das immer noch? War es möglich, dass die Entführung gar nicht so dramatisch stattgefunden hatte, wie sie gedacht hatte? Lena begann zu zweifeln. An ihrem Verstand und an Kevin. Nein, das konnte nicht sein. Die Luft neben ihr kühlte schlagartig ab, Lena fühlte keine Hand mehr auf ihrer. Kevin war weg. Freiwillig? Nein, das durfte nicht sein, sie wollte das einfach nicht glauben.
Ein anderes Bild tauchte vor Lenas innerem Auge auf. Sie blickte durch ein zerbrochenes Fenster in einen Raum und sah darin jemanden angebunden an einen Stuhl, sein Mund mit Klebeband verschlossen, das Gesicht voller Blut, man konnte kaum noch etwas davon sehen. Trotzdem erkannte Lena ihn, als er die verklebten Augen blinzelnd öffnete und ihr einen flehenden Blick durchs Fenster zuwarf.
Lena zuckte zusammen, riss die Augen auf und spürte, wie ihr Herz raste. Sie saß alleine auf einer Holzbank im Wald. Nebelschwaden umkreisten sie wie Gespenster, doch das war es nicht, was sie erschreckt hatte. Nein, es war Kevin, den sie durch das zerbrochene Fenster gesehen hatte. Wieder nur Einbildung? Anders konnte es doch nicht sein. Kevin war bestimmt nicht tot, Kevin durfte einfach nicht tot sein. Sie musste ihn retten. Aber wie? Sie brauchte einen Plan.
Doch zuerst würde sie die nächsten Stunden brav mitspielen und Dr. Schenker davon überzeugen müssen, dass sie nur einen kleinen Schizo-Anfall gehabt hatte und nun alles wieder in Ordnung war.
Lena atmete tief durch, erhob sich und machte sich auf den Weg zurück ins Heim.
10
Als er sich hingelegt hatte, hatte Kevin eigentlich gehofft, dass seine Müdigkeit ihm den Aufenthalt in diesem elenden Gefängnis ein wenig verkürzen würde. Doch jetzt war sie wie weggeblasen. Hellwach setzte er sich auf und begann, die Sekunden laut zu zählen. Bei exakt fünfhundert hörte er damit auf, weil es ihn fast wahnsinnig machte, dass seine Stimme der einzige Laut an diesem seelenverlassenen Ort war.
Langsam breitete sich ein Gefühl in ihm aus, das er schon lange nicht mehr verspürt hatte. Höchstens in den Momenten, in denen Ben oder sonst jemand vom Heim etwas Gemeines zu Lena gesagt hatte. Dann erkannte er das Gefühl. Es war Wut. Blanke Wut. Auf dieses Heim, auf die Leute, die ihn hier eingesperrt hatten, auf Ben. In diesem Moment verfluchte er alles und jeden. Außer Lena. Und wegen diesem Mist hier konnte er nicht bei ihr sein, nicht wissen, wie es ihr ging. Er wusste ja nicht mal, ob er hier jemals wieder herauskam.
Plötzlich hörte er einen lauten Schrei durch den dunklen Raum dröhnen, und erst im nächsten Moment wurde ihm bewusst, dass es sein eigener war. Er stand auf, begann wie ein Tiger im Käfig hin und her zu laufen, und drehte gerade in der hintersten Ecke des Raumes um, als ein Geräusch ihn zusammenschrecken ließ. Jemand war dabei, die Tür zu öffnen. Wie angewurzelt blieb Kevin stehen und versuchte vergeblich, sich aus seiner Starre zu lösen, sobald die Tür sich endlich einen Spaltbreit öffnete.
»Beweg dich! Renn zur Tür, schlag diese verfluchte dunkle Gestalt nieder, flüchte um dein Leben und vergiss diese verdammte Prüfung!«, schrie eine Stimme in seinem Kopf. Doch er schaffte es nicht. Stattdessen verharrte er auf der Stelle, und seine ganze aufgestaute Wut richtete sich in diesem Moment auf niemand anderen als auf sich selbst. In dem fahlen Licht, das durch den Türspalt hereinfiel, erkannte er die Umrisse irgendeines kleinen Gegenstandes. Vermutlich war es etwas zu essen oder noch mehr von diesem verfluchten Tee. Er hatte jetzt keinen Durst und Hunger schon gar nicht. Alles, was er wollte, war, von hier zu verschwinden.
Endlich schaffte er es, sich wieder bewegen, und ohne noch länger zu zögern, lief er zur Tür, die sich sofort ruckartig schloss und das wenige Licht mit sich nahm.
Zu spät!
Zornig versetzte er dem Ding, das sie ihm hingestellt hatten, mit aller Kraft einen Tritt, sodass es in einem hohen Bogen durch die Luft flog und gegen die Wand knallte. Dann begann er, mit den Fäusten und Füßen auf das Holz einzuschlagen. Beim dritten oder vierten Schlag spürte er einen entsetzlichen Schmerz durch seine Finger zucken, der jedoch schon im nächsten Augenblick wieder verschwand. Sein Herz raste, seine Schläge wurden immer schneller und härter. Doch irgendwann spürte er keine Schmerzen mehr, nur noch sein rasendes Herz und seinen Puls, der durch seine Schläfen pochte, und das Gefühl, demnächst zu explodieren.
11
Lukas betrachtete nachdenklich die schmutzigen Teller und Tassen und fragte sich, ob er jemals in seinem Leben dazu gezwungen worden war, so eine riesige Menge Geschirr von Hand abzuspülen. Nein, ganz sicher nicht, und Zuhause hatte er einen Geschirrspüler, der das für ihn erledigte.
Nach dem Abendessen hatte er versucht, einen möglichst großen Bogen um die Küche zu machen, dennoch hatte er Ben nicht entkommen können, der ihn gleich zum Küchendienst verdonnerte. Jeder Neuankömmling müsse das an seinem ersten Tag tun, hatte Ben erklärt, das sei in dieser Gemeinschaft so üblich, und Lukas ergab sich seinem Schicksal.
Und jetzt in dem Moment, während Lukas überlegte, wie er diesen Berg Geschirr unter Kontrolle bringen sollte, ließ Ben heißes Wasser in ein überdimensioniertes Spülbecken laufen und gab einen Spritzer Spülmittel dazu. Zumindest hatte er sich bereit erklärt, beim Abwasch mitzuhelfen.
Lukas beobachtete, wie der Schaumberg auf der Wasseroberfläche wuchs, sich dem oberen Rand des Beckens näherte und rechnete jeden Augenblick damit, dass der Schaum überschwappte. Doch Ben schaltete das Wasser rechtzeitig ab.
»Rumstehen und glotzen gehört sich bei uns nicht wirklich, weißt du?«, sagte Ben und riss Lukas aus seinen Gedanken.
»Entschuldige, war gerade woanders. Also, was soll ich machen?«
Ben deutete mit einer genervten Geste auf das Spülbecken. »Abspülen? Schon mal gemacht?«
Lukas nickte, nahm den Platz vor dem Spülbecken ein und begann, das schmutzige Geschirr abzuwaschen. Dabei fragte er sich, weshalb so eine Einrichtung sich keine Geschirrspülmaschine leistete. Laut seinen Recherchen lebte das Heim von einer Stiftung, und er hatte nicht den Eindruck gehabt, dass diese nicht ausreichend gespeist wurde. Oder gehörte diese Art von minderwertiger Arbeit bereits zum Wir-helfen-zurück-ins-Leben-Programm? Na, dann konnte der Aufenthalt hier ja heiter werden.
»Sag mal, meinst du, du schaffst das heute noch, oder soll ich bei der Heimleitung eine Verlängerung fürs Abwaschen beantragen?«, fragte Ben neben ihm, der nichts Besseres zu tun hatte, als Lukas zu beaufsichtigen. Mitgeholfen hatte er bisher noch nicht.
Lukas spürte, wie sein Geduldsfaden wegen dieses eingebildeten Schnösels sich ins Unerträgliche zerrte. Doch bevor er Kontra geben konnte, hörte er, wie jemand die Küche betrat.
Lukas drehte sich beinahe synchron mit Ben zur Tür und blickte in das Gesicht von Dr. Schenker, die ihn lächelnd ansah.
»Na, wie läuft es denn so bei euch?«, fragte sie.
Ben deutete auf Lukas und sagte: »Unser Neuling liefert sich gerade einen erbitterten Kampf mit dem bisschen Geschirr des Tages. Ich hoffe, dass er heute noch fertig wird.«
Bevor Lukas etwas zu seiner Verteidigung sagen konnte, baute sich Dr. Schenker dominant vor Ben auf. Das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht.
»Und, Ben, würdest du mir verraten, weshalb Lukas hier überhaupt das Geschirr abwäscht? Wer hat denn diese Woche Spüldienst?«
Bens Blick verdüsterte sich augenblicklich. Rote Flecken schossen ihm ins Gesicht.
»Nun ja, also diese Woche war das ja nicht so genau geregelt, deswegen … also …«, stammelte Ben herum, doch bevor er eine plausible Erklärung für sein Handeln gefunden hatte, beschloss Lukas, ihm zu helfen.
»Schon gut, Dr. Schenker«, sagte er lächelnd. »Ich helfe doch gerne. Vermutlich kann Ben jede Unterstützung gebrauchen, stimmt’s, Ben?«
Ben sagte nichts, aber seine Verlegenheit war ihm deutlich anzusehen.
»Das ist wirklich vorbildlich, Lukas. Weiter so«, sagte Dr. Schenker und schenkte Lukas ein breites Lächeln. Dann drehte sie sich um und verließ die Küche.
»Willst du dann jetzt vielleicht weitermachen?«, fragte Lukas Ben, nachdem die Küchentür ins Schloss gefallen war.
Ben nahm Platz vor dem Spülbecken ein, richtete den Blick auf den Schaumberg und sog geräuschvoll die Luft durch die Nase. Dann sagte er: »Tu das nie wieder, ja? Blamier mich nie wieder vor dieser Frau. Klar?«
Lukas räusperte sich und überlegte, wie er die Situation entspannen könnte. Er war nicht hier, um mit verkorksten Exjunkies herumzustreiten, sondern um herauszufinden, ob es in diesem Heim mit rechten Dingen zuging.
»Tut mir leid, Mann«, entschuldigte er sich bei Ben, wenn auch etwas widerwillig. »Wird nicht wieder vorkommen. Soll ich das Geschirr abtrocknen?«
Ohne eine Antwort von Ben abzuwarten, nahm er ein Küchenhandtuch von einem Stapel, den er auf dem Regal gegenüber entdeckt hatte, und begann gerade damit, die Teller abzutrocknen, als die Küchentür aufging.
Während Ben sich weiter auf seinen Abwasch konzentrierte, beobachtete Lukas, wie Lena die Küche betrat und ohne ihn zu beachten ein Glas aus einem Schrank holte und Tee aus einer Keramikkanne hineingoss. Sie trank ihr Glas in einem Schluck aus und ließ es dann in das Spülbecken fallen. Ben sah sie zornig an, sagte aber nichts und widmete sich wieder seiner Arbeit.
»Du heißt also Lena, richtig?«, wandte Lukas sich an die junge Frau. »Ich bin Lukas, der Neue.«
Lena runzelte die Stirn und zuckte die Achseln. Nach einem kurzen Zögern drehte sie sich um und ging zur Tür hinaus, die sie hinter sich zufallen ließ.
»Kannst du jetzt endlich mal weitermachen?«, meckerte Ben. »Wir sollten heute noch fertig werden.«
Lukas stellte die zuletzt abgetrocknete Tasse in den Schrank gegenüber der Spüle. Dabei fiel sein Blick auf einen aus Ton geformten Becher, der ganz hinten in der linken Ecke stand und seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Nicht, weil er besonders schön war. Im Gegenteil, der Besitzer hatte sich keine große Mühe gegeben. Der Rand war wellig und ungleichmäßig hoch, das Gefäß sah irgendwie so aus, als hätte es einen dicken Bauch. Aber auch das war es nicht, was Lukas stutzen ließ. Nein, es war das Motiv, das auf den Becher gemalt worden war. Ein knallgelber Smiley mit zwei Kreuzen anstatt Augen, einem gewellten Mund, aus dem eine Zunge ragte. Irgendwie kam Lukas dieser Smiley bekannt vor, allerdings kam er nicht darauf, warum das so war.
»Bist du jetzt dann soweit?«, tönte Bens Stimme hinter ihm. »Oder bist du plötzlich eingefroren oder was?«
Der Bursche nervte so langsam. Lukas wandte den Blick von dem Becher ab, verschloss die Schranktür und drehte sich um. »Darf ich dich noch etwas fragen?«
»Kommt drauf an.«
»Ich finde, du spielst dich ganz schön auf, bist wohl schon länger hier und tust so, als hättest du das Sagen. Warum hast du nicht schon längst die Fliege gemacht? Ich meine, für so einen Helden wie dich, dürften die läppischen Prüfungen doch kein Problem sein.«
Ben schnaubte und machte einen energischen Schritt auf Lukas zu. »Du weißt gar nichts von mir, Wichser. Und du weißt gar nichts über die Prüfungen. Also halt einfach deine große Klappe und verzieh dich. Klar?«
»Mann, bleib cool«, erwiderte Lukas und hob beschwichtigend die Hände. »Ich dachte ja nur, dass du vielleicht nur deshalb noch hier bist, weil du nicht ganz loskommst von dem Zeug. Hast du vielleicht irgendwo einen kleinen Vorrat?«
Bens Mund ging auf und gleich wieder zu, sein rechtes Augenlid begann zu zucken, nur ganz leicht, aber aus der Nähe nicht zu übersehen. Er hob den Finger, tippte damit gegen Lukas’ Brust und schien nach Worten zu ringen. Aber er fand keine. Mit hochrotem Kopf widmete er sich wieder dem Geschirr. Lukas nahm den nächsten abgespülten Teller, trocknete ihn ab und beschloss, Ben nicht länger zu reizen.
12
Während Lena langsam die Treppe in die erste Etage hinaufging, um in ihr Zimmer zu gehen, musste sie an den Neuen denken. Was wollte der von ihr? Ständig schien er sie zu beobachten, und jetzt tat er auch noch so, als wollte er Freundschaft mit ihr schließen. Ausgerechnet mit ihr. Irgendwie fühlte sie sich verarscht.
»Lena!«, hörte sie plötzlich eine harsche Stimme hinter sich, die sie zusammenzucken ließ. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass ihr jemand gefolgt war. Als sie sich umwandte, sah sie, dass es Dr. Schenker war, die jetzt auf derselben Treppenstufe angekommen war. »Ich bin deine Spielchen langsam leid. Kannst du dich nicht endlich in die Gemeinschaft einfügen und dich wenigstens bemühen, ein normaler Mensch zu werden? Ist das denn so schwierig? Oder willst du lieber wieder zu diesen passiven, auf bessere Zeiten wartenden Leuten und eine Zigarette nach der anderen rauchen, nur um die Zeit totzuschlagen?«, fragte Dr. Schenker in ruhigem Ton, und Lena war nahe daran, wieder mal abzuhauen. Aber sie riss sich zusammen und schüttelte mit gesenktem Blick den Kopf.
»Gut, Lena, kommst du kurz mit ins Büro?«
Lena nickte und weil sie davon ausging, dass das keine Frage, sondern ein Befehl gewesen war, folgte sie der Psychiaterin widerwillig.
Im Büro setzte sie sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, während Dr. Schenker aus einer Thermoskanne Tee in eine Tasse goss, die sie Lena reichte.
»Trink deinen Tee, der wird dir guttun«, sagte sie.
Lena hatte zwar keinen Durst, nahm aber trotzdem ohne Widerspruch, der sowieso abgeschmettert worden wäre, einen kleinen Schluck und verbrannte sich dabei die Zunge. Doch sie trank weiter und spürte, wie die heiße Flüssigkeit ihre Speiseröhre hinablief.
Dr. Schenker lehnte vor ihr am Schreibtisch und lächelte. Doch das Lächeln wirkte nicht echt, und je länger Lena in das Gesicht der Ärztin starrte, umso mehr verzerrte es sich zu einer Fratze. Nebel breitete sich um Lena aus, alles verschwamm, und aus dem Nebel formte sich ein grauenvolles Bild, so real, sie konnte es beinahe mit den Händen greifen. Hätte sie die Kraft dafür gehabt.
Sie sah Kevin vor sich, in einem dunklen Raum auf einen Stuhl gefesselt. Über ihn gebeugt stand eine Gestalt in einer schwarzen Kutte. Durch die Luft schwebte ein glühender Gegenstand, der sich Kevins Gesicht näherte. Ganz langsam kam er ihm immer näher und näher und …
»Lena!«, hörte sie eine Stimme wie aus weiter Ferne.
»Kevin«, flüsterte Lena und streckte die Hand aus.
Doch es war nicht Kevins Stimme, sondern die von Dr. Schenker, die jetzt so dicht vor ihr war, dass sie ihren schalen Atem riechen konnte.
»Lena, was ist los mit dir? Wieso starrst du mich an? Und würdest du jetzt bitte deinen Tee austrinken?«, sagte die Psychiaterin mit Nachdruck.
Lena blinzelte, setzte die Tasse an und trank sie leer. Dann erhob sie sich und verließ langsam den Raum, obwohl sie nichts lieber getan hätte, als davonzurennen.
Als sie endlich ihr Zimmer betrat, fühlte sie sich, als hätte sie einen Doppelmarathon hinter sich. Todmüde ließ sie sich auf ihr Bett fallen und schloss die Augen. Sofort tauchte diese scheußliche Szene wieder vor ihr auf.
Kevin gefesselt, eine dunkle Gestalt, ein glühendes Messer.
Lena musste ihm helfen, schaffte es aber nicht, die Müdigkeit abzuschütteln. Sie beschloss, sich ein paar Minuten Ruhe zu gönnen, bevor sie nach ihm suchen würde. Nur ein paar Minuten ausruhen.
13
Als Lukas nach dem scheinbar endlosen Abwasch auf die alte Holzuhr blickte, die an der Wand über dem Kühlschrank hing, bestätigte sich seine Befürchtung, dass es zwei Stunden gedauert hatte, die Küche in Ordnung zu bringen. Es war schon fast halb zehn. Lukas war sich nicht sicher, ob er Ben dafür hassen oder dankbar sein sollte, dass er ihn nach der Halbzeit alleine hatte abwaschen lassen.
Er hängte das mittlerweile durchnässte Geschirrtuch an die Halterung neben dem Waschbecken und verließ mit einem von Herzen kommenden Seufzen die Küche. Im Haus war es mucksmäuschenstill geworden, was wohl bedeutete, dass er wenigstens für den Rest des Abends seine Ruhe haben würde. Das dachte er jedenfalls, bis ein ohrenbetäubend lautes Geräusch durch das Haus dröhnte.
Als das Ohrensausen nach ein paar Sekunden wieder abklang, erkannte er, dass es eine Glocke gewesen war. Und als er sich umdrehte, sah er nur zwei Schritte entfernt einen langhaarigen, leicht verpeilt wirkenden Typen neben einer riesigen Kuhglocke stehen.
Lukas sprach ihn an. »Was machst du da?«
»Sorry, falls ich dich damit erschreckt hab. Ich mag die Glocke auch nicht besonders, aber diesen Monat hab ich den Job. Shit happens, nicht wahr? Ich bin übrigens Mücke«, sagte er und hielt ihm die Hand hin.
Lukas schüttelte sie kurz und versuchte die knappe Sekunde Blickkontakt zu nutzen, um zu erkennen, ob dieser Bewohner genauso hirngewaschen war wie jene, die er bisher kennengelernt hatte. Lukas wusste nicht, ob er nur wegen seiner langen Haare und dem dazu nicht wirklich passenden, knabenhaften Gesicht ziemlich eigensinnig wirkte, oder ob er tatsächlich eher ein Außenseiter war, auf jeden Fall war er Lukas auf Anhieb sympathisch.
»Freut mich, Mücke. Wie kommst du denn auf den Namen, wenn ich fragen darf?«, entgegnete Lukas und hatte im selben Augenblick das Gefühl, dass er mal wieder in ein Fettnäpfchen getreten war. »Oh, oder hat deine Mutter ... entschuldige, ich bin ein bisschen durcheinander im Moment, also du heißt einfach Mücke, alles klar«, fügte er schnell hinzu und stellte erleichtert fest, dass Mücke überhaupt nicht beleidigt war. Stattdessen grinste er ihn an und das Grinsen schien wirklich von Herzen zu kommen.
»Ich heiße eigentlich Mikael, aber weil die meisten den Unterschied zwischen Mikael und Michael nicht raffen, wurde irgendwann Mücke draus. Könnte aber auch an meinen insektenartigen Augen liegen, dass der Name sich in die Richtung entwickelt hat«, sagte Mücke und blickte ihn mit seinen Glupschaugen durchdringend an.
Lukas wusste nicht, ob er jetzt lachen durfte oder sogar musste und entschied, einfach vom Thema abzulenken. Da gab es nämlich tatsächlich etwas, was ihn im Moment mehr interessierte als diese seltsamen Glupschaugen.
»Was hat es mit der Glocke denn auf sich?«, fragte er Mücke.
Und kaum hatte er die Frage ausgesprochen, hörte er vom oberen Stock Schritte. Es schienen mit jeder Sekunde mehr zu werden, so als ob gerade eine Armee dabei war, sich zu formieren. Statt Lukas zu antworten, zeigte Mücke mit dem Finger nach oben und gab Lukas damit zu verstehen, dass die Antwort schon im Anmarsch war. Kurz darauf tauchten die ersten zwei Bewohner im Treppenhaus auf, gefolgt von weiteren zwei und noch zwei und noch zwei.
Lukas brauchte nicht weiter zu fragen, was er jetzt tun musste, denn der kleine Menschenstrom riss ihn einfach mit und wenige Augenblicke später fand er sich in deren Mitte im Gemeinschaftsraum wieder. Außer ein paar einzelnen Kerzen und dem Feuer im Kamin auf der anderen Seite des Raumes war es dunkel, vor allem der riesige Tisch in der Mitte des Raumes mit den unzähligen Stühlen war nur schemenhaft zu erkennen. Dennoch gingen die Bewohner so zielsicher auf die Stühle zu, dass Lukas sicher war, dass jeder seinen eigenen Platz haben musste. Wo sein Platz in diesem Heim wohl sein würde?
»Du kannst dir einen der freien Plätze aussuchen, es spielt keine Rolle, wo du sitzt. Aber du solltest ihn dir dann merken und immer den gleichen benutzen. Wir sind hier wie ein Puzzle, jedes Teil an seinem Platz«, flüsterte ihm ein Typ zu, den er in der Dunkelheit kaum erkennen konnte. Hatte Lukas bei der Aussage mit den Puzzleteilen so etwas wie einen sarkastischen Unterton gehört oder lag es nur an seinem eigenen Eindruck von diesem Ort?
Nachdem er Lukas aufgeklärt hatte, ging er eiligen Schrittes zum Tisch und nahm neben den einzigen zwei Personen Platz, die noch nicht saßen. Lukas war erleichtert, dass das sehr spärliche Licht diesen Leuten hier seinen Gesichtsausdruck nicht offenbarte, während er sich mit zögernden Schritten dem übergroßen Holztisch näherte und sich schließlich für den mittleren der drei freien Plätze entschied. Wenn er schon die Wahl hatte, saß er lieber ohne eine der schrägen Figuren als Nachbar. Die größere der beiden noch stehenden Gestalten zog den Stuhl heran und setzte sich ebenfalls, während die andere sich vom Tisch entfernte, etwas Hammerartiges von einer Halterung an der Wand nahm und auf den großen Gong neben dem Fenster schlug. Das dumpfe Geräusch des Gongs erfüllte den Raum während weniger Sekunden und verstummte wieder. Komplette Stille kehrte ein, niemand schien sich noch zu bewegen oder auch nur zu atmen. Dann erklang eine helle Frauenstimme.
»Das eine oder andere Gemeinschaftsmitglied hast du ja mit Sicherheit bereits vor und während des Abendessens kennengelernt. Nun möchten wir dich im Namen der gesamten Gemeinschaft nochmals von ganzem Herzen und sozusagen hochoffiziell willkommen heißen.«
Wieder kehrte Stille ein. Dann das leise Zischen eines Streichholzes, das im selben Augenblick die Gesichter der Bewohner offenbarte. Langsam schwebte der kleine Lichtkegel durch die Luft bis zur Mitte des Tisches, erlosch, flammte praktisch im selben Moment wieder auf und verharrte auf dieser Stelle.
»Gerne übergebe ich nun das Wort unserem Gemeinschaftsobersten und Heimleiter Christian.«
Ein lautes Räuspern ließ einige der Bewohner zusammenschrecken.
Das Licht der Kerze in der Tischmitte erhellte immer nur einen Teil seines Gesichts, während der Heimleiter den Blick auf Lukas richtete und seine Rede hielt.
»Lieber Lukas, ich freue mich, dich im Namen aller Mitglieder bei uns in der Gemeinschaft begrüßen zu dürfen. Bestimmt ist es dir nicht entgangen, dass wir hier einer gewissen Struktur folgen. Am Anfang dürfte dir das wie den meisten etwas seltsam vorkommen, aber schon bald wirst du einsehen, dass unsere Lebensart viel normaler ist als das, was oft in der Welt ›draußen‹ vor sich geht. Nicht wahr, liebe Gemeinschaft?«
Dieses Mal kehrte keine Stille ein, sondern ein kollektives, lautes »So ist es!«, als hätten alle nur auf diesen Moment gewartet. Lukas versuchte zu erkennen, ob es auch einige gab, die sich nicht anschlossen, doch dazu war es nach wie vor zu dunkel.
»Denn wir sind eine Gemeinschaft«, sagte Christian mit fester, überzeugter Stimme.
»Ich werde nun nacheinander Namen aufrufen und bitte euch, eine unserer Regeln zu nennen, sobald ihr dran seid. Bitte schaut, dass ihr euch nicht wiederholt, wir wollen unseren Neuen ja nicht gleich überfordern«, fuhr der Heimleiter fort und warf ein Lachen in die Runde, das umgehend erwidert wurde. Irgendetwas schien Lukas Rücken empor zu krabbeln. Er schüttelte sich angewidert, und als das Krabbeln nicht aufhörte, wurde ihm klar, dass es kein Insekt, sondern Gänsehaut war.
Der Heimleiter blickte auf den Bewohner, der am nächsten von Lukas saß und sagte laut seinen Namen. »Henry!«
Die Antwort folgte prompt: »Tu so selten wie möglich etwas allein«
Der nächste Name wurde genannt. »Alexia!«
»Füge dich stets in die Gemeinschaft ein«
»Kai!«
»Hilf, wo immer du kannst«
»Andreas!«
»Verlasse niemals allein das Heimgelände.«
»Das würde ich gerne noch etwas lauter hören.«
»Verlasse niemals allein das Heimgelände!«
»Jana!«
»Rede niemals über die Substanzen, die dich hier hingebracht haben.«
»Mikael!«
»Behalt immer das Ziel im Auge.«
»Klaus!«
»Befolge die Regeln in jeder Phase, egal ob schwarzer oder weißer Schütze.«
»Lena!«
Auf diesen Namen folgte keine Antwort. Lukas begann, die Sekunden zu zählen.
Vier, fünf, sechs, sieben.
Dann erklang wieder die Frauenstimme von zuvor, leise, beinahe flüsternd.