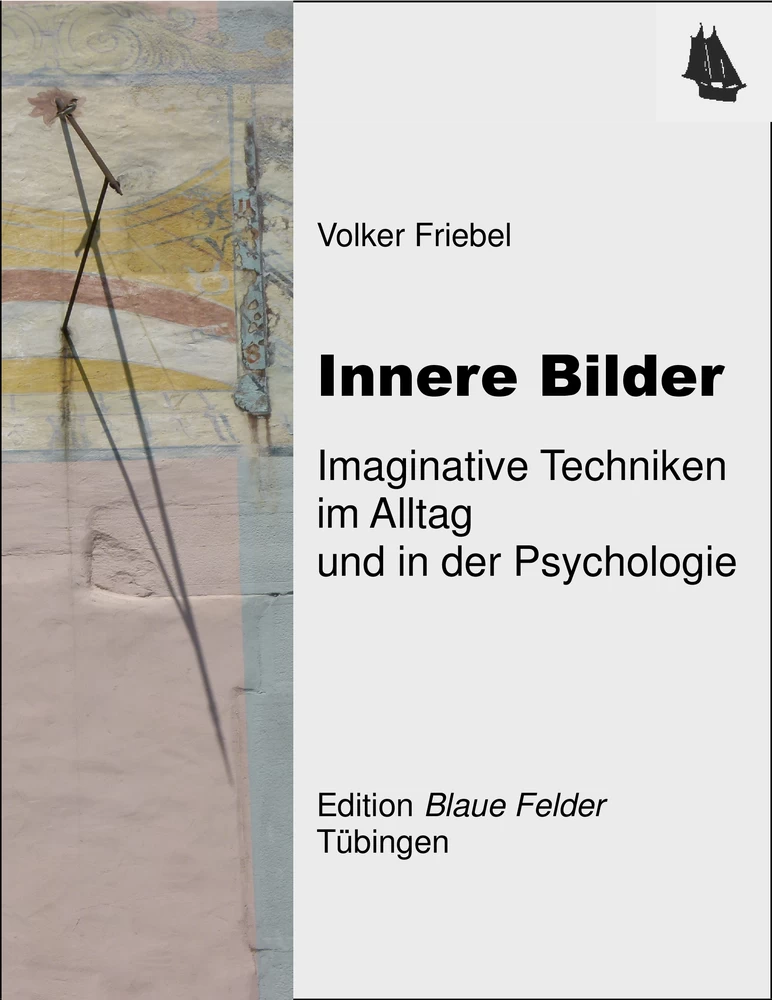Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
„Die Berechenbarkeit der Welt, die Ausdrückbarkeit alles Geschehens in Formeln – ist das wirklich ein „Begreifen“? Was wäre wohl an einer Musik begriffen, wenn alles, was an ihr berechenbar ist und in Formeln abgekürzt werden kann, berechnet wäre?“
Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1886/87
Weshalb die Beschäftigung mit Imagination? Bilder und Vorstellungen sind unser Erleben, wir konstruieren in ihnen unsere Welt. Zeichen oder Worte bedeuten immer bereits eine Abstraktion von der persönlichen Erfahrung – sie sollen ja von anderen Menschen verstanden werden –, sie dienen der Mitteilung, der Kommunikation nach außen, müssen daher überindividueller Natur sein. Das Wort „Meer“ wird von allen Menschen etwa gleich verwendet. Die Vorstellungsbilder die sich dabei einstellen, unterscheiden sich aber sehr.
Innere Bilder sind immer privat. Wenn wir sie zu beschreiben versuchen, kommunikativ nach außen bringen wollen, geschieht das über weitgehend genormte Worte oder Zeichen. Die persönliche Erfahrung kann so nie ganz übermittelt werden. Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Denn Bilder sind die Sprache nach innen. Sie sind genauer, lebendiger, empathischer als Worte zu sein vermögen. Wenn wir in unserer Sprache emotional werden, geschieht das deshalb über die Annäherung an Bilder, über eine Sprache in Bildern. Über diese Sprache der Bilder wirken wir am nachdrücklichsten auf andere ein – und auf uns selbst.
Mag die Beschäftigung mit inneren Bildern zunächst auch wie ein Rückzug ins Private erscheinen, reichen sie über ihren Ausdruck in einzelnen Menschen doch in alle Bereiche der Gesellschaft hinein. Als „Visionen“ religiöser und politischer Führer sind sie für die besten und schlimmsten Taten der Menschheit verantwortlich – denn Träume, denn innere Bilder bewegen die Welt; die Bemühungen der „Realisten“ hinken ihnen immer nur hinterher.
In diesem Buch soll eine Darstellung der Grundlagen von Imagination (Buchteil 1) und ein Abriss einiger anderer Bereiche erfolgen, in denen Imagination wichtig ist (Buchteil 2): Zwar können die Abschnitte über Imagination in den psychotherapeutischen Schulen (Buchteil 3) und über die Praxis der Imagination in der Psychologie (Buchteil 4) auch davon unabhängig gelesen werden, die beiden ersten Buchteile greifen aber doch immer wieder auch in anwendungsrelevante Themen hinein, so dass sich ihre Lektüre auch für Praktiker lohnen wird.
Die Beschäftigung mit inneren Bildern hat mich nun viele Jahre begleitet. Sie ist so wenig langweilig geworden wie das Leben und hat sich verändert mit ihm. In der Biologie bezeichnet „Imago“ das fertig ausgebildete geschlechtsreife Insekt nach der letzten Häutung. Eine Raupe, eine Puppe, ein Schmetterling, Imago: Wer weiß, wohin er fliegt in der Welt.
Volker Friebel, Tübingen im Frühling 2000
Zur Neu-Ausgabe 2015
Für die Neu-Ausgabe des Buchs wurde der Text durchgesehen und hier und da leicht überarbeitet.
Grundlagen innerer Bilder
Die Innenseite der Welt
„Gehirne – so lautet meine These – können die Welt grundsätzlich nicht abbilden; sie müssen konstruktiv sein, und zwar sowohl von ihrer funktionalen Organisation als auch von ihrer Aufgabe her, nämlich ein Verhalten zu erzeugen, mit dem der Organismus in seiner Umwelt überleben kann.“
Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit, 1997
„Die Welt, soweit wir sie erkennen können, ist unsere eigene Nerventhätigkeit, nichts mehr.“
Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1880-1881
Ein Schmetterling auf der Distel: Licht trifft auf ihn, manche Spektren werden aufgenommen, andere zurückgeworfen, je nach Form und Oberflächenbeschaffenheit des Falters. Lichtwellen der zurückgeworfenen Frequenzbereiche treffen auf die Sinneszellen meines Auges, reizen dort Fotorezeptoren. Chemische Veränderungen lösen Nervenimpulse aus, diese laufen über die Sehbahn in mein Gehirn, wo sie bearbeitet werden, hinter- und nebeneinander, rückbezüglich.
Die Impulse der Nervenzellen enthalten selbst keinen Schmetterling mehr, keine Form, keine Farbe, keine Struktur. Sie feuern oder sie feuern eben nicht. Das Gehirn empfängt eine Folge, ein Muster aus Nervenimpulsen und setzt daraus in vielen Verarbeitungsschritten in mir den Schmetterling und die Distel zusammen; erst jetzt, nach mehreren Umsetzungen in andere Modalitäten, „sehe“ ich ihn. Jedes Bild, das ich sehe, ist ein „inneres“ Bild: Wir sehen nur „innen“.
Der Begründer der Sinnesphysiologie, Johannes Müller (1801-1858), formulierte das „Gesetz der spezifischen Sinnesenergien“. Danach bestimmt nicht der Reiz die Natur der Sinnesempfindung, sondern die Sinnesrezeptoren, die durch diesen gereizt werden. Ob Fotozellen Licht empfangen, elektrisch oder mechanisch stimuliert werden: Jede Reizung der Fotozellen bewirkt eine visuelle Empfindung; und jede Reizung der Hörzellen ein auditives Erleben. Entsprechendes gilt für die weitere Verarbeitung: Auch Areale des Gehirns können elektrisch gereizt werden. Eine Stimulation der primären Zonen des okzipitalen Kortex, wo die ersten Verarbeitungszentren des visuellen Systems liegen, bewirkt das Auftreten einfacher visueller Halluzinationen wie Blitze, züngelnde Flammen oder farbige Flecke (Lurija 1992).
Wichtig ist, welche Zellen gereizt werden; wie diese Reizung zu Stande kommt, ist unwichtig. Das Gehirn kennt den Bauplan des Nervensystems: Einer Reizung der Sinnes- oder Verarbeitungszellen des visuellen Systems ordnet es „Sehen“, einer Reizung des auditiven Systems ordnet es „Hören“ zu – entsprechend erleben wir ein Bild oder einen Ton.
Die Wahrnehmungsmodalität (Hören, Sehen, Schmecken, Tasten, Riechen) ist ein Konstrukt unseres Gehirns, sie liegt nicht in den Nervenimpulsen begründet, sondern allein im immer schon vorhandenen Wissen des Gehirns vom Ursprung der Nervenimpulse. Die Impulse aber tragen kein Abbild eines Schmetterlings in sich. Bilder oder Töne müssen aus der Abfolge des Rezeptionsstroms und dem vorhandenen Wissen über die Herkunft der Nervenimpulse erst konstruiert werden.
Roth (1997) unterscheidet deshalb drei Welten: Die Außenwelt, die Welt der neuronalen Impulse im Gehirn, die Erlebniswelt. Unser Gehirn steht als neuronales System in der Mitte. Ihm sind nur die eigenen Erregungen bekannt, und es kennt seinen Bauplan. Aus diesen Vorgaben heraus erschließt es die Existenz eines Körpers und einer Welt um diesen Körper herum, und setzt das Erschlossene in sich als Erlebniswelt um.
Die innere Erlebniswelt ist dabei nicht etwa ein Abbild der äußeren Welt. Sie ist eine Interpretation von Nervenimpulsen und bezieht sich nur zum kleinen Teil direkt auf Außenreize. Einer Sinneszelle des Auges stehen etwa 100.000 Nervenzellen im Gehirn zur Auswertung der von ihr gelieferten Impulse gegenüber. Die massivsten Verbindungen im Gehirn sind Assoziationsfasern, Verbindungen zwischen einzelnen Hirnteilen, nicht etwa Verbindungen von außen nach innen oder umgekehrt. Wir nehmen nicht einfach das wahr, was „draußen“ ist, sondern interpretieren Impulse, die wir als aus der Außenwelt stammend einstufen.
Diese Interpretationen richten sich nach der Erfahrung, die im Laufe der Evolution in unserem Körper und Nervensystem Struktur angenommen hat, festgehalten in der Gestalt unserer Gene. Und da ist die subjektive Erfahrung des einzelnen Menschen. Wenn ich bestimmte Impulsmuster als rund interpretiere, danach greife und mich an Kanten verletze, wird sich meine Interpretation verändern. Wahrnehmungen sind so zu allererst einmal Hypothesen.
Im Alltag genügen mit einiger Vorerfahrung oft schon wenige Sinnesdaten, um in uns ein vollständiges Wahrnehmungsbild zu erzeugen. Fehlende Daten werden einfach aus dem Gedächtnis oder durch Spekulation ergänzt. „Je vertrauter mir eine Situation oder Gestalt ist, desto weniger „Eckdaten“ benötigt mein Wahrnehmungssystem, um ein als vollständig empfundenes Wahrnehmungsbild zu erzeugen, das zu diesen Eckdaten paßt.“ (Roth 1997): Innere Wahrnehmungsbilder entsprechen also nur teilweise äußeren Objekten; fast immer sind große Teile dessen, was wir erleben, Zutaten aus der internen assoziativen Aktivität des Gehirns.
Und nicht alles, was im „Originalbild“, im äußeren Objekt der Sinneswahrnehmung enthalten ist, wird in seine innere Repräsentation umgesetzt. Perrig, Wippich & Perrig-Chiello (1993) berichten über einen Versuch, bei dem ein Gesicht visuell dargeboten wurde, in das ein Ritter mit Lanze und Pferd eingearbeitet war. Der Ritter wurde von den Wahrnehmenden nicht erkannt. Das Bild wurde weggenommen, die Versuchspersonen gebeten, es sich nun innerlich vorzustellen. Das gelang. Aber niemand konnte in diesem Vorstellungsbild den Ritter entdecken, auch nicht als sie nun informiert wurden, dass so etwas in der visuellen Vorlage integriert war. Erinnerungsbilder enthalten also nur Elemente des Originalbildes, die vorher bewusst analysiert worden sind.
Aus den Analysen der Impulse unserer Sinneszellen, aus unseren Ergänzungen und Assoziationen dazu, konstruieren wir die Welt. Sie ändert sich mit unseren Erfahrungen. Unter den individuellen Erfahrungen unseres Menschenlebens aber liegen die Erfahrungen des Lebens selbst, wie sie sich festgeschrieben haben in unseren Genen.
„Unsere vor jeder individuellen Erfahrung festliegenden Anschauungsformen und Kategorien passen aus ganz denselben Gründen auf die Außenwelt, aus denen der Huf des Pferdes schon vor seiner Geburt auf den Steppenboden, die Floße des Fisches, schon ehe er aus dem Ei schlüpft, ins Wasser paßt“, so schrieb Konrad Lorenz bereits 1941 (nach Eibl-Eibesfeldt 1995): Und: „Die Evolution, obwohl grundsätzlich nicht zweckgerichtet, ist ein Erkenntnisvorgang.“ (Lorenz 1983).
Der Aufbau innerer Bilder (und Töne, Empfindungen) aus den Impulsen der Sinnes- und Verarbeitungszellen steht aber sicherlich nicht am Anfang der Evolution. Zunächst einmal scheint die Instanz, die die einzelnen Wahrnehmungen zusammenfasste, integrierte, das Verhalten gewesen zu sein: Der Einzeller, die Pflanze, das „niedere“ Tier nimmt etwas wahr und reagiert unmittelbar darauf.
Beim Menschen und den anderen Säugern, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch bei anderen Tieren, ist eine integrative Instanz zwischen Wahrnehmung und Verhalten getreten: das subjektive Erleben, wie es sich im Aufbau innerer Vorstellungen und ihrer emotionalen Bewertung ausdrückt. Und mindestens beim Menschen sind neben die Bilder, die sich aus den Impulsen von Sinneszellen aufbauen, Bilder getreten, die einen Ausfluss der internen Aktivität des Gehirns darstellen, ohne Bezug auf aktuell stattfindende Wahrnehmungen.
Entscheidend ist dabei gerade diese integrative Funktion von Bildern und Gefühlen. Organismus und Gehirn sind im Laufe der Evolution sehr komplex geworden, haben sich immer weiter differenziert und spezialisiert. Gefühle und Bilder sind wie notwendige Gegenströmungen zu dieser Entwicklung. Sie globalisieren, vereinheitlichen und stellen das Ergebnis ihrer integrativen Leistung, das Bild und das Gefühl, den vielen Untersystemen als Gesamtbild der gegenwärtigen Ereignisse im kognitiven System zur Verfügung.
Die Frage, ob das ganze subjektive Erleben nur eine Begleiterscheinung des materiellen Geschehens im Gehirn ist oder ob es die wirkende Kraft sein kann, der das materielle Geschehen lediglich folgt, stellt sich gar nicht, wenn das Gehirn nicht als geschlossene Einheit, sondern als Vielheit betrachtet wird: Bilder sind die integrative Begleiterscheinung der Arbeit vieler oder aller Untersysteme und wirken als integrative Gesamtdarstellung auf die Arbeit der einzelnen Untersysteme zurück.
Sowohl innere Bilder wie Gefühle können als integrative Gesamtdarstellung verstanden werden. Aber sie unterscheiden sich voneinander. Gefühle werden wesentlich mit dem limbischen System in Zusammenhang gebracht, einer weitgestreckten Struktur unterhalb der Hirnrinde. Dieses kann als Bewertungssystem betrachtet werden. Die Grundgefühle Glück, Traurigkeit, Wut, Furcht und Ekel und die ganze daraus abgeleitete Palette unseres Gefühlslebens sind eine Stellungnahme unseres Gehirns, unserer ganzen bisherigen Erfahrung, zum aktuell Erlebten. (In Klammern sei festgehalten, dass das relevante Bewertungssystem des Gehirns mit seinen wesentlichen Auswirkungen auf das Verhalten subkortikal angesiedelt ist, weit weg von allem, was mit Rationalität und Bewusstsein zu tun hat. Und in Klammern sei fortgesetzt, dass die Informationen für diese Bewertungen aus der Großhirnrinde bezogen werden und die Bewertungen selbst wieder in die kortikale Informationsverarbeitung einfließen.) „Das Wirken des limbischen Systems erleben wir als begleitende Gefühle, die uns entweder vor bestimmten Handlungen warnen oder unsere Handlungsplanung in bestimmte Richtungen lenken. [...] Wer nicht fühlt, kann auch nicht vernünftig entscheiden und handeln.“ (Roth 1997).
Bildhafte Vorstellungen sind offensichtlich nicht so unmittelbar als Bewertungen zu verstehen wie Gefühle. Sie können Ausdruck von Bewertungen sein – wie die Bilder, die sich bei der Vorstellung einer unangenehmen Situation einstellen –, und sie können Grundlage von Bewertungen sein – wie jede aktuelle Wahrnehmung oder jede Vorstellungsfantasie. Jedenfalls sind sie die Instanz, auf die sich die Bewertungen beziehen. „Unter“ den Gefühlen liegen die Bilder. Die stärkere Bildhaftigkeit von Wörtern geht mit stärkerer Emotionalität einher (Campos, Marcos & Gonzalez 1999).
Grundsätzlich sollten die Hirnprozesse auch hier interaktiv und nicht einfach sequentiell verstanden werden. So ist aus der Sozialpsychologie bekannt, dass Bewertungen durchaus bereits einen Einfluss auf die Wahrnehmung haben, beispielsweise schätzen arme Menschen ein Geldstück größer ein als reiche. Jede Vorstellung wird so auch Einflüsse des emotionalen Bewertungssystems zeigen und umgekehrt auf dieses zurückwirken. Beides baut sich miteinander, sich gegenseitig beeinflussend auf – mit dem Beginn bei den Bildern. Bilder und Vorstellungen aber sind konkreter als Gefühle, die eher eine vage Gesamtdarstellung des augenblicklichen Zustands abgeben. Um zielgerichtet handlungsleitend werden zu können, müssen sie sich in Bildern manifestieren. Und hier wird die enge Beziehung zwischen subjektiven Empfindungen und Motivation offensichtlich.
Bilder wirken so auch als Vermittlung zwischen dem Gefühl (der Bewertung) und einer zielgerichteten Handlung. Uns wird das nicht immer bewusst, wir werden eher einen direkten Zusammenhang beispielsweise zwischen dem Gefühl der Angst und einer Fluchtreaktion spüren. Dass sich in einer Befragung zur Situation Vorstellungsbilder einstellen, könnte so als Ergebnis eben der kognitiven Arbeit aufgrund der Befragung und nicht als automatischer selbstverständlicher Prozess, den es nur aufzudecken gilt, verstanden werden.
Hierzu sei auf die Übersichten von Kunzendorf (1991) sowie Dadds und Mitarbeiter (1997) verwiesen, die zeigen, dass selbst so „trockene“ Phänomene wie die klassische Konditionierung nach Pawlow durch innere Bilder vermittelt werden. Klassische Konditionierungen gelingen nämlich nicht immer bzw. bei allen Versuchspersonen gleich gut, und zwar weil manche Menschen (oder Tiere) nicht oder nicht lebendig genug antizipieren. Die klassische Konditionierung beispielsweise der Herzrate war erfolgreicher bei Menschen mit lebhafteren Bildern. Imagination kann klassische Konditionierung beim Menschen fördern oder hemmen, mentale Bilder können unkonditionierte und konditionierte Stimuli ersetzen. Kontingenzbewusstsein fördert zwar die Konditionierung, braucht nach der Konditionierung aber nicht mehr bewusst erinnert zu werden – die Assoziation bleibt trotzdem bestehen (Fulcher & Cocks 1997): Immer wieder wird von Asthmatikern oder Menschen mit Pollenallergien berichtet, deren Anfall bereits durch die Vorstellung beispielsweise einer frühlingshaften Blumenwiese ausgelöst werden kann.
Im Kino laufen die Bilder auf einer großen Leinwand, die Menschen sitzen in Reihen davor. Wir können diese Zuschauer als die vielen Untersysteme im menschlichen Gehirn betrachten, die über den Film in einen gewissen Einklang gebracht werden, deren Arbeit sich über diesen Bezugspunkt integriert. Nicht alle gehen ins Kino, manche verstehen Filme gar nicht. Die Anwesenden aber arbeiten – anders als im Hollywoodkino – am Film selbst mit. Ein interaktives Kino: In uns ist es schon immer Wirklichkeit gewesen.
Was gespielt wird, ist ein Film über die Welt. Selbst Wahrnehmungsbilder sind immer schon eine Interpretation, wie die Versuche von Libet zeigten (siehe in Roth 1997 oder Nørretranders 1994), sind der Versuch einer Integration, einer Simulation dessen, was sich tatsächlich ereignet. Unvermitteltes Erleben ist gar nicht möglich. Wir erleben immer schon die Bedeutung, die subkortikal die Neukonstruktion unserer Sinneserlebnisse aus den Impulsen unserer Nervenzellen begleitet und in diese Neukonstruktion Eingang findet. Wir sehen keine Lichtmuster, sondern immer schon den Schmetterling auf einer Distel. Und wir lächeln dabei.
Bilder ohne Beteiligung der Sinnesorgane sind „innere Bilder“ im engeren Sinne. So werde ich den Begriff künftig gebrauchen. Sie verfolgen sicherlich ähnliche Zwecke wie Wahrnehmungsbilder: Das Kino und die Zuschauer sind dieselben: Immer sind wir auf der Innenseite der Welt. Dabei gibt es auch Unterschiede. Um diese kennenzulernen, begeben wir uns weiter hinein ins Gehirn.
Gehirn und inneres Bild
„[...] Eine Unzahl von einzelnen Bewegungen werden vollzogen, von denen wir vorher gar nichts wissen, und die Klugheit der Zunge z.B. ist viel größer als die Klugheit unseres Bewußtseins überhaupt. Ich leugne, daß diese Bewegungen durch unseren Willen hervorgebracht werden; sie spielen sich ab, und bleiben uns unbekannt [...].“
Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1881
Für die Speicherung von Wissen wird ein Netzwerk kortikaler Areale im Frontal- und Temporallappen des Gehirns angenommen, das bei der semantischen Verarbeitung von Bildern und Wörtern gleichermaßen beteiligt ist. In diesem Netzwerk vollzieht sich die Verarbeitung und die Speicherung sowohl visuell-anschaulicher als auch abstrakt-funktionaler Wissensaspekte, wie sie sich etwa der analogen (sinneshaften) und der propositionalen (semantischen) Repräsentation zuordnen lassen (Kiefer 1998).
Die Existenz analoge Repräsentationen konnte im wissenschaftlichen Experiment erstmals bei Rotationsaufgaben nachgewiesen werden. Dabei muss von der Versuchsperson entschieden werden, ob eine um einige Grad gedreht abgebildete Figur die genaue Kopie einer normal stehend abgebildeten Figur ist oder ob es Unterschiede gibt. Es stellte sich heraus, dass die Zeit zur Beantwortung der Aufgabe vom Drehwinkel zwischen Original und Kopie abhängt Dies weist darauf hin, dass die Versuchspersonen die Kopie mental drehen, um den Vergleich anzustellen, dass sie also ein mentales Bild von ihr herstellen (Übersicht in Rösler & Heil 1998): Gute Imaginierer lösen solche Rotationsaufgaben besser als schlechte (Weatherly und Mitarbeiter 1997), ein weiterer Hinweis darauf, dass innere Bilder zum Einsatz kommen.
In der Folge wurde das Thema der mentalen analogen Repräsentation in einer Vielzahl von Untersuchungen behandelt. Gegenstand der Untersuchung ist nun meist die Veränderung von Gehirnaktivität bei der Hervorrufung von Vorstellungen (inneren Bildern) im Vergleich zu einer tatsächlichen Wahrnehmung oder einer tatsächlich durchgeführten Bewegung. Die Herangehensweisen sind verschieden, auch bei der Konzentration auf eine bestimmte Art von Imagination. Zu kinästhetischen Imaginationen verwendeten Deiber und Mitarbeiter (1998) die Positronenemissionstomografie (PET), um Veränderungen der Aktivation kortikaler Regionen festzuhalten: Versuchsteilnehmer sollten sich visuell die Bewegung eines ihrer Finger vorstellen, diese Bewegung zusätzlich tatsächlich ausführen, oder gar nichts tun. Pfurtscheller & Neuper (1997) verwendeten das Elektroenzephalogramm (EEG) zur Feststellung von Aktivitätsänderungen bei Vorstellung einer Handbewegung. Schnitzler und Mitarbeiter (1997) setzten Magnetoenzephalografie zur Untersuchung kinästhetischen Imaginationen von Fingerbewegungen ein.
Sowohl methodisch als auch theoretisch werden in Zukunft vermutlich Erweiterungen des Zusammenspiels Imagination – Hirnaktivität vorgenommen werden. Graf und Mitarbeiter (1998) fanden interessanterweise bei visuellen Imaginationsaufgaben, die eine mentale Rotation verlangten (entweder von sich selbst oder von Objekten), Mitbewegungen des Körpers. Bonnet und Mitarbeiter (1997) erhoben eine – allerdings nur schwache – Erhöhung der EMG-Aktivität bei der Imagination einer Bewegung: Manche eigentlich visuellen Vorstellungen (zumindest von Bewegung) können also auch eine psychomotorische Komponente enthalten. Zumindest teilweise scheinen wir bestimmte Imaginationen also auch über den Körperausdruck wahrzunehmen. Umgekehrt erhoben Sathian und Mitarbeiter (1997) bei einer taktilen Orientierungsaufgabe (Reizung des Zeigefingers) eine Erhöhung des regionalen zerebralen Blutflusses, dessen Lokalisation auf Visualisierungsprozesse zur besseren Diskrimination des Gebiets der taktilen Reizung hindeutet.
Trotz aller noch vorhandenen methodischen Probleme und zu erwartenden notwendigen Erweiterungen der Fragestellung gibt es Erfolge und Übereinstimmung in Forschungsergebnissen. Übersichten wie Decety (1996a, 1996b) gehen deshalb davon aus, dass imaginierte und tatsächliche Bewegung in gewissem Ausmaß dieselben zentralen Strukturen teilen. Cunnington und Mitarbeiter (1996) erhoben in den frühen Komponenten von bewegungsbezogenen kortikalen Potentialen, die etwa 1 bis 2 Sekunden vor Ausführung der Bewegung beginnen und wohl der Bewegungsvorbereitung dienen, keine Unterschiede zwischen tatsächlichen und imaginierten Bewegungen. Bewegungsausführung und Bewegungsimagination generieren ähnliche prämotorische Vorbereitungsprozesse in denselben kortikalen Gebieten. Höllinger und Mitarbeiter (1999) erhoben dies auch bei vorgestellten und tatsächlich ausgeführten Augenbewegungen. Stephan & Frackowiak (1996) zeigten, dass die motorische Imagination einige Charakteristiken mit der motorischen Vorbereitung und zusätzlich weitere mit der motorischen Ausführung teilt. Auch andere Studien bestätigen, dass imaginierte Bewegungen Hirnareale wie bei tatsächlichen Bewegungen aktivieren – im Ausmaß aber schwächer als diese. Die tatsächliche Bewegung aktiviert zumindest in ihren späten Komponenten aber zusätzliche Hirnareale, wie auch die imaginierte Bewegung Hirnareale aktiviert, die nicht an einer tatsächlichen Bewegung beteiligt sind. Aktivationen bei Bewegungsimaginationen betreffen dabei nicht nur das Groß-, sondern auch das für Bewegung besonders zuständige Kleinhirn (Luft und Mitarbeiter 1998): Imaginierte und tatsächliche Bewegung lassen sich so als zwei Kreise verbildlichen, die sich stark überschneiden, von denen aber jeder auch eigenständige Anteile an Gehirnaktivität hat.
Nicht anders ist es zu erwarten. Eine tatsächliche Bewegung muss im Gehirn motorische Durchführungsareale aktivieren, eine imaginierte Bewegung darf dies nicht. Die Beteiligung von Gebieten des Frontalkortex nur bei der imaginierten Bewegung, wie sie von Deiber und Mitarbeitern (1998) gefunden wurde, weist darauf hin, dass es eine lange gemeinsame Strecke von imaginierter und tatsächlicher Bewegung gibt, die letztliche Ausführung der Bewegung dann aber durch den Frontalkortex aktiv gehemmt wird, während die tatsächliche Bewegung von primären motorischen Strukturen aufgenommen und an die Körperperipherie weitergeleitet wird. Pfurtscheller & Neuper (1997) vergleichen ihre Funde – eine EEG-Synchronisation über dem primären sensomotorischen Areal – mit der Planung einer willentlichen Bewegung. Auch die von Kasai und Mitarbeitern (1997) bei Bewegungsimaginationen gefundenen Zunahmen der Amplituden von motorischen evozierten Potentialen, ohne Bewegungsausführung, passt in dieses Bild der Vorbereitung und Erleichterung einer späteren Bewegung durch Vorstellung.
Die Befunde lassen vermuten, dass innere Bilder im Sinne von nicht bewussten motorischen Imaginationen bei der kortikalen Vorbereitung von Handlungen eine Rolle spielen.
Ebenso wie das Verhältnis von Bewegung und Bewegungsvorstellung ist das Verhältnis von Wahrnehmung und bildhaften Vorstellungen einzustufen (Übersicht in Farah 1995): Es gibt starke Ähnlichkeiten und Überschneidungen – aber beide beanspruchen jeweils auch eigene Hirnareale, sind also keinesfalls identisch (so in Kosslyn, Thompson & Alpert 1997, Howard und Mitarbeiter 1998): Imaginierte Bilder und „echte“ Wahrnehmungen können manchmal als nicht oder nur schwer unterscheidbare Informationsquellen wirken: Anyanwu (1997) berichtet über einen Jungen mit lichtsensitiver Epilepsie, der durch mentale Imagination visueller Stimuli in der Lage war, Anfälle bewusst auszulösen. Und jeder Mensch kann durch geeignete Vorstellungsbilder motorische, vegetative und emotionale Veränderungen in sich hervorrufen: Stellen wir uns lebhaft vor, in eine Zitrone zu beißen, dann fließt Speichel und Enzyme werden ausgeschüttet.
Imaginations- und Wahrnehmungsfähigkeit können aber auch ganz auseinandergehen. So berichten Dalman, Verhagen & Huygen (1997) über eine Frau mit kortikaler Blindheit nach Infarkt, die zwar keine visuelle Wahrnehmung mehr hatte, deren visuelle Imagination jedoch intakt war. Chatterjee & Southwood (1995) berichten über drei Patienten mit kortikaler Blindheit, aber der Fähigkeit zumindest aus der Erinnerung visuelle Vorstellungsbilder abzurufen.
Dazu passen die Ergebnisse von D’Esposito und Mitarbeitern (1997): Sie ließen ihre Versuchspersonen Wörter hören, wobei eine Hälfte nur hören, die andere aber beim Hören Bilder zur Wortbedeutung generieren sollte. Es zeigte sich, dass nicht der primäre visuelle Kortex sondern der visuelle Assoziationskortex beim Generieren von Bildern beansprucht wird. Visuelle mentale Imagination scheint demnach eine Funktion des visuellen Assoziationskortex zu sein, wobei die Bildgenerierung asymmetrisch links (nicht etwa rechts) lokalisiert ist.
Wenn Imaginations- und Wahrnehmungsfähigkeit manchmal auch auseinanderfallen können, so zeigen die meisten Patienten mit selektiven visuellen Beeinträchtigungen nach Schäden des kortikalen visuellen Systems jedoch qualitativ ähnliche Beeinträchtigungen sowohl in der mentalen Imagination als auch in der Wahrnehmung (Farah 1995): Imagination und Wahrnehmung haben zumindest einige modalitätsspezifische kortikale Systeme gemeinsam, die bei beiden ähnliche Aufgaben wahrnehmen.
Viele Befunde sind aber oft schwer vereinbar, wahrscheinlich weil je nach genauer Aufgabenstellung und Sinnesmodalität unterschiedliche Hirnareale involviert werden. So ergab eine Studie von Fallgatter, Müller & Strik (1997), die Wörter mit visuellen, akustischen oder taktilen Vorstellungsinhalten verwendeten, in der P300-Komponente unterschiedliche Hirnlokalisationen. Meist rechts orientiert war die visuell-sensorische Modalität, meist links orientiert die taktile Imagination, die akustische lag in der Mitte. Die Autoren folgern daraus, dass den modalitätsspezifischen Imaginationen Aktivität unterschiedlicher neuraler Generatorensembles zugrundeliegt, die möglicherweise modalitätsspezifische primäre kortikale Areale umfassen. Solche Zuordnungen lassen sich dem derzeitigen Stand der Forschung nach aber nur als grobe Annäherung lesen. In Wahrnehmungen und Imaginationen sowie deren Verarbeitung sind sehr viele Hirnareale involviert. Je nach Fragestellung und besonderem Fokus der jeweiligen Studie müssen Ergebnisse so entweder sehr kompliziert oder wenig miteinander vergleichbar ausfallen.
Als Arbeitsmodell kann man davon ausgehen, dass innere Bilder nach ihrer Generierung (Farah 1995 zufolge wahrscheinlich in der posterioren linken Hemisphäre) eine ähnliche Verarbeitungsstrecke im Gehirn durchlaufen wie eine tatsächliche Wahrnehmung. McGuire und Mitarbeiter (1996a) erhoben in einer Aufgabe zur Imagination inneren Sprechens oder inneren Hörens, dass imaginierte Satzartikulation Aktivität in einem Gebiet bedeutet, das sich mit Sprachgenerierung beschäftigt, während Hör-Imagination mit zusätzlicher Aktivität in Gebieten der Sprachwahrnehmung verbunden ist.
„Echte“ Wahrnehmungen sollten überhaupt nicht als wesensverschieden von inneren Bilder betrachtet werden. Das Gehirn bildet die Welt nicht ab, sondern konstruiert sie (Roth 1997): Eingänge über die Sinneskanäle sind dabei Rohmaterial wie die inneren Vorstellungen. Einen wesenhaften Unterschied zwischen ihnen gibt es nicht. Im Gehirn ist jede Modalität nur das Feuern (oder Nichtfeuern) von Nervenzellen; ihre Qualität als Riechen, Hören, Schmecken, Sehen, Fühlen erhalten sie lediglich durch ein Vorwissen über die Lokalisation der Ursprungspotentiale. Etwas wird gehört, weil ein Vorwissen da ist: Diese feuernde Nervenzelle steht mit dem „Ohr“ in Verbindung. Etwas wird gesehen, weil ein Vorwissen da ist: Diese feuernde Nervenzelle steht mit dem „Auge“ in Verbindung. Etwas wird anders, blasser, unwirklicher gesehen, weil ein Vorwissen da ist: Diese feuernde Nervenzelle steht mit keinem Sinnesorgan in Verbindung.
Ein Fehlen dieser Unterscheidungsfähigkeit wird pathologische Auswirkungen auf die Weltkonstruktion der Betroffenen haben. Mit McGuire und Mitarbeitern (1996b) kann es für auditorische und visuelle Halluzinationen bei Schizophrenie verantwortlich gemacht werden: Innere Bilder und inneres Sprechen werden nicht mehr als solche markiert oder erkannt und ihr Ursprung deshalb fälschlicherweise in der Außenwelt postuliert.
Motorische innere Bilder werden wie Handlungsvorbereitungen, sinnesspezifische innere Bilder wie Außenreize unter selektiver Aufmerksamkeit bearbeitet (Frith & Dolan 1996, 1997): Bei tatsächlichen oder imaginativen Wahrnehmungen sind aber Einflussnahmen aus dem präfrontalen Kortex wesentlich, durch die Vorwissen (und sicherlich auch das Wissen um die Unterscheidung des jeweiligen Bildes als Wahrnehmung oder Imagination) je nach Aufgabe regulierend eingreift und so bei motorischen Imaginationen für die Hemmung der motorischen Endstrecke, bei wahrnehmungsartigen Imaginationen für deren Markierung als solche und für die Zuordnung nach „innen“ sorgt (siehe auch Decety 1996b).
Entwicklung der Imagination
„Ene mene mu
und raus bist du!“
Kinderreim
Wahrnehmungsbilder können fast von Geburt an mehr oder weniger gut aufgebaut werden – mentale Bilder vermutlich nicht, sie folgen nach, entwickeln sich aus dem Umgang mit Wahrnehmung heraus. Nach Piaget & Inhelder (1979) können bewegte innere Bilder erst von 7-8-Jährigen erlebt werden, da sie das Stadium der konkreten Operationen voraussetzen. Mentale Bilder sind nach Piaget operationalen Strukturen untergeordnet. Nach den Studien von Foulkes (1982) zeigen Kinderträume im Laufe der Jahre eine Entwicklung von eher statischen Bildern zu Geschichten (ab 5-7 Jahre): Tatsächlich können Kinder aber den Endzustand von Transformationen (beispielsweise Verschiebung einer Kiste auf einer anderen Kiste) oft schon in einem Alter vorhersagen, zu dem sie die Zwischenschritte nicht angeben können. Lautrey & Chartier (1991) halten die Piagetsche Unterordnung kinetischer und transformierender Bilder unter die konkreten Operationen deshalb für zweifelhaft. Vielleicht muss eine getrennte Entwicklung analoger und proportionaler Repräsentationen angenommen werden, wobei die analogen Repräsentationen letzteren vorausgehen und deren Entwicklung leiten, da sie für Transformationen korrekte Endzustände angeben können, zu einem Zeitpunkt zu dem noch kein Wissen darüber vorhanden ist, welche Operationen dazu wie durchgeführt werden müssen. Mit zunehmender kognitiver Entwicklung wird dann weniger auf mentale Bilder und mehr auf propositionale Verarbeitung zurückgegriffen.
Singer & Singer (1992) zeigen in ihrer Monografie zu Spiel und Imagination, dass die ersten Spiele, die – vermutlich – auf Imaginationen beruhen (eine Puppe füttern), bereits im Alter von 12-13 Monaten stattfinden. Zunächst ist die Puppe noch passiv, nur das fütternde Kind aktiv. Nach und nach agiert dann auch die Puppe: Sie redet, geht, füttert eine andere Puppe. Im Alter zwischen 3 und 6 Jahren beginnen gemeinsame Vorstellungsspiele, bei denen Kinder untereinander Rollen verteilen und sich auf verabredete Themen beziehen, beispielsweise die Suche nach einem Piratenschatz.
Solche Spiele mit imaginativem Charakter sind einer Studie von Singer & Singer zufolge positiv mit Freude und Lebhaftigkeit korreliert, negativ dagegen mit Furcht, Trauer oder Müdigkeit. Bei sehr zornigen, ängstlichen oder hyperaktiven Kindern konnte nur selten Vorstellungsspiel festgestellt werden. Kinder, die viel an Spielen imaginativen Charakters beteiligt sind, beteiligen sich auch mehr an tatsächlichem sozialem Spiel. Imaginative Kinder initiieren eher gemeinsame Spiele, sind weniger allein, weniger zurückgezogen oder abweisend. Wie es scheint, entwickeln Kinder, die gut imaginieren können, bessere soziale und kognitive Fertigkeiten: Sie können Erlebnisse besser integrieren, lernen Informationen zu organisieren, sind reflexiver, konzentrierter und anderen Kindern gegenüber sensibler.
Trotz breiter Angebote wählen Jungen lieber Abenteuerspiele mit verwegenen und konflikthaften Inhalten, während Mädchen zu Spielen neigen, die sich mit sozialen Themen beschäftigen, vor allem mit Familienthemen wie der Rolle von Vater, Mutter und Kind. Mädchen scheinen dabei intimer mit ihren Figuren als Jungen, die mehr von außen beschreiben. Interessanterweise hat die Veränderung in den Fernsehklischees im imaginativen Spiel der Kindergartenkinder ebenfalls eine Veränderung bewirkt: Mädchen neigen heute mehr als früher dazu, sich mit Heldinnen zu identifizieren, wie sie in Zeichentrickfilmen und Comics vermehrt auftauchen. Eine verstärkte Hinwendung von Jungen zu häuslichen Themen ist aber nicht zu beobachten.
Hoch differenziertes Spielzeug (wie perfekt vorkonstruierte Roboter) wird zwar anfänglich gern angenommen, erhält bald aber nur noch wenig Aufmerksamkeit. Offenbar bieten Materialien wie Legos oder Bauklötze längerfristig mehr Ansatzpunkte für die Imagination.
Im Alter zwischen 2 und 6 Jahren haben viele Kinder imaginäre Spielgefährten: andere Kinder oder Tiere oder Fantasiewesen. Bei jüngeren Kindern wird für imaginäre Gefährten manchmal auch ein Stuhl am Tisch sowie Essen und Trinken bereitgestellt. Siegel (1998) berichtet über EEG-Aufnahmen während halluzinierter Erscheinungen, die reduzierte evozierte Reaktionen auf ein blitzendes Licht hinter der Erscheinung aufzeichneten, ganz so, als reduziere die Halluzination die Wahrnehmung des hinter ihr blitzenden Lichts. Imaginäre Gefährten werden also offenbar von vielen Kindern nicht nur für wirklich gehalten, sondern auch wirklich gesehen.
Kinder mit imaginären Gefährten sind überwiegend Einzelkinder oder Erstgeborene, die noch keine Geschwister hatten, als der Gefährte erstmals auftauchte. Die Kinder spielen mit ihren imaginären Gefährten, sie sprechen mit ihnen, wobei sie häufig beide Teile übernehmen, mit normaler Stimme für sich selbst und mit veränderter Stimme für den Gefährten. Irgendwelche ungünstigen Auswirkungen des Lebens mit imaginären Gefährten sind nicht bekannt, eher trifft das Gegenteil zu (Siegel 1998): Im späteren Alter können imaginierte Gefährten noch weiterbestehen – aber die Kinder wissen dann fast immer, dass diese nicht „wirklich“ existieren. Ab etwa 10 Jahren sind die meisten verschwunden.
Auch werden ganze Fantasiewelten aufgebaut, in denen über Monate oder Jahre hin Abenteuer erlebt werden können. Cohen & MacKeith (1991) präsentieren in ihrer Monografie eine Sammlung solcher imaginierter Welten, meist aus den Erinnerungen der späteren Erwachsenen. Da findet sich die Spielzeugstadt eines 8-jährigen Mädchens (berichtet von der 9-Jährigen), in der alle Spielzeuge, die älter als eine Woche sind, ein Haus haben. Alle trinken nur Limonade und essen Erdnüsse. Die Sonne scheint immer, es regnet nie, aber der Rhododendron überlebt. Andere Kinder stellen sich Inseln oder Länder vor, deren Entwicklung sie mit den Jahren verfolgen. Detaillierte Karten imaginierter Länder sind ein Beleg. Dabei sind gemeinsame imaginative Welten häufig. Am bekanntesten geworden ist die Welt der vier Brontë-Geschwister, die sie über Jahre hinweg miteinander entwickelten und teilten: das Fantasieland Angria. Je nach Neigung nahmen sich die Kinder der einzelnen Facetten des Landes an, entwickelten verschiedene Charaktere, bauten die soziale und politische Struktur auf. Später teilten sich die Kinder: Zwei blieben der alten Welt treu, die beiden anderen formten ein neues Land. Während die meisten Fantasieländer im Kindesalter aufgegeben werden, blieben die Brontëländer bis ins Erwachsenenalter erhalten und nahmen Einfluss auf veröffentlichte Geschichten.
Bereits im Kindergarten sind Imaginationsspiele zunehmend durch Fernseherfahrungen der Kinder beeinflusst. Nach Singer & Singer (1992) haben Versuche ergeben, dass dieselbe Geschichte, einmal in Ton und Bild (Video), das andere Mal nur mit Ton (Tonträger) dargeboten, unterschiedliche Auswirkungen auf die kindliche Imagination hat: Bei der Videoversion werden nachher zwar mehr Einzelheiten berichtet, die Kinder bleiben jedoch viel näher an der erzählten Geschichte, während in der Audio-Version die Imagination des Kindes in größerem Ausmaß zum Tragen kommt und die Geschichte viel freier miterlebt wird. Der Einfluss des Fernsehens auf die Imaginationsentwicklung wird deshalb als negativ beschrieben (negativ auch für die Sprachentwicklung und die Kreativität): Auch zeigte sich eine positive Korrelation zwischen der Häufigkeit des Sehens aggressiver Fernsehsendungen und der kindlichen Aggressivität. Selbst in einer 20-Jahres-Nachuntersuchung konnte eine Korrelation zwischen dem häufigen Sehen von Sendungen aggressiven Inhalts und späteren offenen Aggressionen festgestellt werden. Wird von erwachsenen Bezugspersonen mit dem Kind gemeinsam ferngesehen und durch Erklärungen das Gesehene sinnvoll in die vorhandenen Schemata des Kindes gebracht, kann Fernsehen aber bei entsprechend guten Programmen auch bereichernd wirken.
In der mittleren Kindheit, etwa ab dem Schuleintritt, werden das dramatische Spiel und theaterhafte Aufführungen wichtiger (das Psychodrama wurde von Moreno aus seinen Rollenspielen dieser Kinderzeit entwickelt).
Im Laufe der Kindheitsjahre gehen die Imaginationsspiele zunehmend ins Private über und lassen sich schwerer beobachten. Zu Imaginationen werden noch Bilder gezeichnet, jedoch wird immer weniger mit Verbalisationen und Gesten begleitet. Verbalisationen richten sich zunehmend nach innen und werden unhörbar – Imaginationsspiel wird zur mentalen Imagination wie die schon berichteten Fantasiewelten. In den ersten Schuljahren gibt es außerdem eine Bewegung von eher märchenhaften Tagträumen zu Tagträumen mit aggressiven Inhalten. Über die Jahre hinweg tendieren Mädchen eher zu märchenhaften Inhalten, Jungen zu aggressiven Imaginationen.
Die Tagträume von 9-Jährigen sind strukturell denen von Erwachsenen bereits sehr ähnlich. Ab der Pubertät kommen allerdings noch erotische Inhalte dazu, vorübergehend werden auch Horrorfantasien sehr wichtig, und die Häufigkeit aggressiver Tagträume sowie Träume um Schuld nimmt im Erwachsenenalter noch weiter zu. Auch werden Tagträume zunehmend alltagsbezogen und handeln immer weniger von den Märchenwelten der Kinderzeit. Überbleibsel der Imaginationsspiele der Kinder, dem So-tun-als-Ob, können bei den Erwachsenen noch beispielsweise im Fasching, in Umzügen, Mittelalterfesten, Satanskulten und ähnlichem gefunden werden.
Über die weitere Entwicklung der Imagination im Erwachsenenalter liegt eine Quer- und Längsschnittstudie von Giambra & Grodsky (1991) vor, die etwa 2.000 Personen zwischen 18 und 71 Jahren zum Teil über einen Zeitraum von bis zu 8 Jahren mit einem Imaginationsinventar untersuchten. Sowohl im Quer- als auch im Längsschnitt zeigte sich bei den Frauen eine Abnahme der visuellen und auditorischen Imagination in Tagträumen sowie eine Abnahme von deren Lebendigkeit. Bei den Männern war diese Abnahme nicht signifikant, im Längsschnitt stieg bei ihnen die Lebendigkeit von Imaginationen sogar an. Insgesamt wird man aber nach einer frühen Entwicklung im Kleinkindalter, einem Gipfel wohl in der Pubertät eine Abnahme bildhafter Vorstellungen im Erwachsenenalter annehmen müssen. Wie Campos, Perez-Fabello & Gonzales (1999) bei jungen Erwachsenen erhoben, imaginieren Menschen, die sich selbst gute Imaginationseigenschaften zuschreiben, häufiger. Daraus lässt sich ableiten, dass der Einsatz von Imagination im Alltag durch äußere Bestätigung (oder Ablehnung) beeinflussbar ist.
Gedächtnis
„Jedermann klagt über sein Gedächtnis, niemand über seinen Verstand.“
Francois de La Rochefoucauld, Reflexionen oder moralische Sentenzen und Maximen, 1665
Der große russische Neuropsychologe Alexander Lurija berichtet über einen Menschen mit perfektem Gedächtnis, den er seit den 1920er Jahren über einen Zeitraum von 30 Jahren beobachten und systematisch untersuchen konnte (Lurija 1995b): Etwas auswendig zu lernen hatte S. nicht nötig, er lauschte beliebigen Wortkolonnen, bat dann und wann, ein Wort oder eine Zahl genau zu wiederholen – und war dann in der Lage die Reihen durchaus auch in umgekehrter Reihenfolge aufzusagen, von hinten nach vorn, dargebotene tabellarische Darstellungen auch quer. Das Material war gleichgültig, wichtig war jedoch eine Pause von zwei bis drei Sekunden zwischen den einzelnen Begriffen.
Lurija schreibt: „Einige dieser Tests wurden fünfzehn, sechzehn Jahre nach dem ursprünglichen Einprägen der Reihe und ohne jede vorherige Ankündigung durchgeführt. In solchen Fällen setzte sich S. hin, schloß die Augen, machte eine Pause und sagte dann: „Ja, ja ... das war bei Ihnen in der Wohnung ... Sie saßen am Tisch, ich im Schaukelstuhl ... Sie trugen einen grauen Anzug und sahen mich so an ... nun ... ich sehe, was Sie damals zu mir sagten ...“ – und dann folgte die fehlerlose Wiedergabe der damals vorgelesenen Reihe.“
Das Zitat weist schon auf den Mechanismus hin, der dem perfekten Gedächtnis zu Grunde lag: S. erinnerte in Bildern. „Entweder er sah weiterhin die ihm vorgegebenen Reihen von Wörtern oder Zahlen, oder er wandelte sie in Bilder um.“ Die ungewöhnlich stark ausgeprägte Fähigkeit zum Sehen von Bildern zeigte sich bei S. auch in synästhetischen Reaktionen: Er sah Töne: „Ihm wird ein Ton von 3.000 Hertz und 128 Dezibel gegeben. Er sieht einen Wedel von feuerroter Farbe. Der Stiel des Wedels zerfällt in feuerrote Punkte ...“ Auch Laute und Zahlen verwandelten sich bei ihm in innere Bilder.
Bei den Tests zeigte sich, dass auch gelegentliche Fehler keine Fehler des Gedächtnisses waren, sondern Mängel der Wahrnehmung, beispielsweise wenn S. die Wortliste an einem schlecht beleuchteten Platz vor sich sah, so dass er die Wörter nicht gut erkennen konnte. Veränderte er das Licht in sich, so konnte er die „Fehler“ berichtigen.
S. wurde nach erfolglosen Versuchen in einigen Berufen Gedächtniskünstler und vervollkommnete seine Techniken. Alle Hilfen aber bezogen sich auf die schnellere Herstellung oder das bessere Ablesen innerer Bilder. „Früher mußte ich mir, um mir etwas einzuprägen, die ganze Szene vorstellen. Jetzt genügt es mir, irgendein Detail herauszugreifen. Wenn man mir das Wort „Reiter“ gegeben hat, brauche ich mir nur einen Fuß mit einem Sporn vorzustellen [...] So haben sich meine Bilder ganz schön verändert. Früher waren sie deutlich und erscheinungsgetreu. Die jetzigen Bilder tauchen nicht so klar und deutlich auf wie in früheren Jahren ... Ich versuche, nur noch ein Detail auszuwählen, das nötig ist, um mich an das Wort zu erinnern“.
Über die Konstruktion zugehöriger innerer Bilder gelang S. auch das Behalten sinnloser Silben, sinnloser mathematischer Formeln oder beispielsweise die Wiedergabe mehrerer Strophen der „Göttlichen Komödie“ in richtiger Betonung und Aussprache des ihm fremden Italienisch 15 Jahre nach dem Einprägen.
Wie werden Informationen in unserem Gehirn gespeichert? Zwei Möglichkeiten stehen in Konkurrenz miteinander: die Modelle der propositionalen und der analogen Speicherung (Wessells 1994): Mehr und mehr setzt sich aber die Überzeugung durch, dass es nicht zwischen ihnen zu entscheiden gilt, sondern dass beide in unserem Gehirn verwirklicht sind und sich ergänzen. Eine geschichtliche Übersicht dazu bietet Paivio (1995).
Das Modell propositionaler Repräsentation bezieht sich dabei vor allem auf sprachliche oder sprachlich fassbare Zusammenhänge. Propositionen sind dabei Ausdrücke, die Beziehungen zwischen Begriffen bezeichnen. Im Beispiel: LESEN (FRAU, BUCH) legt der erste Begriff (LESEN) die Beziehung zwischen den folgenden fest: er ist der relationale Ausdruck der Proposition. Die beiden Begriffe in der Klammer sind die „Argumente“, deren Beziehung festgeschrieben wird (die Schreibweise ist so festgelegt worden, natürlich wäre sie auch anders wählbar): „Die Frau liest das Buch“ wäre der damit gefasste Zusammenhang. Die propositionale Repräsentation ist also symbolisch aufgebaut: Im Gehirn wird keine lesende Frau abgebildet, sondern verschiedene Begriffe, die etwa unseren Wörtern entsprechen, sowie Beziehungen zwischen diesen Begriffen. Zur propositionalen Repräsentation gibt es ausgefeilte Modelle, die versuchen, auch längeren Sätzen oder nicht auf Anhieb erkennbaren Sinnzusammenhängen gerecht zu werden, was bisher aber nur unvollständig gelingen konnte. Dennoch lassen die zahlreichen Untersuchungen zur propositionalen Repräsentation kaum einen Zweifel, dass ein Teil unseres Wissens in dieser Weise gespeichert wird – oder in einer Weise, die propositionale Repräsentationen in sich enthält.
Studien zum Vergleich des Merkens von Bildern und Wörtern zeigen jedoch, dass propositionale Repräsentationen nicht ausreichen, um unser Wissen zu erklären. Bilder werden, auch über Jahre und Jahrzehnte hin, durchgehend besser behalten als Wörter. Konkrete Wörter werden besser gelernt als abstrakte. Befragte Versuchspersonen berichten, dass sie beim Merken von konkreten Wörtern mehr Imaginationen als verbale Strategien einsetzen, beim Merken von abstrakten Wörtern dagegen umgekehrt (Paivio 1995): Es besteht eine Beziehung zwischen dem Konkretheitsgrad des zu lernenden Wortes und der Imagination als Merkstrategie sowie zwischen der Abstraktheit des zu lernenden Wortes und verbalen Merkstrategien. Die Vermutung liegt nahe, dass für beides unterschiedliche Repräsentationssysteme existieren.
Modelle analoger Repräsentation gehen deshalb davon aus, dass zumindest ein Teil unseres Wissens nicht über symbolische Begriffe und Beziehungsgeflechte, sondern über direkte mentale Abbilder repräsentiert wird. Diese beziehen sich auf die jeweils geforderte Sinnesmodalität, meist – aber nicht ausschließlich – auf das Sehen. „Analog“ meint dabei eine ähnliche, gleichartige, nicht unbedingt genau gleiche Darstellung von Wissen in unserem Gehirn: Wir werden nach dem Weg zum Marktplatz gefragt und besinnen uns darauf, indem wir diesen Weg in uns ablaufen lassen. Wir werden gebeten, uns an das Haus unserer Kindheit zu erinnern und sehen es bildhaft vor uns. Ganz offensichtlich spielen innere Bilder und nicht Bedeutungsrepräsentationen hier eine überragende Rolle.
Wie diese Bilder in uns gespeichert werden, ist unklar. Natürlich darf man sie sich nicht als kleine Fotografien, nicht als einfache Kopien der Wahrnehmung vorstellen. Damasio (1997) vermutet, dass in kleinen Neuronenverbänden in den Assoziationsfeldern höherer Ordnung sowie in den Basalganglien und limbischen Strukturen Entladungsdispositionen erzeugt werden, indem auf Synapsenebene (Stärkung oder Schwächung synaptischer Verbindungen) nicht etwa Bilder an sich gespeichert werden, sondern die Mittel, die erforderlich sind, ein „Bild“ zu (re-) konstruieren. Wird ein solcher modifizierter Neuronenverband angeregt, feuert er in den frühen visuellen Kortex zurück, und wir nehmen ein Bild wahr.
Die Existenz und Bedeutung innerer Bilder zeigt auch folgendes Experiment: Versuchspersonen sollten sich eine Katze ganz klein oder ganz groß vorstellen. Dann wurden sie nach bestimmten Merkmalen gefragt und sollten angeben, ob die Katze diese besäße oder nicht (beispielsweise Krallen): Es zeigte sich, dass die Leute mit dem inneren Bild einer kleinen Katze länger zur Beantwortung der Frage benötigten. Wenn Wissen grundsätzlich über Propositionen gespeichert wäre, wie HABEN (KATZE, KRALLEN), wäre kein Zeitunterschied zu den Versuchsteilnehmern mit der „großen“ Katze zu erwarten gewesen. Tatsächlich berichteten Versuchsteilnehmer mit der kleinen Katze dann auch, sie hätten zur Beantwortung der Frage die relevanten Teile des Tiers wie mit einer Lupe vergrößert (Kosslyn 1975, nach Wessells 1994).
Es ist aber einsichtig, dass eine rein analoge Speicherung von Wissen nicht sehr effektiv ist und wohl auch unsere Gedächtniskapazität sehr bald übersteigen würde. Der Eingang durch unsere Sinnesorgane wird mit etwa 10 Millionen Bit pro Sekunde angegeben, innere Prozesse mit mindestens 10 Milliarden Bit pro Sekunde. Die klare Erinnerung auch nur eines einzigen Erlebnisses würde bei ausschließlich analoger Repräsentation ungeheueren Speicherplatz benötigen, selbst wenn diese Repräsentationen eben nur „analog“, das heißt nicht gleich, sondern gleichartig wie die aktuelle Sinneswahrnehmung gestaltet wären. Wie jeder von der Arbeit am Computer weiß: Bilder verschlingen ungleich mehr Platz als Wörter, gleichgültig in welchem Kompressionsformat. Daher ist als sicher anzunehmen, dass innerhalb von analogen Repräsentationen propositionales Wissen verwendet wird, dass einzelne Elemente von Objekten, etwa Flächen und Farben eines alten Sofas, teilweise nicht bildhaft gespeichert, sondern dass hier sozusagen „Abkürzungen“ propositionaler Art gewählt werden, etwa: „grün, oben hell, nach unten allmählich dunkler werdend“. Bei einer aktuellen bildhaften Vorstellung des alten Sofas könnten dann diese teils analogen teils propositionalen Informationen zum konkreten sinnesanalogen Bild zusammengesetzt werden.
Ein Hinweis auf ein solches Zusammenwirken analoger (sinneshafter) und propositionaler Repräsentationen ist auch der Tatsache zu entnehmen, dass wir problemlos neue Vorstellungen generieren können. Einen auf einer Fliege reitenden Ritter oder eine lebendig gewordene und vom Teller kriechende Nudel haben wir vermutlich noch nie gesehen, dennoch gelingt uns die Konstruktion eines inneren Bildes dazu in der Regel ohne große Probleme, was darauf hindeutet, dass wir in der sinneshaften Vorstellung etwas wie eine Beschreibung einzelner Bestandteile des Bildes zusammensetzen und als Ganzes erleben (ein Ritter, eine Fliege bzw. ein Teller, Nudeln, Schlängeln): Das ist gut vereinbar mit der Hypothese einer propositionalen Speicherung einzelner Merkmale, die dann zum analogen Bild zusammengesetzt und vor dem inneren Auge „gesehen“ werden.
Für das Gedächtnis ist aber nicht nur eine gute Speicherung wichtig, sondern auch die Möglichkeit des Abrufs: Ein Archiv, das alles enthält, taugt ohne Verzeichnis und Zugang nicht viel. Mnemotechniken setzen deshalb an drei Bereichen an: Optimale Verschlüsselung der Wissensinhalte, Vernetzung der Wissensinhalte mit schon vorhandenem Wissen, optimaler Rückruf des gespeicherten Wissens durch Anlegen günstiger Erinnerungspfade. Es ist offensichtlich, dass sich für alle drei Bereiche die Arbeit mit Vorstellungsbildern anbietet. Am Beispiel der Schlüsselwortmethode wird gezeigt, wie Vorstellungsbilder beim Vokabellernen eingesetzt werden können (nach Mecklenbräuker und Mitarbeiter 1992):
Soll eine fremdsprachige Vokabel gelernt werden, wird zunächst nach einem Wort in der eigenen Sprache gesucht, das so ähnlich klingt und eine bildhafte Vorstellung auslöst: das Schlüsselwort. Für das englische Wort „hat“ wäre ein Beispiel: „Haar“. Nun wird ein Bild gesucht, das das Schlüsselwort und die zu lernende Vokabel verbindet, beispielsweise ein Hut auf dem Kopf und den Haaren. Erst wird die akustische Brücke, dann die Brücke des Vorstellungsbildes konstruiert. Untersuchungen zeigen, dass diese Art Vokabeln zu lernen erheblich leichter fällt, und zwar sowohl Menschen, die sowieso gut als auch solchen, die sonst schlecht lernen. Am besten wird dabei das Schlüsselwort vom Lehrer vorgegeben, die Bildbrücke aber vom Lernenden selbst geschlagen. Auch in anderen Lernbereichen kann diese Methode eingesetzt werden.
Fast alle Mnemotechniken von der Antike bis zur Gegenwart stützen sich ganz oder teilweise auf Vorstellungsbilder. Innere Bilder scheinen dabei schon bei kleinen Kindern vorhanden zu sein – kaum aber Strategien, sie sinnvoll einzusetzen. Um innere Bilder bei jüngeren Kindern zum Lernen nutzen zu können, müssen sie ihnen vorbereitet angeboten werden. Ältere Kinder (Fünftklässler) brauchen dagegen nur noch zur Konstruktion von Bildern als Brücken angeregt werden, sie können und tun es dann selbst.
Wichtig für die Hilfe beim Erinnern ist eine hohe Emotionalität und damit verbunden eine hohe Bildhaftigkeit des Materials. Rubin & Schulkind (1997) gaben 120 Erwachsenen zwischen 20 und 73 Jahren Wörter vor, um autobiografische Erinnerungen zu assoziieren. Es zeigte sich für alle Altersgruppen, dass Wörter, deren Bildhaftigkeit als hoch eingeschätzt wurde, ältere Erinnerungen und schnellere Reaktionszeiten hervorriefen. Nicht nur bei der Speicherung, auch beim Gedächtnisabruf sind also bildhafte Strategien vorzuziehen. Novack & Bonvillian (1996) erhielten bei tauben Studenten, die Wortlisten lernen sollten, bessere Ergebnisse mit bildhaften Wörtern. So auch Crawford & Allen (1996) bei Normalhörenden. Wallace, Allen & Propper (1996) fanden heraus, dass Anagramme mit bildhaften Begriffen am besten gelöst wurden – dabei waren bei den Versuchspersonen gute Suggestibilität und Imaginationsfähigkeit wesentlich.
Unser Wissenstand ist aber noch keineswegs umfassend. Wie erinnern wir Beziehungen? Wie oben geschildert, verschlüsselt S. das zu behaltende Wort „Reiter“ nach einigen Jahren als berufsmäßiger Gedächtniskünstler nicht mehr durch das Bild eines Pferds mit einem Reiter darauf, sondern durch das Bild eines Fußes mit einem Sporn. Woher weiß er, dass er damit nicht das zu behaltende Wort „Sporn“ erinnern wollte – oder ein ganz bestimmtes Ferienerlebnis –, sondern den Begriff „Reiter“? Woher wissen wir, dass das mit englisch „hat“ assoziierte „Haar“ uns nicht beispielsweise auf „Kopf“ bringen soll sondern auf „Hut“? Natürlich schränkt das Schlüsselwort die vorhandenen Möglichkeiten stark ein, ein paar Alternativen bleiben jedoch immer. Wieso stören sie nicht? Wieso kommen wir sofort auf die richtige Verbindung?
Dieser kurze Einblick in die Bedeutung bildhafter Vorstellungen für das Lernen und Erinnern soll uns genügen. Wissen ruft neue Fragen hervor. Fragen stellen heißt wissen. Der hohe Wert von inneren Bildern für das Gedächtnis bleibt festzuhalten.
Denken
„Man scheut sich noch, den Zweifel ernst zu nehmen, ob die Aussagen des Geistes am Ende Symptome gewisser psychischer Zustände seien.“
Carl Gustav Jung, Theoretische Überlegungen zum Wesen des Psychischen, 1947
Denken kann definiert werden als mentale Aktivität zur Manipulation oder Transformation von Repräsentationen, um aus ihnen neue Informationen abzuleiten. So kommen wir zur Frage nach der analogen oder propositionalen (symbolischen) Art dieser Repräsentationen, wie sie schon beim Gedächtnis besprochen wurde.
Zusätzlich stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Denken und Imaginationen. Symbolisten behaupten, dass mentale Symbole (analoger oder propositionaler Art) das Wesen des Denkens ausmachen – Denken ereigne sich in ihnen. Konzeptualisten behaupten, Denken sei eine abstrakte spezielle Art kognitiver Aktivität, die an mentalen Einheiten konzeptueller oder abstrakter Art ansetze und Bilder höchstens als Ergebnis produziere, nicht aber selbst damit arbeite. Denis (1991) bemüht sich in seiner Übersicht um eine Vermittlung. Danach sind Imaginationen nicht das Herz des Denkens, aber ein mögliches Medium, an dem Denkprozesse ansetzen können. Denken nutzt sowohl abstrakte als auch bildhafte Repräsentationen.
Experimente zeigten, dass Denkprobleme von der Verwendung von Imaginationen unterschiedlich stark profitieren: Manchmal nutzt Denken innere Bilder, arbeitet manchmal aber auch ganz abstrakt. Es konnte auch gezeigt werden, dass an Probleme bisher unbekannter Art eher bildhaft herangegangen wird, während bekannte Arten von Problemen dagegen eher linguistisch gelöst werden. Wie rechnet man drei plus vier? Beispielsweise indem drei Murmeln abgezählt werden, und dann noch einmal vier. Sie werden zu den dreien hinzugefügt, und alles zusammen wird erneut gezählt: Das ergibt sieben. Gehen wir später auch noch so vor? Nein – bei vielen mathematischen Problemen wäre das gar nicht mehr möglich oder doch sehr viel umständlicher als ein abstrakter Lösungsweg.
Neben der Bildhaftigkeit des Lösungsansatzes scheint auch die Bildhaftigkeit des Ausgangsmaterials wichtig zu sein. So fanden Wallace, Allen & Propper (1996), dass bildhafte Anagramme schneller und besser gelöst werden als wenig bildhafte. Was bildhaft vorliegt oder bildhaft gemacht werden kann, hat Lösungsvorteile.
Voraussetzung für Imaginationsprozesse ist, dass die Daten überhaupt mental als Bilder abgebildet werden können. Wenn das Denken von physischen Objekten und Operationen handelt, ist das klar gegeben, vor allem wenn räumliche Gegebenheiten wichtig sind. Andere Probleme sind nicht physisch, können aber bildhaft gemacht werden – Imagination wird dann symbolisch verwendet, beispielsweise wenn Zeitprobleme durch eine räumliche Darstellung repräsentiert werden. Das Mönchsproblem nach Duncker (veröffentlicht 1945) zeigt diese Bedeutung innerer Bilder für das Denken:
Ein Mönch steigt vom Talgrund aus einen beschwerlichen Bergpfad aufwärts. Er beginnt damit um 8:03 Uhr am Montagmorgen. 15 Minuten macht er Mittagspause, isst und trinkt. Um 16:30 Uhr erreicht er den Berggipfel und verbringt dort die Nacht in Meditation. Um 8:03 Uhr am nächsten Morgen steigt er den Bergpfad wieder hinab. Beschwingt durch die Meditation ist er viel schneller, erreicht seinen Ausgangspunkt im Tal bereits 13:05 Uhr. Die Frage ist nun: Gibt es irgendeine Zeit am Tag (es muss nicht genannt werden, wann), zu der der Mönch an exakt derselben Stelle des Pfades ist, am Montag wie am Dienstag?
Die zweite Frage ist, wie dieses Denkproblem gelöst wird. Rein mathematisch-abstrakt kommt man nicht weit. Aber wenn man sich zwei Mönche vorstellt, von denen der eine den Bergpfad auf-, der andere absteigt, ist die Lösung offensichtlich; Natürlich begegnen sie sich irgendwo auf dem Pfad – das ist die Zeit, nach der gefragt wurde. Auch andere Imaginationen würden das Problem lösen. So kann ein Koordinatensystem gedacht werden, bei dem die X-Achse die Höhe und die Y-Achse die Zeit repräsentiert. Nun wird der Weg des Mönchs am Montag ausgehend von 8:03 Uhr und von der Höhe 0 (Tal) bis zu 16:30 Uhr und der Höhe 100 (Gipfel) durch eine Linie eingezeichnet. Dann der Weg des Mönchs abwärts, wieder beginnend um 8:03 Uhr, aber von der Höhe 100 aus, endend bereits um 13:05 Uhr und der Höhe 0. Die beiden Linien schneiden sich: Das ist der gefragte Punkt. Das Problem demonstriert recht eindrucksvoll, dass bildhaftes Denken bei manchen Problemen sehr hilfreich ist. Die einzige Art des Denkens ist es aber sicherlich nicht.
Folgende Eigenschaften von inneren Bildern gelten nach Denis (1991) als besonders wichtig für Denkprozesse:
1. Die strukturelle Ähnlichkeit von inneren Bildern mit der Wahrnehmungsrepräsentation. Wenn keine Wahrnehmung vorhanden und das Objekt, um das es beim Denken gehen soll, nicht anwesend ist, kann doch etwas Analoges durch ein inneres Bild hergestellt werden. Dies kann dann als Modell dienen, an dem das Denken ansetzt. Ganz offensichtlich ist das vor allem bei Aufgaben bedeutsam, die sich auf Räumlichkeit beziehen.
2. Die Ökonomie der Imagination: Viel Information ist in wenig Struktur untergebracht. Bedenkt man, was für einen Verzeichnisbaum die propositionale Repräsentation eines Hasen ergäbe, freuen wir uns über das einfache analoge Bild.
3. Da Imaginationen wie physische Objekte transformiert werden können, sind die Zwischenstadien kognitiv verfügbar; die Manipulationen können flexibel und schnell durchgeführt werden.
Vermutlich könnten wir auch ohne innere Bilder denken – mit ihnen geht es jedoch besser. Vor allem Denkprozesse in unbekannten Gewässern mit kreativen, neuartigen Ergebnissen profitieren vom bildhaftem Denken.
Kreativität
Kreativität wird in Unterscheidung zur Intelligenz als divergentes Denken bezeichnet. Während im konvergenten „intelligenten“ Denken ein bestimmter vorgegebener Zielzustand erreicht werden soll, sind im divergenten Denken verschiedene Zielzustände möglich: Eine Rechenaufgabe hat ein bestimmtes Ergebnis, andere Lösungen sind falsch. Ein Statue mit dem Thema „Nixen am Brunnen“ kann sehr viele Gestaltungen annehmen, ohne dass die eine „richtig“, die andere „falsch“ wäre.
Auch für kreative Problemlösungen ist Intelligenz nötig. Viele Aufgaben konvergenten Denkens profitieren andererseits von einer kreativen Lösungsweise, auch wenn am Schluss nur ein bestimmtes und andere Lösungsmöglichkeiten ausschließendes Ergebnis stehen darf. Kreativität und Intelligenz überlappen sich, sind aber nicht identisch.
Kreativität kann unter dem Aspekt der kreativen Person, des kreativen Prozesses, des Produkts kreativer Tätigkeit und der kreativitätsfördernden oder hemmenden Umwelt betrachtet werden. Für unser Thema ist der kreative Prozess wichtig. Das bereits 1926 von Wallas vorgestellte Stadienmodell hat weite Verbreitung gefunden. Es unterscheidet:
1. Präparation: Das Problem wird bewusst, erste Informationen und Ideen werden gesammelt.
2. Inkubation: Das Problem wird beiseite gelegt. Die Bearbeitung läuft aber unbewusst weiter; neue Hypothesen und Kombinationen werden durchgespielt.
3. Illumination: Plötzliches Auftreten einer Lösung, oft mit dem Gefühl, dass sie gar nicht von einem selbst stammt, sondern einem eingegeben wurde.
4. Verifikation: Kritische Beurteilung des Ergebnisses. Eventuell Überarbeitung oder Neubeginn.
Wie jedes Modell kann auch dieses nur eine Hilfskonstruktion sein. Die Stadien sollten nicht als eindeutig abgrenzbar und starr aufeinanderfolgend betrachtet, sondern im Sinne von unterschiedlichen Denkprozessen verstanden werden, die oft ohne klare zeitlich Trennung in- und aufeinander wirken.
Bei Kunstwerken gibt die offene Zielsetzung mit der Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten bereits die divergente Art des Denkens vor. Aber auch bei wissenschaftlichen Problemstellungen können divergente Elemente bei den Lösungsansätzen bestimmend sein. Wesentlich ist die starke Bedeutung imaginativer Prozesse beim divergenten Denken, während das konvergente Denken weitgehend von propositionalen Denkformen geleitet ist, die eher sprachlich organisiert sind.
Albert Einstein, der für sein kreatives Denken bekannt war, antwortete auf eine Fragebogenerhebung zum Denken von Mathematikern wie folgt: „Die Worte oder die Sprache, wie sie geschrieben oder gesprochen wird, scheinen für meine Art des Denkens keine Rolle zu spielen. Die psychischen Einheiten, die anscheinend als Elemente des Denkens dienen, bestehen aus bestimmten Zeichen und mehr oder weniger klaren Bildern ...“ (Jacques Hadamar, 1949, zitiert in Nørretranders 1997, Seite 258).
Einstein vertrat auch in der Frage nach der Zielsetzung wissenschaftlichen Denkens einen eindeutig „kreativen“ Standpunkt: „Im übrigen sind letztere [die „Grundgesetze“ der Physik] freie Erfindungen des menschlichen Geistes, die sich weder durch die Natur des menschlichen Geistes noch sonst in irgendeiner Weise a priori rechtfertigen lassen.“ (Einstein 1981, Seite 115).
Betrachtet man das Stadienmodell der Kreativität, so ist offensichtlich, dass das erste Stadium (Präparation) und das letzte (Verifikation) auch beim konvergenten Denken vorkommen. Typisch für „kreative“ Prozesse sind die Stadien 2 (Inkubation: unbewusste Bearbeitung) und 3 (Illumination: urplötzliches Auftreten einer Lösung, ohne daran aktuell zu arbeiten).
Über das, was sich in der Inkubationsphase ereignet, wissen wir wenig. Zur Illumination finden sich zahlreiche Aussagen von Wissenschaftlern, Künstlern und Dichtern. Bekannt geworden ist die Schilderung der Inspiration von Friedrich Nietzsche in dessen Autobiografie:
„Mit dem geringsten Rest von Aberglauben in sich würde man in der That die Vorstellung, bloss Incarnation, bloss Mundstück, bloss medium übermächtiger Gewalten zu sein, kaum abzuweisen wissen. Der Begriff Offenbarung, in dem Sinn, daß plötzlich, mit unsäglicher Sicherheit und Feinheit, Etwas sichtbar, hörbar wird, Etwas, das Einen im Tiefsten erschüttert und umwirft, beschreibt einfach den Thatbestand. Man hört, man sucht nicht; man nimmt, man fragt nicht, wer da giebt; wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf, mit Nothwendigkeit, in der Form ohne Zögern, – ich habe nie eine Wahl gehabt. Eine Entzückung, deren ungeheure Spannung sich mitunter in einen Thränenstrom auslöst, bei der der Schritt unwillkürlich bald stürmt, bald langsam wird; ein vollkommnes Ausser-sich-sein mit dem distinktesten Bewusstsein einer Unzahl feiner Schauder und Überrieselungen bis in die Fusszehen; eine Glückstiefe, in der das Schmerzlichste und Düsterste nicht als Gegensatz wirkt, sondern als bedingt, als herausgefordert, sondern als eine nothwendige Farbe innerhalb eines solchen Lichtüberflusses; ein Instinkt rhythmischer Verhältnisse, der weite Räume von Formen überspannt – die Länge, das Bedürfniss nach einem weitgespannten Rhythmus ist beinahe das Maass für die Gewalt der Inspiration, eine Art Ausgleich gegen deren Druck und Spannung ... Alles geschieht im höchsten Grade unfreiwillig, aber wie in einem Sturme von Freiheits-Gefühl, von Unbedingtsein, von Macht, von Göttlichkeit ... Die Unfreiwilligkeit des Bildes, des Gleichnisses ist das Merkwürdigste; man hat keinen Begriff mehr, was Bild, was Gleichniss ist, Alles bietet sich als der nächste, der richtigste, der einfachste Ausdruck.“
Jedes Kind ist kreativ, bei Erwachsenen herrschen konvergente Problemlösungen vor. Vermutlich werden wir alle in Schule und Beruf zu sehr auf den einen erwünschten Zielzustand gedrillt: dem Ergebnis im Lösungsheft des Lehrers, der Zielvorgabe im Betrieb. Im Entwicklungsverlauf zeigt sich zunächst ein Vorherrschen des Denkens in Bildern, zu dem zunehmend abstrakte, propositionale Verarbeitungsformen treten und sie zumindest überdecken, teilweise auch ablösen (Lautrey & Chartier, 1991): Kreative Erwachsene können offenbar nach wie vor auf bildhafte Verarbeitungsprozesse zurückgreifen – und sie besitzen die für die Stadien 1 und 4 notwendigen Fähigkeiten, die offenbar eher propositionale Denkformen verlangen.
Etwas spricht aus einem selbst, etwas, für das sich das, was wir unser Bewusstsein nennen, nicht verantwortlich fühlt. Nicht nur bei Nietzsche ist diese Sprache eine Sprache des Bildes. Was spricht? Was ereignet sich in der Phase der Inkubation? Wo ereignet es sich? Darüber wird viel spekuliert, zwischen der „Stimme Gottes“ und dem „Unbewussten“ sind viele Leerwörter und Platzhalter im Umlauf. Wir können es erklären, wie die Menschen seit Jahrtausenden den Lauf des Monds und der Sterne zu „erklären“ in der Lage waren, mit einer Mischung aus ein paar sorgfältigen Beobachtungen und reichlich Mythologie. Aber eigentlich wissen wir es nicht.
Innere Bilder im Alltag
„Die Tatsache, daß wir mit zwei Augen sehen und mit zwei Ohren hören, weist auf die Notwendigkeit der Wahrnehmung desselben Dinges von verschiedenen Standpunkten.“
Anagarika Govinda, 1984
Eine Freundin ruft an, mit der ich für später verabredet bin. Sie möchte vorher einkaufen, ob sie mir etwas mitbringen soll. Ich überlege. Ich beobachte, wie ich überlege. Wie gehe ich vor? Ich stelle mir bildhaft die Regale des mir gut bekannten Supermarkts vor, nenne dabei, was ich brauche. Sie fragt: Nichts aus der Tiefkühltruhe? Oh! Das habe ich vergessen, denn mein Bild des Supermarkts ist noch immer das vor seinem Umbau: ein Bild ohne Tiefkühltruhen.
Abstrakte Gedanken und visuelle Imaginationen lassen sich im EEG klar unterscheiden (Lehmann und Mitarbeiter 1998): Lässt man Versuchspersonen der Definition von konkreten oder von abstrakten Wörtern lauschen, findet sich ebenfalls eine klare Unterscheidbarkeit der Hirnaktivation (Mellet und Mitarbeiter 1998): Es gibt hirnanatomisch eine Basis sowohl für abstrakte als auch für bildhafte Herangehensweisen.
Bildhaftigkeit zeigt dabei eine engere Beziehung zur Emotionalität. Campos, Marcos & Gonzalez (1999) untersuchten den Zusammenhang der Bildhaftigkeit von Begriffen und ihrer Emotionalität und konnten nachweisen (erhoben über Veränderungen des Hautwiderstands, die emotionale Betroffenheit gut abbilden), dass konkrete und bildhafte Begriffe zu signifikant stärkeren emotionalen Reaktionen führen als abstrakte Begriffe. Vielleicht lässt sich über diese stärkere Verknüpfung zur Emotionalität erklären, dass bildhafte Begriffe in allen Altersgruppen ältere Lebenserinnerungen hervorrufen und zu schnelleren Reaktionen führen als abstrakte Begriffe (Rubin & Schulkind 1997).
Emotionalität aber zeigt eine enge Verbindung zur Motivation. Beim Umgang mit bildhaften Begriffen sind in vielen Bereichen bessere Leistungen zu erwarten als beim Umgang mit abstrakten Begriffen.
Warum also denken wir häufig abstrakt?
Warum haben wir verschiedene Sinnesorgane und nicht nur eines, das eine, den anderen überlegene? Wir orientieren uns überwiegend mit dem Auge. Aber manche Aspekte lassen sich besser riechen als sehen: Auf den Zustand des vergessenen Backofens werden wir vielleicht als erstes durch den Geruch aufmerksam. Andere lassen sich besser hören, wieder andere besser schmecken oder fühlen. Warum haben wir zwei Augen und nicht nur eines? Sogar in derselben Modalität kann eine Vielfalt gut sein und die vorhandenen Möglichkeiten erweitern. Für räumliches Sehen sind zwei Augen vorteilhaft.
Manche Probleme werden wir eher mit bildhaften Herangehensweisen lösen, andere mit abstrakten. Unsere visuelle Wahrnehmung ist in der Endstrecke bildhaft organisiert. Viele Denkprozesse sind abstrakt. Wie gerade die Wahrnehmung zeigt, sind abstrakte und bildhafte Herangehensweisen und Organisationsformen jedoch fast immer auf irgendeiner Ebene miteinander verwoben (das Feuern der Neurone ist nicht-bildhaft): Vermutlich werden beide Verarbeitungsformen erst in ihrem optimalen Zusammenspiel zur besten Lösung führen.
Ist es vorteilhaft, lebhafte innere Bilder zu haben? Unser Leben wird sehr von Vorerwartungen bestimmt, von dem, was „sein könnte“, bei entsprechend veranlagten Menschen auch von Erwartungsängsten. Bei Menschen mit belastenden Lebenserfahrungen sollten lebhafte innere Bilder eher ungünstig sein. Bryant & Harvey (1996) erhoben dazu die Lebhaftigkeit der Imagination bei 81 Überlebenden von Motorradunfällen mit entweder 1. Posttraumatischer Belastungsstörung, 2. spezifischer Phobie, 3. keiner psychiatrischen Diagnose und niedriger Angst. Erstaunlicherweise zeigte die dritte Gruppe die lebhaftesten Visualisierungen. Das spricht gegen einen negativen Einfluss lebhafter innerer Bilder. Die Häufigkeit von Rückfällen und Alpträumen bei der ersten, problematischen Gruppe war jedoch mit der Fähigkeit zu lebhaften visuellen Imaginationen verbunden. Persönlichkeitsfaktoren scheinen also sehr wichtig zu sein. Vermutlich kann die Fähigkeit zu lebhaften Imaginationen bei depressiven oder ängstlichen Menschen ungünstige Aspekte haben, auch wenn sie an sich wertneutral ist, so wie das wirkliche Sehen als Fähigkeit in seiner Bedeutung davon abhängig ist, was der einzelne Mensch daraus macht.
Grundsätzlich scheint die imaginative Auseinandersetzung mit Problemen günstig zu sein. Rivkin & Taylor (1999) erfragten dies bei „normalen“ Studenten: Die Imagination bestehender stressvoller Ereignisse erwies sich sowohl emotional als auch bei der Förderung von Bewältigungsstrategien einer Verleugnung des Problems als überlegen.
Diese Fähigkeit zu bildhaftem Denken ist bei den Menschen offensichtlich unterschiedlich gut ausgebildet. Befragt man Menschen über die Klarheit und Lebendigkeit ihrer inneren Bilder, so wird von manchen ein „Sehen“ von hoher Klarheit und Lebendigkeit beschrieben, vergleichbar ausdrücklich dem Sehen mit offenen Augen, von ihm manchmal kaum zu unterscheiden. Von anderen wird ein „Sehen“ beschrieben, das sie selbst nur zögernd als visuell anerkennen: Da seien zwar Vorstellungen über räumliche Aspekte, über Farben und Formen, sie seien auch nutzbar um klare Aussagen über den vorgestellten Gegenstand machen zu können, selbst zum „Bild“ aber würden sie nicht. Sie werden eher als Empfindungen beschrieben, als Empfindungen von Bildern.
Ob eine ausgeprägte Fähigkeit zu bildhaften Vorstellungen Vorteile bei der Anwendung von Imaginationsaufgaben bringt, ist nicht sicher. Entscheidend scheint zu sein, ob innere Bilder oder Vorstellungen oder bildhafte Empfindungen im täglichen Leben überhaupt herangezogen und sogar bewusst eingesetzt werden – offenbar bringt es meistens Vorteile, wenn dies geschieht.
Körperschema
Es ist für uns zu selbstverständlich, um im Alltag darauf aufmerksam zu werden: Auch von unserem eigenen Körper haben wir ein inneres Bild. Bemerkbar wird das erst, wenn es zu Unstimmigkeiten zwischen diesem inneren Bild und der Wirklichkeit kommt. Das ist beispielsweise bei Menschen mit Neglect der Fall, bei denen nicht nur der Raum, sondern auch eine eigene Körperhälfte im inneren Bild nicht oder nur unangemessen repräsentiert ist – ohne dass die Betroffenen das bemerken. Solche Menschen stoßen beispielsweise häufig gegen den Türrahmen, weil sie beim Durchgang die nicht repräsentierte Körperhälfte unberücksichtigt lassen. Menschen mit Neglect (Ursache sind Hirnschädigungen) „waschen und bekleiden eine Körperhälfte nicht, rasieren nur eine Hälfte des Gesichts oder frisieren nur eine Kopfhälfte. Sie äußern sich nicht über eine Raum- und Körperhälfte und scheinen Äußerungen anderer Personen über die betreffende Raum- und Körperhälfte nicht zu verstehen.“ (Werth 1988) So werden beispielsweise auch Speisen auf einer Hälfte des Tellers nicht gegessen – die Patienten behaupten anschließend jedoch, der Teller sei leer. Diesen Menschen fehlt ein Teil der Raumrepräsentation einschließlich der Repräsentation ihrer selbst. Ein visumotorisches Imaginationstraining kann die Rehabilitation unterstützen, wie Smania und Mitarbeiter (1997) an zwei Patienten zeigten.
Neglect bedeutet sozusagen eine Amputation am inneren Bild seiner selbst. Umgekehrt berichten Menschen mit echten Amputationen über Phantomschmerzen in den nicht mehr vorhandenen Gliedern. Die Glieder müssen dazu im inneren Bild noch vorhanden sein. Reizungen der realen Nervenendigungen werden dann dorthin verlegt, wo vor der Amputation das Nervenende gelegen hat. Eine Studie von Simmel (1966) zeigte, dass dies erst ab einem Alter von etwa 8 Jahren durchgängig geschieht. Bei Amputationen vor diesem Alter werden nur von wenigen Kindern Phantomschmerzen berichtet. Simmel befragte nach der Operation auch Kinder, die kongenital missgebildete Extremitäten hatten. Bei keinem der sechs, deren Extremitäten präoperativ funktionslos waren, kam es zum Phantomschmerz (auch nicht bei den beiden, die über acht Jahre alt waren): Bei den Kindern aber, deren missgebildete Glieder vor der Operation funktionierten, waren die Phantomschmerzen denen von Kindern mit anderen Operationsgründen ähnlich. Es scheint also ein sensorischer Eingang nötig zu sein, um ein Körperschema aufzubauen, ein Vorgang, der erst etwa im Alter von 8 Jahren abgeschlossen ist. Aber wenn das Körperschema aufgebaut ist, bleibt es recht stabil.
Phantomschmerzen sind eine quälende Antwort auf die Frage nach der Bedeutung von inneren Bildern, hier des gar nicht bewussten Körperschemas. Bongartz & Bongartz (1992) berichten über einen Patienten mit seit 40 Jahren auftretenden Phantomschmerzen nach einer Beinamputation im 2. Weltkrieg. Es stellte sich heraus, dass er nachts im Traum seit 40 Jahren immer zwei gesunde Beine hat. Die Amputation war von ihm nie wirklich akzeptiert worden. In der Hypnose gelang schließlich die Korrektur des Körperschemas – und die Schmerzen verschwanden. Wir können also über bewusste Imaginationen Einfluss auf unsere inneren Bilder nehmen.
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739373614
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Dezember)
- Schlagworte
- Psychosomatik Psychotherapie Imagination Traumreisen Psychologie Innenbilder Fantasiereisen Entspannung Visualisierung