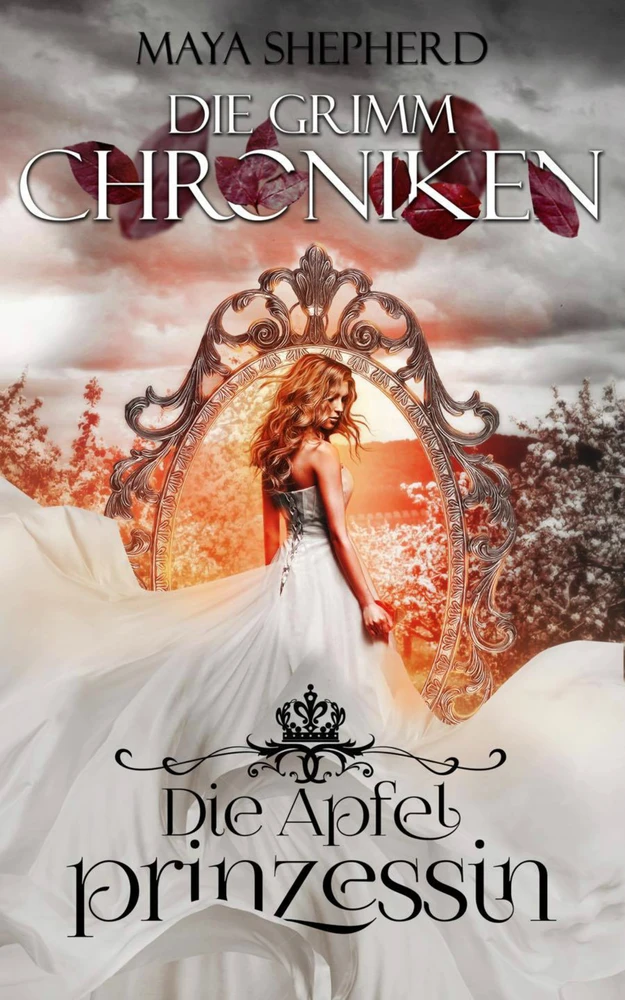Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Dieses Buch beginnt nicht mit Es war einmal, denn auf diese Weise fangen all die Lügen an, die Jacob und Wilhelm in die Welt gesetzt haben. Dies ist kein Märchen, sondern eine wahre Geschichte.
Es ist meine Geschichte.
Ich bin namenlos und trotzdem jedem bekannt. Man gab mir viele Bezeichnungen:
Ich war die grausame Zauberin, die das unglückliche Rapunzel zur Einsamkeit verdammte.
Ich war die herzlose Stiefmutter, die das arme Aschenputtel immer wieder quälte.
Ich war die dreizehnte Fee, die dem unschuldigen Dornröschen den Tod wünschte.
Ich war die böse Königin, die nach dem Herz des schönen Schneewittchens verlangte.
Das alles war ich. Es waren nicht verschiedene Erzählungen, die sich alle irgendwo auf der Welt unabhängig voneinander ereignet hatten und von den Brüdern Grimm gesammelt wurden. Es war immer nur eine Geschichte und die Brüder waren ein Teil davon. Sie sind es immer noch.
Märchen sind wie alle Sagen und Legenden: Es steckt ein Funke Wahrheit in ihnen, verwoben mit viel Fantasie. Jacob kennt die ganze Wahrheit und trotzdem entschloss er sich, sie zu vertuschen. Das, was wirklich geschehen ist, ist nichts, was man Kindern als Gutenachtgeschichte vorlesen sollte. Es ist eine Geschichte, die einen bis in die Träume verfolgt und das Blut in den Adern gefrieren lässt.
Es heißt, die Bösen werden bestraft und die Guten leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das Leben ist aber nicht schwarz-weiß und gewiss nicht glücklich. Rot ist die Farbe, die über das Schicksal entscheiden wird.
Doch egal wie die Geschichte endet, ich kann nur verlieren. Mein Untergang ist gewiss, doch was wird aus dem Rest der Welt? Was wird aus all den unschuldigen Seelen, die nichts mit alledem zu tun haben? Haben sie es nicht verdient, wenigstens die Wahrheit zu erfahren?
Jacob Grimm und ich kannten einander nicht nur – wir waren Freunde. Er war mein Berater und mein Vertrauter. Er wusste, dass ich alles in meiner Macht Stehende tat, um das Unheil aufzuhalten, auch wenn es mir das Herz brach. Ich musste nicht gegen den bösen Unbekannten ankämpfen, sondern gegen das, was ich am meisten auf der Welt liebte. Gegen mein eigenes Fleisch und Blut. Gegen meine Tochter. Gegen Schneewittchen.
Sie hatte nie eine Stiefmutter, so steht es auch in dem Originalmanuskript der Brüder von 1812. Ich weiß nicht, was Jacob dazu bewogen hat, es fünfzig Jahre später zu verändern. Warum hat er mich zu dieser egoistischen, grausamen und herzlosen Person gemacht, die vor lauter Neid auf ihre Tochter so blind war, dass sie diese töten wollte?
Ich war lange Zeit blind, aber nicht aus Neid, sondern aus Liebe. Wie jede Mutter liebte ich mein Kind so sehr, dass es wehtat. Nur dass es in meinem Fall wortwörtlich zu nehmen ist.
Schneewittchen ist nicht die naive und hilflose Prinzessin, die sie vorgibt, zu sein. Es ist leicht, an ihre Unschuld zu glauben, wenn sich ihre großen Augen mit Tränen füllen und ihre unermessliche Schönheit einem den Atem raubt. Sie täuschte nicht nur mich, sondern auch den Jäger, den Prinzen und die Vergessenen Sieben. Keine Zwerge. Das ist nur eine der vielen Lügen, die erschaffen wurden, um die Geheimnisse zu wahren.
Sie ist die eine, die über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Ausgerechnet mir, ihrer eigenen Mutter, wird es zur Aufgabe, sie aufzuhalten. Aber ich muss mich beeilen, denn schon bald wird sie von dem Fluch des Schlafenden Todes erwachen, der sie all die Jahre in einem Glassarg gefangen gehalten hat. Sie ist nun stärker denn je. Immer wenn ein Kind ihren Namen nennt oder auch nur an sie denkt, wird ihre Kraft umso mächtiger.
Ich kann es nicht allein schaffen, sie zu besiegen. Ich brauche die Hilfe derer, die ihr einst das Leben retteten: die Vergessenen Sieben.
Niemand kennt ihre Namen.
Niemand weiß, wer sie sind.
Niemand bis auf Jacob Grimm.
Wer immer dies liest, wird sich vielleicht fragen, was aus Wilhelm wurde.
Er starb vor vielen Jahren. Ich habe ihn getötet, als ich erfolglos versuchte, die Wahrheit aus ihm herauszubekommen. Er nahm seine Geheimnisse mit ins Grab.
Das mag den meisten als grausam erscheinen und vielleicht hegen sie deshalb Zweifel daran, ob ich nicht doch dieses herzlose Monster bin, als das die Brüder Grimm versucht haben, mich darzustellen. Die Lüge ist oft nicht von der Wahrheit zu unterscheiden, am wenigsten dann, wenn die Wahrheit zu schrecklich ist, um sie glauben zu wollen.
Um mich verstehen zu können, müsst ihr meine Geschichte kennen. Sie begann im Jahr 1575 …

Die Späher der Königin
Berlin, Charité – Klinik für Psychiatrie, Oktober 2012
Es war ein Freitag.
Will Zimmer war vermutlich der einzige junge Mann, der keinen Wochentag mehr verabscheute als den Freitag. Während andere Schüler diesen Tag als den Beginn des Wochenendes feierten, bedeutete er für Will eine Bürde. Denn seit seiner Kindheit besuchte er an jedem Freitagnachmittag seinen Vater in der Berliner Charité-Klinik für Psychiatrie.
Der Anblick des großen Gebäudekomplexes mit seinen spitzen Schieferdächern verursachte ihm eine Gänsehaut. Efeu rankte sich an den alten Backsteinen empor. Es hatte sich zu dieser Jahreszeit rot gefärbt und stand in farbenfrohem Kontrast zu dem tristen Grau des Herbsthimmels.
Jedes Mal, wenn er vor der tannengrünen Eingangstür stand, überkam ihn der Drang, der Klinik den Rücken zu kehren und etwas anderes mit seiner Zeit anzufangen – ganz egal, was. Er wusste jedoch, dass es zur Gewohnheit werden würde, wenn er sich auch nur ein Mal dazu durchringen würde. Die Verlockung wäre zu groß und auf einen freien Nachmittag würden ein zweiter, ein dritter und ein vierter folgen, bis er nicht mehr in der Lage wäre, wiederzukommen. Das konnte er seinem Vater nicht antun.
Will war das Einzige, was seinen Vater noch mit der Realität verband. Er war der rote Faden, der ihn in dieser Welt hielt und verhinderte, dass er völlig in seinen Wahnsinn abdriftete.
Die schwere Holztür gab ein lautes Knarren von sich, als Will sie aufzog. Das künstliche Licht der Deckenbeleuchtung flackerte beim Eintreten. Der Geruch von Desinfektions- und Reinigungsmitteln stieg ihm in die Nase, gemischt mit dem von altem Holz und feuchten Wänden. Eine ungewöhnliche Mischung, die ihm jedoch vertrauter war als jeder andere Duft.
Als er hörte, wie die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, zuckte er unwillkürlich zusammen, erfasst von der Angst, dass eines Tages der Zeitpunkt kommen würde, an dem sie sich für immer schloss und er an diesem Ort genauso gefangen wäre wie sein Vater.
Eine Hand berührte ihn sanft an der Schulter und Will richtete seinen Blick auf die Person, zu der sie gehörte: Maggy. Sie lächelte ihm ermutigend zu. »Komm, dein Vater freut sich bestimmt schon auf dich.«
Obwohl sie leise sprach, hallte ihre Stimme von den hohen Wänden wider. In der Charité herrschte stets eine bedrohliche Stille. Vermutlich war sie nicht einmal wirklich beunruhigend, sondern Will empfand sie nur so. Im Hintergrund hörte er ein Hämmern, Bohren und Sägen. Das Gebäude war alt und marode, sodass ständig irgendwo etwas repariert werden musste. War das eine Loch gestopft, brach es an einer anderen Stelle wieder auf.
Maggy hatte Will auch früher schon manchmal begleitet, aber seit etwa einem Jahr war es zu einer Regelmäßigkeit geworden. Die meisten Menschen empfanden Furcht, Neugier oder sogar Abscheu für eine Psychiatrie. Maggy hingegen betrat diesen Ort nicht anders, als würde sie in die Wohnung eines alten Freundes eintreten.
»Dafür müsste er erst einmal wissen, welchen Tag wir heute haben«, murrte Will weniger begeistert.
Die Besuche bei seinem Vater waren mit den Jahren immer mehr zu einer Verpflichtung geworden, als dass er irgendeinen Sinn in ihnen hätte erkennen können. Als Kind hatte er sich manchmal der Hoffnung hingegeben, dass der verwirrte Geist seines Vaters irgendwann geheilt werden könnte und er die Klinik verlassen würde, um mit seinem Sohn wie eine gewöhnliche Familie zusammenzuleben. Mit siebzehn Jahren war Will alt genug, um zu wissen, dass dies nicht mehr passieren würde.
»Für ihn ist jeder Tag gleich, da ist es schwer, die Übersicht zu behalten«, verteidigte Maggy seinen Vater.
Sie war nicht nur in Bezug auf Wills Vater einfühlsam, sondern fand für die meisten Menschen ein gutes Wort. Es war Will ein Rätsel, woher sie ihren Optimismus nahm, wo sie doch genau wie er in einem Heim aufgewachsen war und die meiste Zeit nur die Schattenseiten des Lebens kennengelernt hatte. Oft pflegte sie zu sagen: Immerhin hast du einen Vater, wenn er sich über die Besuche bei ihm beschwerte. Das holte ihn tatsächlich auf den Boden der Tatsachen zurück und erinnerte ihn daran, dass er dankbar für das sein sollte, was er hatte, selbst wenn es erschreckend wenig war.
Schlimmer als die Verpflichtung der Besuche war jedoch das Gerede der anderen Schüler.
Will war es gelungen, die Grundschulzeit rumzubringen, ohne dass irgendjemand von seinem Vater erfahren hatte. Er war nur ein Junge aus dem Heim gewesen.
Auf der weiterführenden Schule hatte es jedoch genau eine Woche gedauert, bis es seinem Vater auf wundersame Weise gelungen war, die Klinik zu verlassen. Anstatt ziellos durch die Stadt zu irren, war er barfuß und im Schlafanzug zu Wills Schule gelaufen und hatte ihn in seinem Klassenzimmer aufgesucht.
Bis heute fragte sich Will, woher er gewusst hatte, auf welche Schule er ging und vor allem wo sich sein Klassenzimmer befand. Er hatte es ihm sicher nicht erzählt, denn sein Vater konnte sich sonst nicht einmal merken, in welchem Jahrhundert er lebte. Vielleicht hätte es ihn sogar beeindruckt, wenn sein Besuch nicht der Grund dafür gewesen wäre, dass sein Leben seitdem noch trostloser war als zuvor.
Sein Vater hatte ihm, samt versammelter Schülerschar und Lehrerin, erklärt, dass er auf sein Herz achtgeben müsse, weil die böse Königin hinter ihm her wäre. Seitdem tuschelten die anderen hinter seinem Rücken und mieden ihn, als wäre eine Geisteskrankheit ansteckend.
Will war ein Einzelgänger, wie er im Buche stand. Er war so daran gewöhnt, dass man sich über ihn lustig machte, dass er von den Menschen im Allgemeinen nichts Gutes erwartete. Sprach ihn jemand an, reagierte er abweisend, aus Angst, dass es nur ein schlechter Scherz war. Manchmal tat er den Menschen damit unrecht, aber es war ihm lieber, als auf ihre Gemeinheiten hereinzufallen. Kinder waren ehrlich, aber auch äußerst grausam.
Ohne Maggy und ihren Bruder Joe wäre er wohl ganz allein gewesen. Es war jedoch weniger ihre gemeinsame Kindheit im Heim, die sie zusammenhielt, als mehr die Tatsache, dass sie alle drei aus dem einen oder anderen Grund von der Allgemeinheit ausgestoßen wurden.
Sie meldeten sich formhalber am Empfang der Charité an, wo sie jedoch beide bereits bekannt waren.
»Hallo, ihr zwei«, grüßte die alte Frau Friedrich, als sie ihnen die Besucherliste über den Tresen zuschob, in die sie sich eintragen mussten. Durch ihre dicken Brillengläser wirkten ihre Augen geradezu riesig. Sie rief auf der Station an, damit jemand vom Pflegepersonal kam und sie abholte.
Ludwig Zimmer befand sich in der geschlossenen Abteilung. Besuche waren nur in Absprache mit dem zuständigen Arzt gestattet.
»Gab es diese Woche besondere Vorkommnisse?«, wollte Will ohne großes Interesse wissen. Der Zustand seines Vaters war gleichbleibend. Jahr ein, Jahr aus erzählte er dieselben wirren Geschichten, ohne dass sich je etwas daran änderte.
»Es ist ein schweres Jahr für ihn«, seufzte Frau Friedrich, die schon in der Charité arbeitete, seitdem Will denken konnte. Während sie ihn hatte aufwachsen sehen, hatte er dabei zuschauen können, wie ihr blondes Haar grau und die Falten in ihrem Gesicht immer zahlreicher wurden. Er hatte sie nie anders gesehen als mit einem Dutt, einer dicken Brille und selbst gestrickten Wolljacken. Sie kannte seinen Vater und seine Krankengeschichte besser als die meisten Ärzte.
Will hob fragend die Augenbrauen. »Wie meinen Sie das?«
Maggy kam ihr jedoch zuvor. »2012«, flüsterte sie andächtig.
Die Friedrich nickte zustimmend. Will blickte jedoch nur verständnislos zwischen ihnen hin und her. Er hatte aufgehört, seinem Vater zuzuhören und irgendetwas, was er sagte, für bare Münze zu nehmen.
»Das ist das Jahr, von dem Ludwig immer wieder gesprochen hat«, erklärte ihm die Krankenschwerster. »Das Jahr, in dem das Schicksal der Welt entschieden wird.«
Wills Vater sprach häufig von Dingen wie Schicksal, Flüchen, Dornenhecken, verzauberten Gegenständen und vor allem dem Bösen. Der Teufel war für ihn so real wie die alte Frau Friedrich, der Will gegenüberstand.
»Warum ausgerechnet 2012?«
»Wer kann das schon so genau sagen?«, meinte sie. »Wollen wir hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird.«
Eine Besserung wäre es, wenn er aufhören würde, sein eigenes Spiegelbild anzuschreien und jedes Buch, das ihm in die Hände geriet, in winzig kleine Stücke zu zerreißen.
Wenigstens hatte er in der Klinik keinen Zugang zu Streichhölzern oder Feuerzeugen. Sie waren der Grund, warum er eingewiesen worden war. Er hatte mit einem Streichholz ein Buch in Brand gesteckt. Nicht irgendein Buch, sondern eine Ausgabe der Märchen von den Brüdern Grimm.
Als die Feuerwehr angerückt war, um den Brand zu löschen, hatte Ludwig mit Will auf dem Arm seelenruhig im Treppenhaus gesessen und behauptet, dass die Lügen vernichtet werden müssten. Damals war Will noch zu klein gewesen, um irgendeine Erinnerung daran zu haben. Er wusste nicht, ob sein Vater jemals anders gewesen war. Vielleicht hatte der Tod von Wills Mutter kurz nach seiner Geburt dazu geführt, dass er den Verstand verloren hatte. Vielleicht war er mit dem Verlust, der Einsamkeit und der Verantwortung nicht zurechtgekommen und hatte sich deshalb in eine Fantasiewelt geflüchtet. Es schien jedoch keine fröhliche Welt zu sein, sondern ein dunkler Ort, der von Angst regiert wurde.
Die Aufzugstüren glitten mit einem leisen Pling auf und Martin, einer der Pfleger seines Vaters, trat hinaus. Er trug eine weiße Uniform und war nur ein paar Jahre älter als Will und Maggy, weshalb sie sich seit Beginn seiner Ausbildung vor vier Jahren duzten. Ihr Umgang war freundschaftlich, auch wenn sie sich außerhalb der Klinik nie sahen.
Will und Maggy verabschiedeten sich von Frau Friedrich und liefen zum Fahrstuhl.
»Was macht die Schule?«, fragte Martin, um Konversation zu betreiben. Ihr Small Talk diente nur dazu, die Fahrt in die vierte Etage zu überbrücken.
»Ich bin froh, dass jetzt Herbstferien sind«, entgegnete Will, worüber Martin lachte.
Maggy sagte nichts dazu, denn im Gegensatz zu Will und der Mehrheit der Schüler mochte sie die schulfreie Zeit nicht besonders. Sie war das Paradebeispiel für die erfolgreiche Eingliederung eines Heimkindes, jedenfalls auf den ersten Blick: Sie war ehrgeizig, wissbegierig und engagiert. Alle Lehrer mochten sie. Wenn es Sonderaufgaben zu vergeben gab, war sie die Erste, die sich freiwillig dafür meldete – eine Streberin. Warum sie eine Außenseiterin war, erklärte sich wohl von selbst.
Obwohl sie sich die größte Mühe gab, sich einen Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen, war sie nie den Fluch aller Heimkinder losgeworden: der verzweifelte Wunsch nach Liebe. Während Will eine Mauer um sich errichtet hatte, um sich vor Enttäuschungen zu schützen, breitete Maggy für jeden ihre Arme aus, wohlwissend, dass man ihr immer wieder ein Messer in den Rücken rammen würde.
Im vierten Stock hielt der Fahrstuhl an und öffnete seine Türen. Der Flur war in einem warmen Gelbton gestrichen, der beruhigend auf die Patienten wirken sollte. Selbst gemalte Bilder der Bewohner zierten die Wände. Die Zeichnungen von Wills Vater waren jedoch nicht dabei, sondern in seiner Akte verschlossen. Die Ärzte hatten sie als zu verstörend empfunden, um sie für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Normalerweise herrschte auf der Station eine gezwungene Ruhe. Denn nur eine harmonische Umgebung konnte einem ruhelosen Geist dabei helfen, Frieden zu finden. Doch heute hatten sich mehr Menschen als gewöhnlich auf dem Flur versammelt. Eine gewisse Spannung lag in der Luft, als wäre irgendetwas vorgefallen. Wills gesamter Körper versteifte sich noch mehr. Er betete inständig, dass nicht sein Vater für den Tumult verantwortlich war.
Plötzlich schoss ein Mädchen im Alter von Will und Maggy aus der Menge hervor. Sie hatte langes blondes Haar, das ihr jedoch zerzaust vom Kopf abstand, als hätte jemand oder sie selbst versucht, es sich auszureißen. Ein langes hellblaues Nachthemd bedeckte ihren Körper. Ihre Füße steckten in Pantoffeln. Sie hatte es eilig, denn eine Krankenschwester war ihr dicht auf den Fersen.
Die anderen Patienten, welche auf dem Flur herumstanden, gaben den Weg für das Mädchen frei, versperrten diesen jedoch ihren Verfolgern. Als würden sie versuchen, eine der ihren zu schützen.
»Alice!«, brüllte die Krankenschwester wütend. »Bleib sofort stehen!« Als sie Martin entdeckte, rief sie ihm zu: »Lassen Sie nicht zu, dass sie in den Fahrstuhl steigt!«
Das blonde Mädchen, welches anscheinend Alice hieß, blickte sich Hilfe suchend um, bis es Will und Maggy entdeckte. Panisch rannte sie den beiden entgegen. »Habt ihr ein weißes Kaninchen gesehen?«, fragte sie mit britischem Akzent.
Sowohl Will als auch Maggy waren zu geschockt, um darauf zu antworten. Im nächsten Moment stürzte sich auch schon Martin auf Alice und packte sie an beiden Armen, damit sie nicht mehr weglaufen konnte.
Sie wehrte sich mit Händen und Füßen und kreischte dazu in den hellsten Tönen. »Die Herzkönigin schlägt ihm den Kopf ab!«, heulte sie, als hinge ihr Leben davon ab.
Zusammen mit der Krankenschwester stieg Martin in den Aufzug, um das verwirrte Mädchen zurück auf seine Station zu bringen. Andere Pfleger liefen nun über den Flur und forderten die Patienten auf, diesen zu räumen. »Hier gibt es nichts zu sehen!«
Sobald wieder etwas Ruhe eingekehrt war, wandte sich Will Maggy zu, deren braune Augen vor Schalk funkelten. »Hat sie dich auch an jemanden erinnert?«, fragte sie grinsend.
Will winkte genervt ab. »Hör auf damit«, forderte er sie auf. Er wusste, dass sie es nicht böse meinte, aber er konnte es nicht leiden, wenn sich jemand über die Wahnvorstellungen der Patienten lustig machte. »Dieses Mädchen ist verrückt, sonst wäre sie nicht hier. Genau wie mein Vater.«
Maggy zeigte sich von seiner Zurechtweisung wenig beeindruckt. Ganz im Gegenteil, ihr Grinsen wurde nur noch breiter. »Sind wir nicht alle ein bisschen verrückt? Ich bin verrückt. Du bist verrückt«, zitierte sie perfekt die Grinsekatze aus Alice im Wunderland.
Maggy war verrückt nach Büchern. Es gab kaum eines in der Bücherei, das sie noch nicht gelesen hatte. Die Klassiker mochte sie besonders.
Will zögerte erst, doch dann ließ er sich auf ihr Spiel ein. »Woher willst du wissen, dass ich verrückt bin?« Das hatte Alice die Grinsekatze gefragt.
Er mochte an Maggy, dass sie versuchte, aus jeder Situation das Beste zu machen. Sie hätten auch geschockt sein können, dass jemand in ihrem Alter unter derart großen Wahnvorstellung litt, dass man ihn in die Psychiatrie hatte einweisen lassen. Immerhin war es genau dieses Schicksal, vor dem Will sich am meisten fürchtete. Maggy ließ mit ihrem dummen Spruch jedoch gar nicht erst zu, dass er diesen furchterregenden Gedanken auch nur dachte.
»Wenn du es nicht wärest, dann wärest du nicht hier«, antwortete sie ihm als Grinsekatze.
Maggy liebte nicht nur alte Geschichten, Sagen und Märchen jeder Art, sondern auch Disney-Filme. Die meisten davon konnte sie auswendig mitsprechen. Wenn es darum ging, war sie eine Art wandelndes Lexikon.
Nachdem sie den Flur durchquert hatten, blieben sie vor dem Zimmer von Wills Vater stehen und klopften kurz an die Tür, um ihr Eintreten anzukündigen. Als sie diese jedoch öffneten, fanden sie das Zimmer in vollkommener Dunkelheit vor. Sämtliche Vorhänge waren zugezogen. Ihre Augen brauchten einen Moment, um Ludwig in seinem Ohrensessel ausmachen zu können.
»Hallo, Wilhelm«, grüßte er seinen Sohn mit dessen vollem Namen.
Will hasste es, wenn man ihn so nannte, weshalb er sich selbst immer nur mit der Kurzform vorstellte. Wenn man als Kind der heutigen Zeit einen derart altmodischen Namen wie Wilhelm trug, kam das einer Einladung für Hänseleien gleich. Das Schlimmste, was man ihm je gesagt hatte, war, dass seine Eltern ihn schon bei der Geburt nicht gewollt hätten, weil sie ihm sonst einen besseren Namen gegeben hätten. Wilhelm zu heißen, war eine Bestrafung.
»Schön, dass du mich besuchst«, sagte Ludwig, als wäre es das Normalste der Welt, mitten am Tag in einem dunklen Zimmer zu sitzen.
Will schnaubte, durchschritt den Raum und zog die schweren Samtvorhänge schwungvoll zur Seite. Als das trübe Herbstlicht in das Zimmer fiel, fauchte sein Vater, als würde er wie ein Vampir verbrennen.
»Nicht! So können sie uns doch sehen!«, schimpfte er aufgebracht und versteckte sein Gesicht hinter den Händen.
Will fragte nicht einmal, wen er mit sie meinte. Eine sinnvolle Antwort würde er ohnehin nicht erhalten. Stattdessen brachte er die Fenster in Kippstellung, damit wenigstens etwas frische Luft in das Zimmer kam. Ganz öffnen konnte er sie nicht, da es in der Vergangenheit häufig vorgekommen war, dass Patienten sich aus dem Fenster gestürzt hatten.
Maggy schritt behutsam auf seinen Vater zu, bückte sich, sodass ihre Gesichter auf derselben Höhe waren, und zog ihm sachte die Hände von den Augen. Als er sie erblickte, hellte sich seine angstvolle Miene schlagartig auf.
»Hallo, Ludwig«, begrüßte sie ihn freundlich.
Er trug eine weiche Cordhose, dazu einen grünen Pullover, der seine ebenfalls grünen Augen betonte. Sie hatten den gleichen Farbton wie Wills. Unter dem Pullover schaute ein weißes Hemd hervor, das einen gebügelten Eindruck machte. Ludwigs Haar war im Gegensatz zu dem braunen Haarschopf seines Sohnes blond. Es kräuselte sich, was seinen wirren Geisteszustand auch nach außen trug.
»Maggy«, freute er sich von ganzem Herzen, dann blickte er sich suchend im Zimmer um. »Wo hast du deinen Bruder gelassen?«
Joe mochte die Charité genauso wenig wie Will, aber im Gegensatz zu ihm zwang ihn keine Verpflichtung zu einem wöchentlichen Besuch, sodass er nur einmal in ihrer Kindheit mitgekommen war. Doch seitdem fragte Ludwig jedes Mal nach ihm.
»Joe ist beim Fußballtraining«, antwortete sie wie jede Woche, woraufhin Ludwig wissend nickte.
»Es ist wichtig, dass er sich fit hält.«
Maggy wusste nicht, ob er das sagte, weil er glaubte, dass Sport generell für die Gesundheit gut war, oder weil er sich daran erinnerte, wie pummelig Joe als Kind gewesen war. Sie ließ es unkommentiert und nahm stattdessen auf dem Sofa ihm gegenüber Platz.
Ludwig drehte sich zum Fenster um. »Wilhelm, komm da weg«, fuhr er seinen Sohn besorgt an. »Siehst du sie nicht auf den Bäumen sitzen? Sie spähen schon zu uns und überlegen, wie sie an dich herankommen können.«
Will folgte dem Blick seines Vaters unbeeindruckt und entdeckte einige Krähen zwischen den Ästen eines Baumes, der nahe dem Gebäude stand. Vom Herbst gelb gefärbte Blätter segelten zu Boden. Es würde nicht mehr lange dauern und der Baum wäre kahl.
»Meinst du etwa die Krähen?«, fragte er gelangweilt und widerstand dem Drang, auf die Uhr zu schauen. Eine Stunde würde er hierbleiben – nicht länger.
»Das sind keine gewöhnlichen Krähen«, korrigierte Ludwig ihn. »Das sind Raben! Die Augen der bösen Königin.«
Will ließ sich neben Maggy auf das Sofa sinken. Er wusste nicht, wie er das eine Stunde lang aushalten sollte. Als Kind hatte er die Geschichten seines Vaters spannend gefunden, mittlerweile nervten sie ihn. Jede Woche konnte er sich das gleiche sinnlose Geplapper anhören.
Geistesabwesend begann er, mit dem Medaillon zu spielen, welches an einer silbernen Kette von seinem Hals baumelte. Es war das einzige Erinnerungsstück, das ihm von seiner Mutter geblieben war. Er hatte sie nie kennengelernt, gerade deshalb bedeutete ihm das Schmuckstück viel.
Maggy spürte seine angespannte Stimmung und wechselte schnell das Thema. »Ludwig, kennen Sie eine Alice?«
Er runzelte die Stirn, als würde er über die Frage nachdenken.
»Sie wohnt auch hier, jedoch auf einer anderen Station«, fuhr Maggy fort. »Sie ist in Wills und meinem Alter und hat blonde Haare.«
»Ach, diese Alice«, stimmte Ludwig ihr plötzlich zu und ein zufriedenes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus.
Das Erstaunliche an seiner Krankheit war, dass er auf gezielte Fragen sogar antworten konnte. In manchen Momenten wirkte er dadurch völlig klar, dann sagte er jedoch wieder Dinge, die absolut keinen Sinn ergaben.
»Nettes Mädchen! Aber sie hat ihre ganz eigene Geschichte.«
Damit war für ihn das Thema beendet und er würde auch nicht mehr darauf zurückkommen. Stattdessen musterte er nun abwechselnd seinen Sohn und dessen Begleitung. Sein Blick blieb an der Perlenkette hängen, die Maggy um ihren Hals trug.
»Was für eine schöne Kette«, sagte er bewundernd.
»Danke«, freute sich Maggy und strich mit den Fingerspitzen über die einzelnen Perlen.
»Leider wird sie sich als nutzlos herausstellen«, meinte Ludwig bedauernd.
Maggy ließ ihre Hand sinken. »Ist nicht jeder Schmuck nutzlos?«, entgegnete sie schmunzelnd, worüber der Alte lachte und ihr wohlwollend zuzwinkerte.
Er schaute von ihr zu seinem Sohn. »Will, warum konntest du dich nicht in ein Mädchen wie sie verlieben?«, platzte er plötzlich ohne jede Vorwarnung heraus.
Während Maggy verlegen den Kopf senkte und ihre Augen hinter ihren braunen Ponyfransen versteckte, reagierte Will wütend.
Warum musste sein Vater ihn immer wieder blamieren? Reichte es nicht, dass er nie für ihn da gewesen war? Musste er ihn auch noch derart in Verlegenheit bringen?
Natürlich hätte man solche unangebrachten Fragen auf seinen kranken Geist schieben können, aber Will wusste, dass das damit nichts zu tun hatte. Sein Vater hatte lediglich die Höflichkeitsformen normaler Menschen verlernt. In der Klinik ließ man ihm sämtliches Fehlverhalten durchgehen und schob es auf seine Krankheit.
»Vater, solche Fragen sind unangebracht«, wies er ihn grob zurecht. Maggy war für ihn wie eine Schwester. Sie und Joe waren für ihn mehr Familie, als es sein Vater je gewesen war.
»Ist schon in Ordnung«, versuchte Maggy, ihn zu beruhigen.
»Nein, ist es nicht«, entgegnete Will. »Er kann sich nicht wie die Axt im Wald benehmen, nur weil er verrückt ist.«
Ludwig starrte seinen Sohn mit geweiteten Augen an. Es war verboten, dieses Wort in Gegenwart von Patienten zu benutzen. Man nannte sie nicht verrückt, sondern krank.
Für einen Moment schämte sich Will für seinen Ausbruch, als er in die großen Augen seines Vaters blickte, die seinen so ähnlich waren. Dann erinnerte er sich jedoch wieder daran, wie oft in seinem Leben er sich von ihm schon im Stich gelassen gefühlt hatte. Es waren unzählige Male.
Sein Vater war schuld daran, dass er sich nie irgendwo zu Hause gefühlt hatte. Keine Pflegefamilie hatte ihn lange bei sich behalten wollen. Selbst in der Schule hatte er, abgesehen von Maggy und Joe, keine Freunde finden können. Er war immer wie ein Fremder und gehörte nirgendwo dazu.
Ein unangenehmes Schweigen breitete sich in dem kleinen Zimmer aus. Draußen krächzte ein Rabe, bevor er davonflog. Der Baum war nun leer. Die Vögel hatten genug gesehen und gehört.
Maggy fand als Erste ihre Sprache wieder und redete wild drauflos. Sie erzählte, dass sie den Herbst besonders mochte, weil man zu dieser Jahreszeit am besten lesen könne. Sie schwärmte von verschiedenen Teesorten, Gebäck und Büchern, die sie über das Jahr gelesen hatte.
Will wusste, dass sie das nur tat, um die Wogen zu glätten. Manchmal fragte er sich, ob er ohne sie seinen Vater noch besuchen würde.
Als die Stunde um war, erhob er sich von der Couch und streckte seinem Vater die Hand entgegen. Es war eine sehr förmliche Geste und erinnerte mehr an die Verabschiedung eines entfernten Bekannten.
Ludwig ergriff die ausgestreckte Hand und hielt sie länger fest als nötig. »Wilhelm, denk immer daran, dass manche Probleme sich nur im Schlaf lösen lassen.«
Will nickte, aber hatte die Worte seines Vaters vergessen, sobald er aus dem Zimmer trat. Er atmete erleichtert auf und war froh, dass er erst in sieben Tagen zurückkehren musste.

Mein Name ist Rumpelstein
Berlin, Kinderheim Elisabethstift, Oktober 2012
Will blickte aus dem Fenster seines Zimmers. Es war zur Straße ausgerichtet. Leise drang der Lärm vorbeifahrender Autos durch die Scheibe. Sie waren es jedoch nicht, die seine Aufmerksamkeit geweckt hatten, sondern die Krähe, die auf dem Baum saß, der direkt vor dem Eingang des Kinderheims stand.
Sie hatte ihren Kopf in Wills Richtung gedreht und machte den Eindruck, als würde sie ihm direkt in die Augen starren. Die Blätter des Baumes waren gelb verfärbt, sodass die Krähe mit ihrem glänzenden schwarzen Gefieder umso besser zu erkennen war. Es war bereits später Nachmittag und die Dämmerung zog herauf.
Der Vogel erinnerte Will unweigerlich an seinen Vater. Am liebsten hätte er das Fenster geöffnet und das Tier verscheucht.
Was hatte sein Vater noch gleich über Krähen gesagt? Sie wären die Späher der bösen Königin? Nein, nicht Krähen. Raben waren es gewesen. Gab es da überhaupt einen Unterschied?
Maggy hätte es sicher gewusst, aber Will wollte sie nicht stören. Schon gar nicht mit so etwas Belanglosem. Dann hätte er zugeben müssen, dass ihn die Verrücktheiten seines Vaters doch mehr berührten, als er bereit war, sich einzugestehen.
Es klopfte an seiner Zimmertür. Er wandte ertappt den Blick vom Fenster und rief: »Herein.«
Joe, Maggys ein Jahr älterer Bruder, streckte den blonden Haarschopf zur Tür herein. »Du hast Besuch«, teilte er ihm verdutzt mit.
Will runzelte die Stirn. Er bekam nur selten Besuch, vor allem keinen unangekündigten. Hatte er womöglich einen Termin mit der Betreuerin vom Jugendamt vergessen?
»Wer ist es?«
»Das ist ein ganz seltsamer Kauz«, raunte Joe, als er eintrat und geheimnistuerisch die Tür hinter sich schloss. »Den musst du dir ansehen.« Ein spitzbübisches Grinsen trat auf sein Gesicht und ließ Grübchen in seinen Wangen entstehen. Er hob seine Hand in Höhe seiner Taille. »Er ist nur so groß und geht ganz krumm, als hätte er einen Buckel.« Glucksend ahmte er die Bewegung nach.
»Verarschst du mich?«, erwiderte Will skeptisch, denn das hätte Joe ähnlichgesehen. Er machte gern Scherze und freute sich diebisch, wenn man auf sie hereinfiel.
»Nein, ich schwöre«, lachte sein Freund und hob abwehrend seine Hände. »Sieh ihn dir doch selbst an. Er wartet in unserer Küche auf dich.«
»Hat er gesagt, wie er heißt und was er von mir will?«
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739425054
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2018 (Juli)
- Schlagworte
- Grimm Rumpelstilzchen Märchenadaption Märchen Schneewittchen Königin Vampire Romance Fantasy düster dark Urban Fantasy Episch High Fantasy