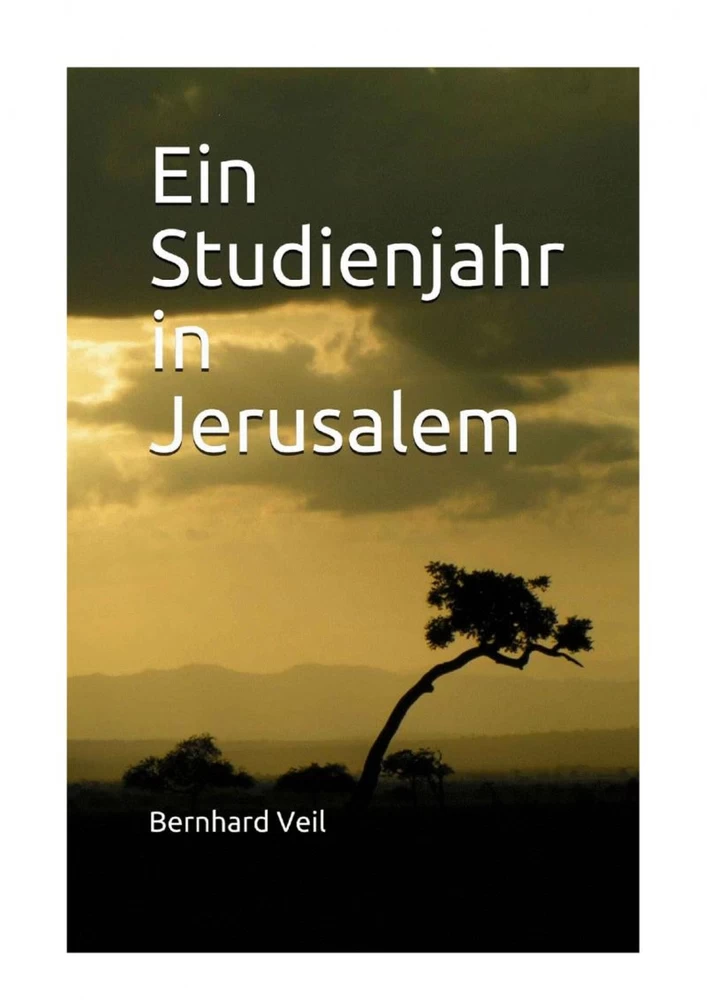Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Als „Thomas“ in Israel studierte, gab es noch kein Handy, kein Smartphone und kein Internet. Ein Brief von Israel nach Deutschland dauerte vierzehn Tage und ein Päckchen auf dem Seewege sechs Wochen. Private Telefongespräche ins Ausland mussten beim Fernmeldeamt angemeldet werden, eine Verbindung wurde zumeist in der Nacht durchgestellt, weil geschäftliche und amtliche Gespräche bevorzugt abgewickelt wurden. Der Sinai war noch von Israel besetzt und die politische Lage mit den Nachbarstaaten äußerst angespannt, zumal der Jom-Kippur-Krieg (Oktober 1973) gerade mal zwei Jahre zurücklag. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel gestaltete sich schwierig, bei vielen Israelis war verständlicherweise die Abneigung gegen alles, was „deutsch“ ist, immer noch sehr groß. Was Thomas dort erlebte und wie er seine Zeit nützte, wird im vorliegenden Buch geschildert.
Studium an der Dormitio-Abtei
Während meiner Studienzeit war ich sehr viel zu Fuß in Jerusalem unterwegs und nahm jede Gelegenheit wahr, kleinere und größere Touren durch Israel zu unternehmen. Gleich zu Beginn meines Studiums war mir klar, dass ich nur dann von diesem faszinierenden Land und den unterschiedlichsten Menschen etwas mitbekomme, wenn ich mich von der heilen, abgehobenen Welt der Theologischen Hochschule der Dormitio-Abtei loslöse und mich vom Wohnheim der Studenten „abseile“. Da uns zu Beginn des Semesters mitgeteilt wird, dass nicht alle Studenten im Wohnheim untergebracht werden können und einige von uns in der Stadt in einem Hotel wohnen müssen, melde ich mich sofort für die Unterbringung im Hotel an. Die Abtei hat in einem äußerst einfachen Ein-Sterne-Hotel ein paar Zimmer angemietet, das zwischen der Zitadelle am Jaffa-Tor und dem Neuen Tor hinter dem Lateinischen Patriarchat in der Altstadt liegt. Es nennt sich „Knights-Palace-Hotel“, also „Ritterpalast“! Ursprünglich war es eine im neugotischen Stil errichtete Pilgerherberge mit hohen Zimmern und spitzbogenförmigen Fenstern. Später wurde es umgebaut und zwar so, dass jeweils ein Zimmer durch eine Mauer in der Mitte abgeteilt wurde und somit zwei schmale Einzelzimmer geschaffen wurden, wobei im Eingangsbereich dieser beiden Einzelzimmer ein kleiner Vorraum für eine Dusche abgeteilt wurde, die nun von beiden Zimmerbewohnern benutzt werden kann. Diese Unterbringung außerhalb des Abteigeländes ist für mich ideal, um auf eigene Faust das Land zu erkunden und mich vom festgezurrten Studienbetrieb abzusetzen. Bald darauf schießt mir der Gedanke durch den Kopf, ob es wohl möglich ist, vielleicht schon im ersten Semester dieses Studienjahres alle erforderlichen Prüfungen und schriftlichen Arbeiten zu absolvieren, die in der Prüfungsordnung der Theologischen Fakultät festgelegt sind. Danach könnte ich in diesem hochinteressanten Land herumreisen und meine eigenen Erkundungen anstellen. Da ich aber ein Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) bekomme, ist die Teilnahme an den vorgeschriebenen Seminaren und das Bestehen sämtlicher Prüfungen obligatorisch, ansonsten müsste ich nämlich dieses Stipendium wieder zurückerstatten. Also gehe ich mit großem Eifer daran, gleich im ersten Semester möglichst alle obligatorischen Referate und sämtliche Seminararbeiten zu verfassen und die erforderlichen Prüfungen abzulegen, damit ich im zweiten Semester genügend Zeit habe, einige Reisen durch Israel, durch die Sinaihalbinsel und, wenn möglich, durch das benachbarte Jordanien zu unternehmen.
Mein Zimmer im Knights-Palace-Hotel ist ein sehr kärglich eingerichtetes Gemach. Das Inventar besteht aus einem eisernen Bettgestell, einem alten, zerkratzten und schwer angerempelten Kleiderschrank sowie aus einem kleinen runden Tischchen mit zwei Klappstühlen. Die drei alten muffigen Matratzen in diesem Bett, auf die man sich lediglich zwischen zwei Leintüchern hinlegen kann, erscheinen mir bei näherer Betrachtung nicht ganz geheuer zu sein. Sie haben, wie wir so zu sagen pflegen, ein „Geschmäckle“. Und als ich mich in meinem Zimmer noch genauer umsehe, bemerke ich an der Wand, wie langsam ein Gecko hinaufkriecht, um sich vor mir in Sicherheit zu bringen. Da ich nicht weiß, dass diese Geckos durchaus nützliche Tieren sind, weil sie sich darauf spezialisiert haben, lästiges Ungeziefer zu vertilgen, versuche ich dieses echsenartige Wesen mit einem Besen zum Fenster hinaus zu bugsieren. Doch dieses verdammte Miststück zieht sich mit seinen Saugnäpfen ganz hinauf in die gewölbte Decke hoch. Ich steige auf mein rundes Tischchen, doch selbst von hier aus kann ich es nicht mehr erreichen. Da ich mich aber auf die Gründlichkeit des Reinigungspersonals nicht verlassen will, gehe ich erst einmal in die Stadt und besorge mir ein Ungeziefer-Desinfektionsspray, um die Matratzen zu desinfizieren. Das Bett, den Schrank, den Tisch und beide Stühle reinige ich gründlich mit Putzmittel und Lappen, die ich aus der Besenkammer in der frei zugänglichen Gäste-Toilette des Hotels besorge. Weil ich aber partout mit dem Gecko mein Zimmer nicht teilen will, mache ich mich nun erneut daran, ihn mit einer Schachtel einzufangen, die ich mir beim Küchenpersonal besorgt habe. Doch wieder entzieht er sich mir in den für mich unerreichbaren Spitzbogen des Zimmers. Schließlich gebe ich meinen Kampf gegen diese eigenwillige Kreatur entmutigt auf, öffne das Fenster in der Hoffnung, dass er in der Nacht von alleine verschwindet und sich vielleicht etwas nahrhafteren Jagdgebieten zuwendet.
Dass meine Skepsis in puncto Sauberkeit schon beim Einzug in dieses Hotel durchaus angebracht war, bestätigt sich im Laufe der kommenden Wochen und Monate, in denen ich hier als ständiger Gast nun gezwungenermaßen so allerhand mitbekomme. Denn mit der Zeit lernt man die Arbeitsmoral des arabischen Personals bestens kennen und bekommt einen sehr guten Einblick in die Gepflogenheiten der hier arbeitenden Bevölkerung, was einem normalen Touristen oder Pilger, der nur wenige Tage oder mitunter auch mal eine Woche in Jerusalem verweilt, gar nicht auffällt.
Mein Zimmer liegt im Erdgeschoss des Hotels nur wenige Schritte vom Haupteingang entfernt. Der Ausblick aus dem Fenster ist allerdings sehr düster. Wenn ich die eisernen Fensterläden zurückschiebe, blicke ich in einen betonierten Hinterhof, der in keiner Weise genutzt wird und deshalb total leer und kahl ist. Ab und zu erscheinen lediglich einige Angestellte und rauchen eine Zigarette, ansonsten ist es da draußen völlig ruhig. Links und rechts wird der Innenhof eingerahmt durch die hässlichen Wände des Hotels, gegenüber wird die Sicht versperrt durch die Jerusalemer Stadtmauer, deren grob gemauerte Zinnen die einzigen architektonisch interessanten Bauteile des gesamten Areals bilden. Ab und zu kommen ein paar Touristen auf der Verteidigungsrampe der Stadtmauer vorbei und schauen meist durch die Zinnen hinüber zur Neustadt. Ganz selten dreht sich mal einer um und blickt auf den kahlen Hof des Hotels herein, so dass ich mein Fenster bedenkenlos offenstehen lassen kann und mich relativ ungestört meinen Studien und Schreibarbeiten widmen kann.
Wem dieses Knights-Palace-Hotel gehört, ist mir nicht bekannt, jedenfalls wird es von drei älteren Nonnen einer niederländischen Schwesternkongregation geführt, die sich sehr modern und aufgeschlossen zeigen, indem sie tagsüber zumeist in ziviler Kleidung herumlaufen und das arabische Personal beaufsichtigen, das ausschließlich aus Männern besteht.
Mit sieben weiteren Studenten bin ich hier untergebracht und nehme täglich im Speisesaal meine Mahlzeiten ein, die uns an einem langen Tisch serviert werden. So sehr unsere Kellner rein äußerlich auf „gewisse Etikette“ achten, so sehr nerven sie uns auch mitunter gewaltig, vor allem, wenn sie uns morgens, mittags und abends unsere Speisen äußerst langsam und umständlich servieren. Obwohl sie zu dritt oder zu viert permanent um uns herumschlawenzeln, dauert es sehr lange, bis wir endlich unsere Mahlzeiten serviert bekommen und alle drei Gänge einnehmen können. In der orientalischen Welt ticken die Uhren anders. Sie scheinen nicht verstehen zu können, dass wir pünktlich zu Beginn der Vorlesungen in der Hochschule sein müssen und sonst zwischendurch noch studieren, die Prüfungen ablegen und unsere wissenschaftlichen Seminararbeiten verfassen müssen.
Viel lieber wäre es uns natürlich, wenn wir unser Essen an einer Theke selbst abholen könnten, dann wären wir ihren wechselnden Launen nicht ständig ausgesetzt und müssten auch auf ihre übersteigerte „Kellner-Ehre“ nicht unentwegt Rücksicht nehmen. Sobald wir uns mal etwas selbst holen möchten, weil es uns wieder einmal zu lange dauert, sind sie zutiefst beleidigt. So sind wir den mitunter starken Stimmungsschwankungen dieser Burschen unentwegt ausgeliefert, zumal die Nonnen sich aus dem Alltagsgeschäft so ziemlich heraushalten. Je vertrauter im Laufe der Zeit uns diese Kellner werden, desto mehr nehmen sie sich uns gegenüber heraus. Manchmal lassen sie uns sogar so lange warten, bis die Suppen oder die Speisen wieder kalt geworden sind, bisweilen ist auch das Fleisch nicht ordentlich durchgegart oder sogar schon verbrannt, so dass es völlig ungenießbar ist. Unsere Beschwerden bei den Schwestern laufen immer ins Leere. Vermutlich haben sie ihr Personal nicht im Griff, womöglich aber glauben sie uns unsere Beanstandungen auch nicht, denn sie behaupten jedes Mal, dass sie oben in ihrem Speisezimmer genau dasselbe Essen bekommen würden wie wir. Dabei ist es sogar mehrmals in einer Woche schon vorgekommen, dass uns morgens jeglicher Appetit vergangen ist, wenn wir mit dem Eierlöffel unsere Frühstückseier aufschlugen und ein unerträglicher Gestank sich über unserem Achtertisch breit machte. Selbst die immer gleich harten Brötchen und die chemisch künstlich riechende Orangenmarmelade schmecken bei solch einem Ereignis dann überhaupt nicht mehr. Das Fleisch ist meistens derart zäh, dass es trotz langem Kauen nicht hinuntergeschluckt werden kann. So bleiben mir oft nur die fettig-lappigen und zumeist kalten Pommes übrig, die ich mit etwas Senf hinunterwürge. Die Folge dieser einseitigen und miserablen Ernährung ist, dass ich ständig Durchfall habe und mir oft schon der Appetit vergeht, wenn ich den Speisesaal betrete. Manche meiner Mitstudenten drücken ihren Frust bei diesen Mahlzeiten dadurch aus, indem sie die Kellner mit überlautem Gejohle begrüßen, wenn ihnen mal wieder irgendeine eigenartige Überraschung serviert wird. Doch dieses Verhalten stachelt das Bedienungspersonal nur noch mehr an, uns in burschikoser und rüpelhafter Weise zu bedienen.
Weder Tee noch Tabletten helfen mir, meine Magen- und Darmprobleme zu lindern. Die ölig-fettigen Speisen kann ich kaum vertragen und bald kommt es immer häufiger vor, dass die ganze Mahlzeit, wenn ich zurück in meinem Zimmer bin, blitzartig aus mir herausschwappt und im Waschbecken verschwindet. Die Folge dieser ungesunden Lebensweise ist, dass ich immer leichtgewichtiger werde, obwohl ich ohnehin schon ziemlich schlank bin. Wer an dieser Unterkunft, Kost und Verpflegung am meisten verdient, kann ich nur vermuten. Ob die Abtei einen viel zu niedrigen Preis ausgehandelt hat, so dass die Nonnen kaum etwas bekommen, ob diese Klosterfrauen mit dem Geld nicht richtig wirtschaften können und ihre Einnahmen für andere „christliche Zwecke“ verwenden oder ob das arabische Küchenpersonal uns Studenten lediglich mit miserablen Fressalien abspeist und vom Hoteleinkauf die besten Fleischstücke in die eigenen Töpfe wandern lässt, darüber kann ich nur spekulieren. Möglicherweise verdienen jedoch alle „Drei im Bunde“ an unseren Stipendien ganz gut, die wir schon in Deutschland an die Abtei abtreten mussten, weil angeblich die Inflationsrate in Israel so hoch sei und außerdem uns hier das Geld auf sonstige Weise abhandenkommen könnte.
Doch diese miserable Verköstigung halte ich nicht mehr aus. Dieser Umstand spornt mich nun umso mehr an, sämtliche Prüfungen und Seminararbeiten schon im ersten Semester so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, damit ich mir in der Stadt eine andere Unterkunft suchen und mich selbst verpflegen kann. Deshalb belege ich an der Hochschule sehr interessante Seminare und faszinierende Vorlesungen, verfasse drei Seminararbeiten und nehme im laufenden Semester noch an fünf Prüfungen teil, um die Auflagen des DAAD (Deutschen Akademischen Austauschdienst) zum Erhalt meines Stipendiums so schnell wie möglich zu erfüllen.
Besonders fesselnd sind für mich die archäologischen Vorlesungen über die „Topographie Jerusalems“. Diese Vorlesungen werden durch Exkursionen zu den verschiedensten Ausgrabungsstätten ergänzt, bei denen wir an Ort und Stelle die dazu entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse erfahren. Mehrere Professoren beleuchten aus ihren unterschiedlichen Sichtweisen die Hintergründe der historischen Orte, so dass wir von den alt- und neutestamentlichen Exegeten sowie von Dozenten der Archäologie die neuesten Erkenntnisse aus der Geschichtsforschung erklärt bekommen. Auf diese Weise wird uns ein sehr realistisches Bild der biblischen Lebenswirklichkeit vermittelt.
Auch die Vorlesung des bekannten jüdischen Schriftstellers Schalom Ben Chorin über die „Strukturen einer Theologie des Judentums anhand des maimonidischen Credo“ faszinieren mich ungemein, so dass ich mich dazu entschließe, am Ende des Semesters über den von ihm vorgetragenen Lehrstoff eine Semesterprüfung abzulegen. In die Welt des Islams werden wir von Professor Dr. Buhrbag eingeführt, die mich ebenfalls in den Bann zieht. In seinem Seminar über die islamischen Herrscherdynastien verfasse ich eine schriftliche Arbeit über „Die Abbasiden“, und nachdem ich meine Arbeit im Seminar vorgetragen und sie vom Professor zusammen mit den Mitstudenten diskutiert und besprochen habe, äußert er sich sehr wohlwollend über meine Leistung und zensierte mein Referat mit einer glatten Eins. Allerdings muss ich nun aufgrund dieser guten Zensur in den folgenden Tagen immer wieder den Spott meines Studienkollegen Franz ertragen, der diese „gönnerhafte“ Benotung dahingehend interpretiert, dass der Professor eine gewisse Schwäche für meine Person gezeigt habe, wie er es angeblich während meines Vortrages genau an ihm beobachten konnte. Deshalb habe, so behauptet Franz süffisant, diese Benotung absolut nichts mit meiner angeblich „brillanten“ Leistung und schon gar nichts mit meinem Wissensstand über den Islam zu tun. In sarkastischen Bemerkungen bespöttelt mich Franz immer wieder und behauptet, dass ich diese gute Note nach seiner Meinung lediglich nur dem Umstand zu verdanken habe, dass Buhrbag mich als seinen „Lieblingsschüler“ auserkoren und dieser Professor sich schlichtweg in mich „verguckt“ habe. Seine spitzfindige Annahme stützt er auch darauf, dass Buhrbag sich regelmäßig in den Pausen und am Ende seiner Seminarsitzungen an mich wandte, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Anfangs will ich seine frotzelnden Bemerkungen gar nicht so richtig wahrhaben. Doch alsbald fragt mich Professor Buhrbag doch tatsächlich, ob ich denn nicht Interesse daran hätte, mit ihm zusammen interessante Gedichte und schön-geistige Literatur zu lesen. Auf meine Frage, welche Art von Literatur er denn meine, schlägt er sofort seinen Lieblingsschriftsteller Stefan George vor. Allerdings hält sich mein Interesse für solche außerplanmäßigen Lesungen sehr in Grenzen, da ich ja so schnell wie möglich meine Semesterprüfungen hinter mich bringen und aus dem Hotel ausziehen möchte, um auf eigene Faust das Land Israel zu erkunden. Doch der Professor lässt sich leider nicht so einfach abwimmeln. Wiederholt stellt er mir die geistige Bereicherung einer privaten Literaturlesung als überaus erlebnisreiches Ereignis vor und lädt mich nachmittags zu Spaziergängen durch die Altstadt von Jerusalem ein, um mich dabei noch mehr in die „arabische Welt“ einführen zu können. Auch bei diesen Spaziergängen kommt er immer wieder auf die privaten Dichter-Lesungen zu sprechen, die im privaten Kreis für jeden Beteiligten ein bleibender persönlichen Gewinn sei, zumal sie hier in der faszinierenden Umgebung von Jerusalem stattfinden, an die wir uns sicherlich später gerne zurückerinnern werden. Außerdem möchte er auch bei dieser Gelegenheit die Chance nützen, noch besser die Denkweise seiner Studenten kennenzulernen, da er ja auch sehr daran interessiert sei, wie wir junge Männer heutzutage leben und denken und unseren Alltag gestalten würden. Aus diesem Grunde schlage er vor, dass er mich einfach einmal unkompliziert in meinem Zimmer im Hotel besuche, um mit mir zusammen diese Gedichte von Stefan George zu lesen. Doch als er mir diesen Vorschlag unterbreitet, gerate ich in höchste Alarmstimmung. Der Professor bei mir in meinem kleinen Zimmer? Zutiefst bedaure ich nun, dass ich mich so persönlich auf ihn eingelassen habe und mit ihm durch die Altstadt gewandert bin. Zaghaft weise ich ihn darauf hin, dass mein Zimmer doch viel zu eng und zu ungemütlich für eine solche Lesung sei, da kaum zwei Leute bequem nebeneinander auf zwei Stühlen darin Platz fänden. Doch dieses Argument wischt er schnell beiseite. Im Gegenteil, gerade eine solch schlichte Behausung fände er ideal und passend für diese Gedichte, die in solch einem bescheidenen Schauplatz vorgetragen erst voll zur Geltung kämen. Was ich auch sage und wie ich auch argumentiere, der Professor findet alles grandios und super ideal, um seine literarische Schriftlesung in meiner Bleibe durchführen zu können. Er zieht seine Schlinge immer mehr um meinen Hals, so dass ich kaum Luft zum Atmen habe. Mit gezücktem Terminkalender steht er mir gegenüber, so dass ich geradezu den Eindruck habe, dass es ihm sogar einen gewissen Spaß macht, mich so „zappeln“ zu sehen, wie ich vergeblich versuche, mich vor diesem Termin zu drücken. Ich komme mir vor wie eine Maus, die von einer Schlange fixiert wird, um schon im nächsten Augenblick von ihr verschlungen zu werden. Machtlos, fast willenlos stimme ich zu, genüsslich schlägt Buhrbag den kommenden Donnerstag nachmittags um 15 Uhr vor, den er als privaten „Vorlesungstermin“ in seinem Kalender einträgt. Mit großem Herzklopfen verabschiede ich mich höflich von ihm und gehe so schnell wie möglich zu Franz, dem ich mein Dilemma beichte.
Sehr aufgeregt und mit hochroten Wangen suche ich bei ihm Hilfe:
„Franz, ich muss unbedingt mit dir reden.“
„Was ist denn mit dir los? Was hast du denn?“, fragt er überrascht und frotzelt, „na, warst du wieder mit deinem Professor spazieren?“
„Du weißt genau, dass mir das alles sehr peinlich ist!“, halte ich ihm entgegen, „ich weiß einfach nicht, wie ich da wieder herauskommen soll? Er will mit mir zusammen jetzt unbedingt auch noch Gedichte von Stefan George lesen! Und das auch noch in meinem Zimmer!“, berichte ich ihm verzweifelt.
Doch Franz bekommt einen Lachanfall und sagt:
„Das hast du jetzt davon! Ja, ja, so ist es eben, wenn man im Seminar so gute Noten schreibt! Die Herren Professoren haben halt immer etwas übrig für solche kleinen Streber, die brav und eifrig ihre Hausaufgaben machen.“
„Du weißt genau, dass ich nichts dafür kann! Oder wie dumm und dappig soll ich mich denn anstellen, damit er sich für mich nicht mehr interessiert?“, versuche ich ihm, meine Situation zu erklären und bitte ihn dringend:
„Du musst unbedingt bei diesem Termin mit dabei sein! Alleine stehe ich so eine „Lesung“ nicht durch!“
„Aber ich kann doch nicht einfach bei deinem Tete-a-tete mit anwesend sein? Was würde denn der Professor dazu sagen?“, wendet er ein, um sich vor dieser für ihn anscheinend unangenehmen Aufgabe zu drücken.
„Doch! Du kannst ohne weiteres bei dieser Lesung mit dabei sein, da du dich ja ohnehin für schön-geistige Literatur interessierst! Das hast du mir schon einige Male mit deiner ausgezeichneten Literaturkenntnis bewiesen! Oder etwa nicht? Und wenn wir ihm sagen, dass du ebenfalls bei solch einer Dichter-Lesung mitmachen möchtest, dann kann er doch nichts dagegen einwenden? Ach bitte, hilf mir doch!“, flehe ich ihn an.
Nach längerem Hin und Her gibt Franz schließlich nach und lästert:
„Na gut, dann komm ich halt zu eurem Privatunterricht. Dann werde ich deine Gouvernante spielen und schön auf dich aufpassen, dass der Professor dir nicht ans Eingemachte geht.“
Mit einem unguten Gefühl räume ich am Donnerstag im Hotel mein Zimmer auf, hole im Speisesaal auf einem Tablett drei Kaffeegedecke und einen Teller, auf den ich das Gebäck legen kann, das ich in der Stadt eingekauft habe, richte alles mit Servietten auf meinem kleinen runden Tischchen her und leihe mir vom Portier einen dritten Stuhl, der neben den beiden anderen kaum noch Platz hat. Als es 15 Uhr ist, gehe ich zu Franz und bitte ihn herüberzukommen, damit ich nicht allein den Professor empfangen muss. Schließlich soll er gleich bei seinem Eintreffen erfahren, dass wir gemeinsam an seiner Stefan-George-Lesung teilnehmen möchten. Franz macht sich lustig über mich, weil ich es so ernst nehme und meint:
„Nur nicht so hektisch, du musst dich schon noch etwas gedulden, bis dein Verehrer kommt, denn Professoren sind es üblicherweise ja gewohnt, dass sie mit ihren Vorlesungen „cum tempore“ beginnen! Du darfst also noch mindestens ein Viertelstündchen warten, bis er eintrudelt.“
Leicht genervt von seiner spöttischen Gelassenheit gehe ich wieder zurück in mein Zimmer und treffe geradewegs auf Professor Buhrbag, der in Begleitung des Portiers in der Halle auf mich zukommt. Fasziniert über das „altertümlich geschichtsträchtige Haus“, in dem ich wohne, begrüßt Buhrbag mich freudestrahlend und ich sehe es ihm an, dass er sich ganz auf diese Mußestunde eingestellt hat und schöngeistige Literatur genießen möchte. Höflich führe ich ihn in meine bescheidene Behausung und eröffne ihm, dass sogleich auch mein Studienfreund Franz vom Nachbarzimmer zu uns herüberkommen wird, um ebenfalls an der Dichterlesung teilzunehmen, da er sich sehr für Poesie und überhaupt für jegliche Art von Literatur interessieren würde. Schnell übergehe ich den enttäuschten Gesichtsausdruck des Professors, indem ich ihm mein kleines Zimmer zeige, öffne die beiden Fensterflügel, damit er freie Sicht auf unseren öden Hinterhof hat und ermögliche ihm somit den Anblick der Jerusalemer Stadtmauer, die vermutlich seit Jahrhunderten keine Ausbesserungsmaßnahme mehr gesehen hat und hier von der Stadtinnenseite aus einen sehr desolaten Eindruck macht. Überaus angetan von dieser Art zu wohnen, nimmt der hochdotierte Islamgelehrte an meinem Tischchen Platz. Artig versuche ich, ein freundliches Gespräch mit ihm zu führen in der Hoffnung, dass Franz doch möglichst bald herüberkommen möge und ich nicht allzu lange mit diesem Professor alleine in meinem Zimmer verbringen muss. Als nach geraumer Zeit, die mir viel zu lange gedauert hat, endlich auch Franz hereinkommt und höflich Herrn Buhrbag begrüßt, setzt er sich auf den dritten Stuhl, den ich mir besorgt hatte. Die räumliche Enge verschafft uns allerdings ein großes Problem. Da wir bei dieser dicht gedrängten Sitzweise nicht so recht wissen, wohin wir unsere Beine platzieren sollen, um mit unseren Knien einander nicht ins Gehege zu kommen, dauert es eine Weile, bis wir uns mit unseren Füßen geeinigt haben. Nach längerem Geplauder zieht Buhrbag frohgelaunt ein kleines, altes und schon leicht zerfleddertes Büchlein aus seiner Jacke heraus und beginnt, einige Gedichte von Stefan George vorzulesen. Nach eingehender Interpretation kommen wir zwischendurch auf andere Themen zu sprechen, bis nach etwa eineinhalb Stunden der Professor vorschlägt, die Lesung mit einem kleinen Rundgang durch den Suq (arabisches Händlerviertel in der Altstadt) zu beenden. Franz entschuldigt sich sofort, dass er keine Zeit dazu habe, weil er unbedingt noch an seiner Seminararbeit schreiben müsse. Somit bleibt mir nichts anderes übrig, als alleine mit Professor Buhrbag durch die engen Gassen der Jerusalemer Altstadt zu wandern, der mir an jeder Ecke sein spezielles Wissen über die arabische und jüdische Lebenswelt offenbart und mit diesem und jenem Händler auf arabisch ein paar Worte plaudert. Schnell verrinnt die Zeit bei diesem bunten Treiben und als ich auf meine Uhr schaue, ach, oh Schreck! Das Abendessen im Hotel beginnt bereits in fünf Minuten! Schnell erkläre ich dem Professor, dass ich das Essen keinesfalls versäumen darf. Da ich mich nicht abgemeldet habe, werde für mich von der Küche nichts zurückgelegt, so dass ich heute dann nichts mehr zu essen bekommen würde. Daraufhin will Buhrbag mich unbedingt in ein Restaurant einladen, doch ich lehne freundlich und entschieden ab, da ich mich außerdem noch auf einige anstehende Prüfungen vorbereiten müsse. Bevor wir uns trennen, bedankt sich Professor Buhrbag sehr herzlich für diesen schönen Nachmittag und meint, dass wir diese Dichterlesung unter allen Umständen fortsetzen sollten. Da ich meinen Terminkalender nicht dabeihabe, schlage ich vor, ein erneutes Treffen vorerst noch offen zu lassen, womit er allerdings nicht einverstanden ist. Er besteht darauf, dass wir es nicht dem bloßen Zufall überlassen dürfen, sondern uns zu dieser „Lesung“ möglichst jede Woche um dieselbe Zeit am selben Ort treffen sollten. Rasch verabschiede ich mich und eile ins Hotel.
Etwas verspätet komme ich zum Abendessen. Meine Studienkollegen sitzen bereits um den Tisch und werden eifrig von den Kellnern bedient. Franz bemerkt meinen unglücklichen Gesichtsausdruck und fragt neugierig:
„Na? Wie ist denn dein Nachmittag vollends verlaufen?“
Zurückhaltend antwortete ich, dass ich im Suq noch etwas eingekauft habe und stoße ihn unter dem Tisch mit dem Fuß an, um ihm zu bedeuten, dass ich nicht darüber reden möchte. Kaum war das Abendessen beendet, gehe ich mit Franz aufs Zimmer und erzähle ihm, wie ich mit Buhrbag durchs Händlerviertel gebummelt bin und, dass auf Wunsch des Professors das ganze „Prozedere“ sich nächste Woche wiederholen soll.
„Du wirst doch nicht erwarten, dass ich nochmals deine Gouvernante spiele? Da musst du dir dann schon einen anderen suchen! So etwas mache ich nicht noch einmal mit!“, lehnt er eine Teilnahme an einer zweiten Dichterlesung entschieden ab.
„Aber was soll ich denn machen? Franz, du musst mir unbedingt helfen, denn ich weiß nicht, was ich tun soll!“, flehe ich ihn an.
Äußerst amüsiert über diese delikate Geschichte und wohl auch etwas unentschlossen, ob er mir aus meinem Dilemma heraushelfen soll, zumal ja dann diese für ihn unterhaltsame und lustige Story vorbei ist, gibt er sich kompromissbereit und erteilt mir den Rat, es nun eben bei dem bereits vereinbarten Termin zu belassen. Danach könnte ich ja weitere Treffen dann ruhig ablehnen mit der Begründung, dass ich mich intensiv auf das Studium und die anstehenden Prüfungen konzentrieren müsse.
Am kommenden Donnerstagnachmittag läuft alles ähnlich ab wie eine Woche zuvor. Der Professor genießt die Lesung in meinem kleinen Zimmer, für mich aber ist es eine wahre Tortur. Allein schon, dass es durch einen zusätzlichen Stuhl an meinem Tischchen viel zu eng ist und ich nicht so recht weiß, wohin ich beim Sitzen meine Knie ausstrecken soll, um nicht mit den Beinen des Freundes oder mit denen des Professors zu kollidieren, ist für mich eine äußerst beklemmende Situation. Hinzu kommt noch die euphorische Schwelgerei im Olymp freundschaftlicher Begegnungen, die Stefan George in seinen Gedichten inbrünstig zum Ausdruck bringt. Dieses Gesäusel geht mir derart auf den Geist, dass ich kaum etwas zu den anschließenden Interpretationen beitragen kann. Aber auch meine persönlichen Empfindungen will ich nicht offen aussprechen, um den Professor nicht zu brüskieren. So gerate ich immer mehr ins Schwitzen und bin schließlich heilfroh, als nach etwa eineinhalb Stunden diese Strapaze wieder vorbei ist.
Am Ende der Sitzung lehne ich freundlich einen erneuten Spaziergang durch die Altstadt ab, da ich ebenfalls wie Franz mich auf eine bevorstehende Prüfung vorbereiten müsse. Professor Buhrbag hat vermutlich inzwischen bemerkt, dass sich meine geistigen Beiträge zu dieser Dichtkunst sehr in Grenzen halten und er sich diese privaten Lesestunden wohl nicht mit mir alleine „in angenehmer Zweisamkeit“ zu Gemüte führen kann. Somit besteht er auch nicht mehr darauf, einen weiteren Termin zu vereinbaren. Allerdings lässt er sich es nicht nehmen, in den folgenden Wochen mich gelegentlich zu einem Spaziergang durch den Suq einzuladen. Dabei zeigt er mir viele typische Eigenarten der arabischen Händler, Handwerker und Zuckerbäcker und erzählt mir allerhand Geschichten über ihre Gebräuche und Gepflogenheiten. Hier im Trubel der Touristen, Händler und Geschäftsleute fällt mir die lockere Kommunikation mit ihm viel leichter, da ich mich in Anwesenheit der vielen Leute wesentlich wohler fühle als in meinem engen Zimmer, zumal ich auch hier auf meinen spöttelnden Studienfreund als „Begleitschutz“ nicht angewiesen bin.
Arabischer Service
Mittlerweile wohnen wir schon über drei Monate im Knights-Palace-Hotel. Im November hat die Regenzeit begonnen, der Touristenstrom ist abgeflaut, so dass wir Studenten seit einigen Wochen die einzigen Gäste im Hotel sind. Um der Eintönigkeit ihres grauen Hotelalltags etwas mehr Farbe zu gebe, denken sich unsere Kellner immer wieder neue Späßchen aus, mit denen sie uns beim Servieren der Speisen unterhalten, bisweilen aber auch gehörig nerven können. Je mehr wir uns auf sie einlassen, desto vertrauter, undisziplinierter und nachlässiger wird ihre Arbeitsweise. Auch das ist ein Grund dafür, dass ich fest entschlossen darauf hinarbeite, das vorgeschriebene Prüfungspensum möglichst schon im ersten Semester hinter mich zu bringen, damit ich im zweiten Semester nach Weihnachten aus diesem Hotel ausziehen und eventuell mit meinem Studienfreund Franz in der Stadt ein Zimmer mieten kann.
Die Kellner tragen bisweilen das Essen so langsam und so gemächlich auf, balancieren die Töpfe und Schüsseln über ihren Köpfen hinweg, tänzeln dabei mit lautem Gejohle in den Speisesaal herein und bewirten uns mit allerlei Grimassen, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt. Manchmal lassen sie uns zwischen den drei Gängen, die uns beim Mittagstisch serviert werden, besonders lange warten und strapazieren unsere Geduld oft unerträglich. Dabei werden wir jedes Mal, wenn sie uns etwas auf den Teller legen, ironisch mit dem deutschen Spruch ermahnt „Eile mit Weile, Eile mit Weile“, und das aber nicht in einem gemächlichen Tonfall, sondern in zackig, barschem Befehlston. Obwohl sie ansonsten kein Deutsch verstehen und wir uns mit ihnen nur auf Englisch verständigen können, wollen sie uns immer zu verstehen geben, dass wir hier im vorderen Orient seien, in der arabischen Welt und nicht in unserem hektischen, umtriebigen und durchorganisierten Deutschland! Hier gehen die Uhren anders, hier hat man Zeit, vor allem, wenn es ums Essen geht. Als wir bei unseren Mahlzeiten ständig mit dieser extrem langsamen und behäbigen Bedienungsweise hingehalten werden, wenden wir uns wieder einmal an die Nonnen, die doch tatsächlich bereit sind, diesen Missstand abzustellen. Allerdings werden beim nächsten Mittagessen die Speisen uns so unfreundlich und deftig auf den Tisch geknallt, dass wir unsere Beschwerde bei den Schwestern zutiefst bereuen. Denn die erbosten Kellner kommentieren nun unsere schnelle und hektische Essensweise mit den Worten:
„Schnell, schnell, immer schnell! Arbeiten, arbeiten, immer schnell arbeiten…!“
Ein andermal lassen sie ihren arabischen Frust über den jüdischen Staat Israel an uns aus, indem sie jedem von uns das Schnitzel mit Püree in militärischer Zickzackmanier in unsere Teller hauen und uns zurufen:
„Hitler gut! Eichmann gut! Dachau gut! Deutschland gut!“
Wir sind sehr empört über diese judenfeindlichen Äußerungen und weil sie sich von uns nicht in die Schranken weisen lassen, beschweren wir uns wieder bei den Nonnen über ihre nazi-verherrlichenden Parolen und ihre militärisch-zackigen Bedienungsmanieren. Auch dieses Vorkommnis bedauern die Klosterfrauen sehr und versprechen uns, dass sie sofort dagegen einschreiten und es abstellen werden.
Doch abgesehen von solchen äußerlichen Umständen macht mir das Essen immer mehr Probleme. Bald weiß ich nicht mehr, was ich bei Tisch überhaupt noch zu mir nehmen soll, denn alles landet nach den Mahlzeiten sofort in der Toilettenschüssel oder im Waschbecken. Tees und Tabletten zeigen keine Wirkung und als mir Franz eines Tages berichtet, dass er den Küchenjungen vormittags schon mehrmals mit einem alten schäbigen Rucksack zum Hoteleingang hereinkommen und damit schnurstracks in die Küche gehen sah, äußert er zunächst in scherzhafter Weise, dass der Kochgehilfe sicherlich darin die im Suq angebotenen Hammelköpfe fürs Mittagessen hereingetragen habe. Im ersten Augenblick muss ich über seine scherzhafte Bemerkung lachen, doch dann schwant mir „Grausiges“ und wir beide schauen uns mit offen stehendem Mund schweigend an. Genau! Es müssen die hygienischen Zustände in der Küche sein, die zu unseren heftigen Verdauungs- und Magenproblemen führen, so dass bei uns bisweilen „alles außer Kontrolle“ gerät.
Mit Franz überlege ich, was wir tun könnten, um mehr zu erfahren. Dann kommt uns die Idee, dass wir diesen Ort der Speisezubereitung doch einmal spät in der Nacht inspizieren könnten und zwar dann, wenn ganz bestimmt keiner von diesen „Hexenköchen“ mehr hier im Hause ist und auch der Pförtner sich in seine halboffene Kammer hinter der Rezeption zum Schlafen niedergelegt hat.
Also beschließen wir, unsere Wecker nachts auf zwei Uhr zu stellen, um möglichst ungestört unseren Kontrollgang in die Küche anzutreten. Wir schleichen aus unseren Zimmern an der spärlich beleuchteten Rezeption vorbei und gehen vorsichtig durch den dunklen Speisesaal auf die Küchentüre zu. Um auch wirklich niemand zu wecken, schalten wir im Speisesaal nicht einmal die hellen mit Neonröhren bestückten Kronleuchter ein, da wir ohnehin diesen Raum ja bestens kennen und uns die spärlich grüne Notbeleuchtung ausreicht, um zum Durchgang in die Küche zu gelangen. Nach einigem Tasten mit der Hand findet Franz hinter der Tür den Lichtschalter und knipst die Neonröhren in der Küche an, die in fahlem weisen Licht nacheinander aufblinken und schließlich den ganzen Raum hell ausleuchten. Erschrocken und sprachlos stehen wir da und schauen entsetzt in diese total verschmutzte und verdreckte Brutzelbude. Unser Blick fällt sofort auf die unzählig vielen Kakerlaken, die auf dem Boden im wirren Gewusel vor dem grellen Licht nun schnell unter dem Herd und unter den Schränken eine sichere Deckung suchen und sich in sämtliche Ritzen in ihren angestammten Unterschlupf zurückziehen wollen. Inmitten der Küche steht ein schwarzer alter Herd, an dem die vielen übergekochten Speisen ihre Spuren hinterlassen haben. An den Wänden rundum sind auf den Anrichten offene Kisten und Schachteln gestapelt, in denen das Gemüse und Obst lagert, in den Ecken stehen Kartons und offene Säcke, in denen Mehl, Graupen und andere Lebensmittel aufbewahrt werden und als wir voller Ekel mit weit aufgerissenen Augen weiter um uns blicken, entdecken wir in den Brotkörben, die auf der Fensterbank abgestellt sind, mehrere Katzen, die aus ihrem Schlaf geweckt uns neugierig anblicken. Unschlüssig sitzen sie da, ob sie nun durch das halboffene Fenster verschwinden sollen, wo sie vermutlich in der Dunkelheit hereingekommen sind, oder ob sie nach dieser Störung ihren angestammten Schlafplatz wieder einnehmen können. Eine weitere Katze liegt auf einem Stuhl und noch eine andere schaut von einem Schrank herab, die es sich auf einer flachen Pappschachtel gemütlich machte. Und tatsächlich, da entdecken wir auch auf einem Büfett den alten schäbigen Rucksack, den der Küchenboy für seinen täglichen Einkauf verwendet. Magisch von ihm angezogen gehen wir auf ihn zu und schnüren ihn auf. Schon das speckige und schmierige Äußere lässt den Ekel in uns hochsteigen. Als der geöffnete Sack seinen streng riechenden Inhalt freigibt, erblicken wir in Zeitungspapier eingewickelt die übel riechenden Knochenreste, an denen noch Sehnen und knorpelige Muskelfasern hängen. Vor dem Zugriff der Katzen wird das Fleisch also hier im Rucksack sicher verschnürt und die ganze Nacht hindurch ungekühlt bis zum nächsten Mittagsmahl aufbewahrt. Schnell binden wir dieses zerschlissene Umhängebündel wieder zu, aus dem uns ein ekelhafter Gestank entgegenkommt. Aufgewühlt von diesen unappetitlichen Eindrücken, meldet sich auch schon mein Magen und es deutet sich das erste Würgen eines Brechreizes an. Schnell beenden wir unsere Inspektion, knipsen das Licht aus, verlassen schleunigst diesen widerwärtigen Ort und ziehen uns auf leisen Sohlen über den Speisesaal wieder auf unsere Zimmer zurück. Nun ist mir endgültig klar, dass ich schon allein meiner Gesundheit zuliebe nicht länger in diesem Hotel bleiben kann.
Zusammen mit Franz, der ebenfalls aus dem Knights-Palace-Hotel ausziehen will, vereinbare ich in den folgenden Tagen einen Termin mit Abt Remigius Flein in der Dormitio-Abtei, um ihm die hygienischen Verhältnisse zu schildern, unter denen wir leiden müssen. An ihn wurde ja unser Stipendium vom DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) ausbezahlt und nicht an uns, so dass wir nicht frei darüber verfügen können. Somit kann mit diesen Geldern die Abtei ihren Studienbetrieb der eigenen Hochschule finanzieren, dafür soll sie aber auch den Stipendiaten eine angemessene Unterkunft zur Verfügung stellen und für ihre Verpflegung sorgen. Dieser Modus wurde angeblich deshalb so geregelt, damit wir hier in Israel kein eigenes Bankkonto eröffnen müssen, da die Gebühren für die Geldüberweisungen enorm hoch sind und außerdem die galoppierende Inflationsrate mit jährlich über 100% unsere Stipendien in kürzester Zeit völlig entwerten würde. Außerdem sind auf DM oder Dollar lautende Konten bei israelischen Banken nicht zugelassen, so dass wir nur einen begrenzten Betrag in ausländischer Währung aufbewahren können, das allerdings leicht abhanden kommen kann. Um aber aus dem Hotel ausziehen zu können, bitten wir Abt Remigius, wenigstens den Teil unseres Stipendiums an uns auszubezahlen, der für unsere Unterkunft und Verpflegung vorgesehen ist. Als er uns angehört hat, stimmt er bereitwillig unserem Vorhaben zu, gibt uns jedoch zu bedenken, dass es hier in Jerusalem ziemlich schwierig sein wird, ein möbliertes Zimmer zu finden, da die Wohnungsnot seit dem Jom-Kippur-Krieg sehr zugenommen habe. Gerade für möblierte Zimmer seien die Mietpreise besonders stark angestiegen. Das liege vor allem daran, dass es im Land hier keine Nutzwälder gibt und alles Holz und auch alle Möbel sehr kostspielig importiert werden müssten. Zwar gäbe es inzwischen staatliche Aufforstungsprogramme, doch bis dieses Nutzholz in diesen Wäldern geerntet werden könne, werden noch einige Jahrzehnte vergehen. Trotz dieser Bedenken ermuntert er uns, es ruhig mal zu versuchen und sobald wir ein Zimmer gefunden hätten, könnten wir uns ja bei ihm melden. Selbstverständlich werde er uns dann auch den uns zustehenden Anteil unseres Stipendiums ausbezahlen, damit wir unseren Lebensunterhalt finanzieren können. Freudig bedanken wir uns und verlassen die Abtei sehr zuversichtlich in der Hoffnung, dass es uns sicherlich bald gelingen wird, eine geeignete Bleibe zu finden.
Weihnachten und Jahreswechsel
Als eines Sonntags in der „Evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Jerusalem“ der Organist ausfällt, wird bei uns in der Hochschule nachgefragt, ob einer von den Studenten bei ihnen in der Erlöserkirche auf der Orgel im Gottesdienst die Lieder begleiten könnte. Ich melde mich und bekomme auf diese Weise einen guten Kontakt zur evangelischen Gemeinde, zumal ich nach dem Gottesdienst gleich zum anschließenden Gemeindetreff eingeladen werde. Vor allem beeindruckt mich der Gemeindeleiter Propst Knappe, der zu Beginn des Gottesdienstes nicht nur die Gemeinde begrüßt, sondern sogar mich als Student der Dormitio-Abtei den Gläubigen vorstellt. Freudestrahlend kommen nach dem Gottesdienst einige Gemeindemitglieder auf mich zu und bedanken sich überschwänglich für mein Orgelspiel und vor allem für das schöne Bachpräludium, das ich ihnen am Schluss des Gottesdienstes zum Besten gab. Von ihnen erfahre ich auch, dass dieses prächtige Instrument vor zwei Jahren von einem deutschen Orgelbaumeister für die Erlöserkirche geschaffen wurde. Es soll zur Zeit die beste und größte Orgel im ganzen vorderen Orient sein, doch leider gäbe es hier in Israel nur ganz wenige Organisten, die ein solches Instrument in seiner ganzen Klangfülle zum erklingen bringen könnten. Kein Wunder, denn die Dormitio-Abtei hat, was die Orgel betrifft, ja wirklich nichts zu bieten.
Dass mir als Organist von den Gläubigen so viel Aufmerksamkeit zuteil wird, der lediglich im Sonntagsgottesdienst die Lieder begleitet und einen schönen Ausgang spielt, ist für mich ein völlig neues Erlebnis. Vom ersten Augenblick an fühle ich mich in dieser Gemeinde angenommen, ganz so als ob ich zu ihnen gehören würde. Obwohl ich in Stuttgart und München während meiner Studienzeit, aber auch in meiner Heimatgemeinde in Aalen oft aushilfsweise in den Gottesdiensten den Organistendienst übernommen habe, bin ich nie vom Pfarrer bei den Gottesdienstbesuchern vorgestellt worden. An ein Honorar, über das ich mich als Student selbstverständlich gefreut hätte, dachten diese Hochwürden natürlich auch nicht. Vor und nach ihren Gottesdiensten hatten sie ohnehin andere Dinge im Kopf, wichtig war ihnen nur, dass wie gewohnt die Orgel ertönte.
Aber auch die gesamte herzliche Willkommenskultur dieser evangelischen Gemeinde von Jerusalem ist natürlich mit ein Grund, weshalb ich es bald mehr und mehr vorziehe, die wesentlich schlichter gestalteten Gottesdienste in der Erlöserkirche zu besuchen. Außerdem lädt der Propst auch zu verschiedenen Veranstaltungen und Gemeindenachmittagen ein, die im Saal der Propstei regelmäßig stattfinden. Bald nehme ich auch an diesen Zusammenkünften teil und beteilige mich sogar daran, sie gelegentlich mitzugestalten. So bekomme ich einen guten Kontakt zu arabischen, israelischen und deutschen Gemeindemitgliedern, die im Umkreis von Jerusalem wohnen und werde von ihnen bisweilen sogar eingeladen. Um einen dieser Gemeindenachmittage mitzugestalten, fahre ich im Auftrag des Propstes nach Tel Aviv ins Goethe-Institut, das dort in der deutschen Botschaft untergebracht ist, um einen Film abzuholen und der Gemeinde vorzuführen. Ein andermal fragt mich der Propst, ob ich in Beit Sahour, es ist ein Dorf bei Bethlehem, wo die deutschsprachige evangelische Gemeinde ein Gymnasium unterhält, mit einem Studienfreund zusammen für die Schüler den Nikolaus spielen könnte. Sehr gerne gehe ich auf dieses Ansinnen ein, zumal der Propst uns für diesen Auftritt seinen Dienstwagen zur Verfügung stellen will. Denn um nach Beit Sahour zu kommen, muss man von Jerusalem ins besetzte Westjordanland fahren, wo man eine sehr streng kontrollierte Demarkationslinie überqueren muss. Die arabische Bevölkerung wird von den israelischen Soldaten ohnehin wesentlich schärfer kontrolliert als wir „Touristen“ mit ausländischem Visum. Trotzdem kann man sich aber nie ganz sicher sein, ob das Auto, mit dem man gerade unterwegs ist, nicht ebenso genauestens unter die Lupe genommen wird, so dass man dann stundenlang aufgehalten wird.
„Vor solch unangenehmen Grenzkontrollen kann ich euch leicht verschonen“, verspricht mir Propst Knappe mit einem verschmitzten Schmunzeln, „ich stelle euch meinen Dienstwagen zur Verfügung. Ihr werdet sehen, dann habt ihr freie Fahrt über die Grenze.“
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739490281
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2020 (März)
- Schlagworte
- Theologie Dormitio-Abtei Studienjahr Kirche Studium Israel Auslandstudium Biografie