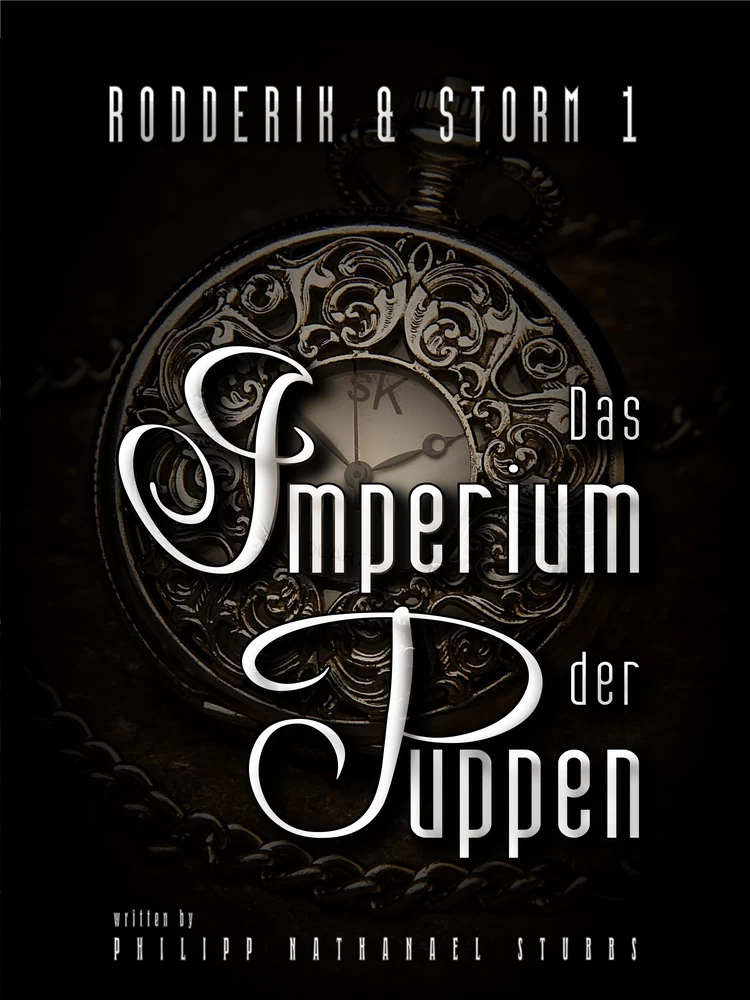Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Über das Buch
Sie sind fehlerlos, unermüdlich, gehorsam und von ihren Vorbildern nur in einem einzigen Detail zu unterscheiden. Nur ein Mensch kennt es und der wird erst in 150 Jahren geboren.
Miranda van Storm steht kurz vor dem Durchbruch: Ihre mechanischen Menschen sind makellose Diener, geeignet, um die höchsten Ansprüche der Aristokratie zu befriedigen. Ihre Feuerprobe ist das Dinner für Königin Viktoria und danach steht ihrem Erfolg nichts mehr im Wege. Was kann schon schiefgehen?
Graham Rodderik hat es geschafft: der Brooklyn-Deal, der ihm persönlich 27 Millionen Pfund einbringt, ist in Sack und Tüten. Leider hat er vergessen, rechtzeitig den Mund zu halten und jetzt Typen mit Springmessern und Totschlägern auf den Fersen, die ihm das Geld gern abnehmen würden. Seine Flucht endet in einer Gasse, die so gar nicht nach dem London aussieht, das Graham kennt.
Und als ihm am Ende der Gasse eine Gruppe schweigender Bediensteter ein perfektes Dinner anbietet - warum sollte er ablehnen?
Mehr davon? Ein Gratis-eBook gibts am Ende des Buches!!
Kapitel 1 - Die Frau im Spiegel
KAFFEE! DANN WIRD NIEMAND VERLETZT!
Graham starrte auf das weiße Porzellan mit der gesprungenen Glasur, ohne etwas davon in sein Hirn aufzunehmen. Das war morgens halb Sieben ohne Koffein auch nicht möglich. Die Tasse hatte ihm Helen Fields, die Sekretärin der kleinen Investmentbude, in der er als Student gejobbt hatte, zum Abschied geschenkt. Das war Ewigkeiten her – zumindest im Investmentbusiness, wo kein Mensch weiter als zwei Monate, geschweige denn zwei Jahre dachte. Entweder hatte die Frau sich keine weiteren Gedanken über das Geschenk gemacht, als dass es das 5-Pfund-Budget nicht überschreiten durfte – oder sie kannte Graham besser, als ihm lieb war. Während der Kaffee aus dem Automaten in die Tasse floss, versuchte Graham, sich ihr Gesicht ins Gedächtnis zurückzurufen. Der Versuch blieb erfolglos.
Der Kaffeestrom versiegte zu früh. Hektisch rot blinkende Lichter zeigten an, dass die Maschine ihren Dienst verweigerte und eine aus dem Innern herauskräuselnde Rauchwolke wies darauf hin, dass sich daran in nächster Zukunft nichts ändern würde. Graham zerrte den Stecker aus der Steckdose und fluchte leise vor sich hin. Dann schnappte er sich seine Tasche und verließ die Wohnung. Die Zeit war knapp, doch der Umweg notwendig. Ohne Koffein war Graham eine Gefahr für sich selbst und seine Mitmenschen.
Eigentlich nur für seine Mitmenschen.
Graham drückte eine Viertelstunde später die Glastür der Starbucks Filiale auf und quetschte die Masse der Neun-Bis-Fünf Bürozombies noch enger zusammen, die auf der Jagd nach etwas Motivation oder wenigstens Koffein geduldig wie Schafe in der Schlange standen. Das unwillige Gemurmel der Gequetschten quittierte Graham mit einem leisen Sorry und dem Versuch, möglichst unsichtbar zu werden.
Graham war kein Schaf wie die anderen hier. Zumindest in seiner Vorstellung. Er war ein Wolf. Er war der aufsteigende Star der Investmentabteilung von Poor, Moore & Moody – was zugegeben ein bescheuerter Name für eine Vermögensverwaltungsagentur ist – hatte den Brooklyn-Deal eingefädelt, geplant und durchgezogen. Einen Deal, der ihm persönlich in wenigen Stunden siebenundzwanzig Millionen Pfund bringen würde. Was für Graham im Grunde genommen nicht mehr als eine Zahl war. Und genau das war der Grund, warum ihn viele seiner Mitmenschen für äußerst seltsam hielten.
Trotzdem war er ein Wolf. Keine Frage. Aber ein Wolf braucht die Schafe, die er fressen konnte. Kein Grund, die Herde zu vergraulen – Investmentbanker hatten im Augenblick sowieso nicht gerade den besten Ruf – deshalb stellte er sich hinten an und wartete.
Die Warteschlange bei Starbucks bestand aus neunzehn Personen, die auf einen jungen, leicht überforderten und ganz sicher unterbezahlten Aushilfsstudenten warteten. Graham überschlug in seinem Kopf, was ihn erwartete: Bei der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von siebenundachtzig Sekunden dauerte es fast achtundzwanzig Minuten bis zu seinem Kaffee. Graham stöhnte. Innerlich. Und ergab sich seinem Schicksal. Ganz so, wie es von einem wohlerzogenen Engländer erwartet wurde.
Eine Jacht musste es sein. Grahams Gedanken hatten die Wartezeit genutzt, um auf Wanderschaft zu gehen. Was stellte man mit siebenundzwanzig Millionen Pfund an? Für einen jungen Mann ohne Familie und nennenswerte weitere Bedürfnisse, dessen Vorstellung von Spaß das Lösen mathematischer Rätsel einschloss, war Geld etwas, was man hatte – und nichts was man brauchte. Fred, sein Boss und Freund seit Internatstagen, hatte ihm erklärt, dass er sich mal etwas Luxus gönnen sollte und dabei eine Jacht erwähnt. Mangels Alternativen hatte sich diese Vorstellung in Grahams Gehirn festgesetzt. Er stellte sich vor, wie er mit aufheulendem Motor, eine beachtliche Bugwelle hinter sich herziehend, am Tower vorbei brauste. Weißes Holz, viel Chrom und schwarzes Leder. Dann tauchte am Horizont eine Insel mit Sandstrand, Palmen und einer offenen Bar auf, die sich zugegebenermaßen nicht in der Nähe von London befand, aber eher nach Grahams Vorstellung vom Paradies aussah1.
»To Go oder hier?« fragte der unterbezahlte Aushilfsstudent hinter der Theke.
»Was?«
»To Go oder hier?«
»To Go natürlich.« Wer hatte schon Zeit und ein so niedriges Selbstbewusstsein, sich bei Starbucks hinzusetzen?
»Einmal Kaffee schwarz To Go. Kommt sofort.« Kaffee schwarz? Wann hatte er was von Kaffee schwarz gesagt? Oh! Schwarzes Leder. Fing er schon an, Selbstgespräche zu führen? Graham hatte von Typen gehört, die den Stress nicht vertrugen und durchgedreht waren. Der Mann hinter der Theke stellte ihm ein paar Sekunden später den Pappbecher auf den Tresen. Graham zögerte zuzugreifen. Er mochte keinen schwarzen Kaffee. Er mochte Milch und Zucker. Der Barista, der sich schon dem nächsten Kunden zugewandt hatte, drehte sich nochmal um und sah Graham prüfend an.
»Ist noch was?« Graham zuckte zusammen und griff nach dem Becher.
»Nein, danke.«
»Sie sehen nicht gut aus. Vielleicht sollten Sie sich krankmelden.« Aber Graham war schon zur Tür raus.
Auf der Straße nippte Graham an dem bitteren Kaffee und verzog das Gesicht. Er suchte nach einem Mülleimer, als er rechts aus Bodennähe eine Stimme hörte.
»Etwas Kleingeld, Sir?« Sir. Bald würden ihn alle in der Firma so ansprechen und nicht mit Grams, dem Spitznamen, den er verabscheute. Sir, das hatte einen Klang, selbst wenn es von einem Penner auf der Straße kam.
»Sie können meinen Kaffee haben.« Die verwitterte Gestalt griff zu.
»Danke, Sir! Gott segne Sie!« Gott segne mich, wenn ich zu spät komme, dachte Graham. Der Brooklyn Deal war unter Dach und Fach, aber die Umstrukturierung noch nicht. Und ohne Grahams Informationen wäre Fred, der für diesen Teil des Jobs zuständig war, hilflos. Und Freund oder nicht – dann würde Fred den Boss raushängen lassen.
Graham schaute sich um. Die Fußwege waren verstopft mit zielstrebigen Büroangestellten (gut) und trödelnden Touristen (schlecht), die Straßen zugestopft mit Autos. Zu Fuß oder mit dem Taxi bestand keine Chance, durchzukommen. Aber die Busspur war leer. Graham seufzte. Er mochte keine Busse2. Aber ihm blieb keine andere Wahl. Er ging zum Wartehäuschen der City-Linie, die ihn in zehn Minuten in den Finanzdistrikt brächte und dachte darüber nach, was mit der alteingesessenen Frachtschiff-Gesellschaft Brooklyn Limited zu tun wäre, die dank seiner tatkräftigen Mithilfe in wenigen Wochen wieder schwarze Zahlen schreiben würde. Dass der Hauptgrund für diese finanzielle Genesung darin lag, fast alle erfahrenen, langjährigen und britischen Angestellten durch nicht ganz so erfahrene, dafür wesentlich billigere brasilianische Arbeitskräfte zu ersetzen, war ein Fakt, der Graham beim Betrachten wohlformatierter Excel-Tabellen selten zu Bewusstsein kam. Oder um genauer zu sein: nie. Ein Umstand, den er in weniger als achtundvierzig Stunden bitter bereuen sollte.
Es regnete nicht. In einer Stadt wie London war das ein erwähnenswerter Umstand und deshalb war es auch egal, dass das Wartehäuschen vollgepackt mit anderen Pendlern war. Graham stellte daneben und wartete. Er sah nach rechts und nach links, spähte nach einem Anzeichen des roten Doppeldeckers, der sich durch den Verkehr schlängeln sollte und sah wieder nach rechts. Nicht wegen des Busses, sondern wegen der Frau, die mitten auf der Straße stand. Und hingebungsvoll die leere Luft putzte.
Niemand sonst schien die junge Frau zu bemerken. Keiner der Wartenden, keiner der Fußgänger, kein Autofahrer. Auch nicht der, der direkt auf sie zufuhr. Graham sprang nach vorn.
»Vorsicht!« Ein brutales Hupen war die Antwort.
»Augen auf, du Trottel!« brüllte der Toyota-Fahrer. Graham sprang zurück und sah die erschrockenen Gesichter der Wartenden. Dann kamen die Geräusche zurück, der ganz normale Verkehr, der weiterging, als wäre nichts gewesen. Aber auch kein Zusammenprall, kein Aufkreischen – er sah wieder nach vorn, auf die Straße, auf die Frau, die ihn jetzt ansah, blass, erschrocken, mit offenem Mund. Und er sah, wie der morgendliche Londoner Berufsverkehr durch sie durchfuhr.
Eine Hand legte sich auf seine Schulter und zog ihn weiter von der Fahrbahn weg.
»Alles in Ordnung?«
»Die, die Frau da...« Graham zeigte zurück auf die Straße, aber da war nichts. Der Mann, der zu der Hand gehörte, sah ebenfalls in die Richtung und runzelte die Stirn.
»Welche?« Graham suchte weiter nach der Frau, aber fand sie nicht.
»Sie ist weg. Ich dachte, sie wird... Ach nichts, wahrscheinlich nur Stress.«
»Aber sonst ist alles in Ordnung?«
»Ja, ja klar. Nur... Übermüdung.« Der Mann steckte seine Hand in die Manteltasche und zog eine Visitenkarte heraus.
»Falls Sie mal drüber reden wollen.« Graham las irgendeinen Namen und darunter die Berufsbezeichnung: Psychiater. Er lachte trocken auf.
»So schlimm ist es noch lange nicht.«
»Das sehe ich anders. Tun Sie mir einen Gefallen: Bevor Sie diesen endgültigen Abschied wählen, reden Sie mit mir. Die erste Stunde ist gratis.«
»Ich, äh, das war kein, ich wollte mich nicht umbringen oder so.«
»Sieht Ihr Unterbewusstsein das genauso?«
»Ach verdammt, mein Bus kommt. Ich muss los.«
Dreizehn Minuten später betrat Graham sein Büro und hatte den Vorfall schon fast vergessen.
*
Es war weit nach Mitternacht, als Graham die Tür zu seiner Wohnung aufschloss, seinen Rucksack in die eine Ecke warf und seine Schuhe in die andere kickte. Der Tag war überhaupt nicht so gelaufen, wie es sollte. Irgendein Gewerkschafter, der sich profilieren wollte, hatte mitbekommen, was bei Brooklyn Limited lief – nichts Genaues, aber der Typ kannte PM&M und zog seine Schlüsse daraus. Nichts, was vor Gericht Bestand haben würde, aber die Rechtsabteilung wurde nervös und es war Graham, der die Situation analysieren und Gegenmaßnahmen empfehlen musste. Jetzt wollte er nur noch was Essen und ins Bett.
Als er schlief, sah er die seltsame Frau in seinen Träumen.
Den Traum hatte er am nächsten Morgen schon vergessen – aber die Frau nicht. Entgegen seiner Gewohnheit ging er diesmal nicht bei Starbucks vorbei, sondern gleich zur Bushaltestelle. Wenn sie eine Pendlerin wie er war, dann würde sie um die gleiche Zeit vorbeikommen. Graham wartete, aber sie kam nicht. Er wartete sogar etwas länger, als vernünftig war. Er würde zu spät kommen, sein Boss würde ihm einen halbherzigen Anpfiff geben (mehr würde er sich nicht wagen) und das Leben würde weitergehen – es war eben eine Zufallsbegegnung, die sich nicht wiederholen ließ. Mehr nicht. Die 81 schob sich durch den Verkehrsstrom an den Straßenrand, öffnete die Tür, entließ hinten einen Pulk übermüdeter Nachtarbeiter auf den Fußweg und verschlang vorn eine Portion frisch ausgeruhter Schreibtischarbeiter. Graham griff nach der Haltestange und setzte seinen Fuß auf die unterste Stufe, da sah er sie im Augenwinkel. Und einen Sekundenbruchteil später war sie weg, als wäre sie nie da gewesen. Graham zögerte. Er suchte die Menschenmassen ab, aber fand ihr Gesicht nicht wieder.
»Steigen Sie ein oder wollen Sie da Wurzeln schlagen?« knurrte der Fahrer. Graham zögerte immer noch.
»Ich...« Der Fahrer drückte auf einen Knopf und die Tür schloss sich. Graham zog seine Aktentasche durch den schmaler werdenden Spalt.
»Danke, sehr freundlich.« Als Antwort bekam er nur einen ausgestreckten Mittelfinger zu sehen.
»Du siehst beschissen aus«, begrüßte ihn Fred, der so etwas wie sein Boss war. Graham hatte es fast pünktlich ins Büro geschafft und Fred – dessen Bonus ebenfalls vom Erfolg des Brooklyn Deals abhing, war klug genug zu wissen, wann er die Klappe halten sollte. »Hast du schlecht geschlafen?«
»Schlecht geschlafen hab ich vor zwei Monaten. Danach hab ich damit aufgehört.« Fred lachte. Sie beide kannten das Machogehabe der Investmentleute, die sich nie Schwächen eingestehen würden und damit prahlten, welche neuen Höhen der Selbstausbeutung sie erklommen hatten.
»Echt, du solltest heute etwas früher Schluss machen. Wir können ja einen trinken gehen.« Fred zwinkerte. »Gibt Neuigkeiten.« Graham nickte. Die wirklich wichtigen Sachen wurden nicht im Büro besprochen, sondern während der Zigarettenpause auf dem Dach. Und seit dem die neuen Nichtrauchergesetze das verboten hatten, beim Bier im Pub. Wenn irgendwann mal ein Alkoholverbot durchgedrückt würde, dann gänge es mit der Wirtschaft bergab.
»Gegen Sieben in der Bar auf der anderen Straßenseite?«
»Punkt Sieben. Im Old Dragon, da sind wir unter uns.« Was auch immer Fred hatte, es musste wichtig sein. Graham nickte.
»Punkt Sieben.« Und er dachte den ganzen Tag darüber nach, was Fred ihm sagen wollte.
Als Graham kurz vor Sieben den Old Dragon betrat, war der Pub vollgepackt mit Feierabend-Trinkern. Die meisten waren hier, um ein Pint oder zwei zu trinken; manche würde bis zur Last Order bleiben und dann gehen – falls sie das dann noch konnten. Normalerweise wäre Graham nie in so einen Pub gegangen, aber er konnte sich vorstellen, warum Fred genau dieses Lokal gewählt hatte: die meisten Gäste hier hatten nichts mit Banken am Hut, nicht mal mit Geld, wenn man die schäbigen Jacken, durchgewetzten Hosen und abgelatschten Schuhe betrachtete. Das hier war der Pub für Bauarbeiter, Hausmeister und den gelegentlichen Penner, der mal einen guten Tag hatte.
Fred wartete bereits an einem der hinteren Tische und winkte Graham zu, der an der Bar sein Bier holte und sich dann durch die Masse schob.
»Setz dich.« Dann wartete Fred, bis Graham die Hälfte seines Glases in einem Zug leerte. Sein Boss sah ihn dabei die ganze Zeit mit einem eigenartigen Lächeln im Gesicht an.
»Du siehst aus, als hättest du im Lotto gewonnen.« Freds Grinsen wurde breiter.
»Hab ich auch, mein Freund.« Dann beugte er sich vor. »Das muss unter uns bleiben, klar?« Graham nickte. »Schwöre.« Graham runzelte die Stirn. Dann hielt er drei Finger in die Luft.
»Ok, Pfadfinderehrenwort.«
»Du warst nie bei den Pfadfindern.«
»Doch.«
»Echt? Die gibt's noch? Ich dachte, das ist so eine Sache aus dem vorigen Jahrhundert.«
»So lange ist das auch wieder nicht her. Meine Eltern haben mich hingeschickt. Wollten, dass ich unter Gleichaltrige komme.«
»Und die haben dich regelmäßig vermöbelt.« Fred zuckte mit den Schultern. »Kenn ich, ging mir genauso. Beim YMCA. Sollte man nicht für möglich halten.«
»OK und was ist das große Geheimnis?«
»Ich hatte ein Gespräch mit Moody.« Graham klappte das Kinn runter.
»Der redet mit dem Fußvolk?« Fred grinste.
»Zu dem wir beide bald nicht mehr gehören.«
»Die feuern uns? Aber wieso?« Fred verdrehte die Augen.
»Schwer von Begriff heute? Du bist doch sonst nicht so. Partner, Grams, Partner. Wenn der Brooklyn-Deal klappt, werde ich zum Partner befördert und du bekommst meinen Job. Und die nächste freie Partnerstelle. Weißt du, was das heißt?« Graham wusste genau, was das hieß. Geld, Privilegien, Macht. Das hieß nicht nur Aufstieg in der Firma, das hieß Aufstieg in der Gesellschaft. Das bedeutete Einladungen in die Partys des Finanzadels. Das hieß alles, worauf es ankam. Und worauf Graham die letzten sechs Jahre hingearbeitet hatte. Fred wartete, bis der Glanz in Grahams Augen am hellsten schien.
»Alles, was wie tun müssen, ist uns in diesen einen Deal voll reinzuhängen.«
»Klar. Ich verstehe.«
»Ich brauch dich fit«, wiederholte Fred eindringlich. »Volle Kraft.«
»Ich bin fit!«
»Du siehst aber nicht so aus.« Fred sah sich um. »Hier, ich hab was für dich.« Unter dem Tisch schob er Graham eine Schachtel zu. Graham wollte sich die Packung genauer ansehen, aber Fred drückte seine Hand nach unten. »Lass es nicht jeden sehen.«
»Was ist das?« Fred zuckte nur mit den Schultern.
»Ein Koffeinpräparat.«
»Nur Koffein?«
»Größtenteils. Vertrau mir einfach. Es hält dich fit.« Graham hielt Freds Blick für einige Sekunden fest. Er kannte Fred schon eine Ewigkeit – sie waren ins gleiche Internat gegangen und am College in dieselben Kurse, hatten sich bei der gleichen Firma beworben und am selben Tag begonnen. Fred war irgendwann Abteilungsleiter geworden und er war es gewesen, der Grahams Idee vom Brooklyn Deal beim Management durchgeboxt hatte. Es gab keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Und sein Blick war offen und ehrlich – mit einem beruhigenden Augenblinzeln. Eins, Eins-Zwei, Pause. Eins, Eins-Zwei, Pause. Graham holte Luft und ließ die Packung in seiner Jackentasche verschwinden.
»Geht klar.«
»Eine am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen.«
»Solange sie meinen außergewöhnlich scharfen Verstand nicht trübt.« Fred grinste.
»Keine Angst, wird sie nicht.« Dann klopfte er auf die Tischplatte. »Wir sehen uns morgen. Und in drei Wochen spätestens haben wir die Sache hinter uns.«
»Und dann fängt das schöne Leben an – Bahamas, Malediven, Jacht und Bacardi.« Fred legte den Kopf schräg und sah Graham prüfend an.
»Auf die faule Haut legen? Wirklich? Keine Lust auf was Größeres?« Graham wurde aufmerksam.
»Noch größer?«
»Lass dich überraschen. Bis morgen!«
Der nächste Morgen begann mit einem Hämmern im Schädel. Obwohl Graham nichts weiter getrunken hatte, tobte sich in seinem Kopf eine Heavy Metal Band aus. Benommen stolperte Graham ins Bad und tastete in seinem Spiegelschrank nach ein paar Aspirin. Die Packung, die er fand, war leer, aber er erinnerte sich an eine Notration im Reisekoffer. Die Tabletten waren überlagert, aber besser als nichts. Er schluckte sie auf nüchternen Magen und spülte ein Glas Wasser hinterher. Dann sah er sich im Spiegel an. Das Bild war ernüchternd. Die Haut blass, schwarze Augenringe, die Augen selbst rot. Der Bartschatten hob sich schwarz ab und sah eher nach drei Tagen als nach einer Nacht aus. Nur noch ein paar Tage, sagte sich Graham, dann ist der Deal durch. Sein Blick fiel auf die Pillen, die Fred ihm gestern Abend gegeben hatte. Danach fühlst du dich besser, waren seine Worte. Schaden kann's nicht, dachte sich Graham und warf eine Tablette hinterher.
Eine halbe Stunde später war Graham ein neuer Mensch. Was auch immer in Freds Pillen drin war – es wirkte besser als Kaffee, Koks und Speed zusammen. Graham hatte nicht geglaubt, dass man wirklich jemals alles kristallklar sehen konnte – jetzt erlebte er es. Die ganze Welt lag vor ihm ausgebreitet, logisch, überschaubar und ihm zu Füßen. Er fühlte sich wie ein Gott und diese Welt war nur dazu da, von ihm beherrscht zu werden.
Es gab Ausnahmen: Die Londoner Taxifahrer waren definitiv nicht bereit, von Graham beherrscht zu werden; sie waren nicht einmal bereit, für ihn anzuhalten und ihn mitzunehmen. Missmutig steuerte Graham wieder die Bushaltestelle an. Zum Glück bewegten sich die anderen Fußgänger wie in Zeitlupe und es machte ihm keine Mühe, den schwerfälligen Tagträumern und Faulenzern auszuweichen, die lustlos auf dem Weg zu ihren gehassten Jobs unterwegs waren, wo sie minderwertige Arbeit machten, bis sie am Abend erschöpft (Wovon eigentlich?) und schlecht gelaunt zu ihren Familien zurückkehrten, um diese zu tyrannisieren.
Graham erreichte das Wartehäuschen gerade in dem Moment, in dem die 81 sich wieder ihren Platz im Verkehrsstrom erzwang. Der nächste Bus würde in endlosen zehn Minuten kommen, aber Graham war viel zu gut gelaunt, um sich darüber zu ärgern. Er genoss seine neue Klarheit, beobachtete die Menschen, dann Glasfassaden der Häuser mit den Büros dahinter, dann die Straße. Ein seltsames Flirren in der Luft in seinen Augenwinkeln erregte seine Aufmerksamkeit, so als wären seine Augen überanstrengt. Er wusste, wenn er sich darauf konzentrieren würde, würde es verschwinden – aber diesmal blieb es. Dieses Flirren – es war seltsam. Es bewegte sich nicht, es war gerade, so als würde man nur die Kante einer geschliffenen Glasscheibe sehen, die Scheibe selbst aber nicht. Und es war ein geometrisch exaktes Rechteck mitten in der Luft, wie ein Fenster. Graham sah hinein.
Und jemand schaute zurück.
Es war die Frau von vorgestern, daran bestand kein Zweifel. Und sie sah Graham ebenfalls – daran bestand auch kein Zweifel. Und Graham sah, wie die Taxis, Busse, Motorräder und Autor des morgendlichen Berufsverkehrs durch sie hindurchfuhren, obwohl sie so real war, als würde sie aus Fleisch und Blut dastehen. Aber das konnte nicht sein, oder? Kein anderer Passant schien sie zu bemerken. Und sie wäre aufgefallen. Jede Frau, die so aussah, wäre sofort Zentrum zumindest der männlichen Aufmerksamkeit geworden.
Die Frau trug ein altmodisches Kleid. Eins, das vielleicht zu Viktorias Zeiten in Mode war, aber sie selbst war jung. Siebzehn höchstens; zu jung um in Grahams Beuteschema zu passen. Das Kleid war zwar nach der Mode des neunzehnten Jahrhunderts geschneidert, aber es sah neu aus. Der Stoff glänzte und hatte keine Flicken. Die Farbe war nicht ausgeblichen, keine Knöpfe, die fehlten. Die Front wurde von einer schweren Lederschürze bedeckt, in der in unzähligen Taschen Werkzeuge gestopft waren. Schraubendreher, Zangen, Saitenschneider und Dinge, die für jemanden nützlich waren, dessen handwerkliche Fähigkeiten die Grahams weit überschritten. Jetzt zog sich das Mädchen aus ihren braunen Locken eine Spezialbrille über die Augen. Die Gläser waren Lupen, so dick wie Flaschenböden und vergrößerten die Augen dahinter, sodass sie aussah wie ein Frosch. Unwillkürlich musste Graham grinsen, dann versperrte ein Bus die Sicht.
»Wird's heute noch?« knurrte jemand hinter ihm und Graham erwachte aus seinen Gedanken. Das mussten die Pillen sein. Er stieg ein. Als er durchs Fenster auf die Straße sah, war da kein Fenster, keine Frau, nur regenbogenfarben-schimmernde Benzinpfützen und Abgase. Es mussten die Pillen sein.
»Fred?« Graham klopfte vorsichtig an und zog die Tür hinter sich zu, als Fred ihn hereinwinkte.
»Was ist los, alter Junge?« Graham druckste herum.
»Die Pillen, die du mir gegeben hast – haben die Nebenwirkungen?« Fred lehnte sich zurück.
»Bei mir nicht. Aber wer weiß? Was ist los?«
»Ich sehe da diese Frau.«
»Das ist eine Nebenwirkung von was anderem.«
»Nicht das! Sie steht mitten auf der Straße so wie ich dich jetzt sehe, aber keiner sonst sieht sie und die Autos fahren durch sie durch.«
»Wie viele Pillen hast du genommen?«
»Nur eine, heute früh.«
»Die sind absolut ungefährlich. Und wo hast du die Frau gesehen?«
»An der Bushaltestelle.« Fred schnippte mit den Fingern.
»Das erklärt alles.«
»Ach ja?«
»Spiegelung. Irgendwo in einem der umliegenden Häuser ist ein Fotoshooting und die Glasscheiben der Fenster und des Wartehäuschens reflektieren das. Was du siehst ist nicht mehr als ein Hologramm. Nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest.«
»Spiegelung. Klar!« Graham seufzte. »Dass ich nicht selbst drauf gekommen bin.«
»Dann ist ja alles in Ordnung. Aber...« Fred sah Graham eindringlich an. »...erzähl's trotzdem keinem weiter.«
»Bin noch nicht verrückt.«
»Eben.«
An nächsten Morgen stand Graham eher auf als üblich. Duschte, zog sich an. Er schaute auf Freds Tabletten, die im Bad lagen, nahm keine, steckte aber die Packung ein. Dann ging er nach unten, kaufte sich im Starbucks das, was einem normalen Kaffee am nächsten kam und ging zur Bushaltestelle. Sein Plan war, die Eingänge der Bürohäuser in der Umgebung nach Fotostudios abzusuchen, die Lichtstrahlen der Sonne verfolgen, um herauszufinden, wer diese Frau war.
Wenn er sie nicht fand, dann wollte er eine dieser Pillen nehmen. Sah Graham die unbekannte Frau dann wieder, dann wusste er, dass die Pillen nicht so harmlos waren, wie Fred sagte. Er machte seinem Freund deshalb keinen Vorwurf; Graham wusste durch unzählige Studentenpartys3, dass Fred einen Magen wie ein Zinkeimer hatte. Was ein Pferd umhaute, brachte ihn nicht einmal zum Schwanken. Es war durchaus möglich, dass Fred die Tabletten vertrug und – gemessen an dem, wie Fred die Welt sah – er davon ausging, dass auch alle anderen keine Nebenwirkungen befürchten mussten.
Die Luft war klar und kalt an diesem Morgen – sogar ein wenig frostig nach der sternklaren Nacht. Dafür schien die Sonne jetzt vom blauen Himmel herunter, ein leichter Wind trieb die Abgaswolken weg, bevor sie die Straßenzüge verstopften und das Atmen unerträglich machten. Eine Stunde später würden sich die Heere der Arbeitenden über die leeren Fußwege schieben, aber jetzt, kurz nach Sonnenaufgang, waren nur ein paar Überreste der Nachtwanderer unterwegs. Graham nahm die Bettler, Obdachlosen und Dealer nicht wahr, die sich in den Hauseingängen verbargen oder in ihren kleinen Pappbehausungen gegen die Kälte verschanzten.
Zuerst ging Graham die Straße ab. Die Werbeplakate in den Fenstern der Büros wiesen auf Steuerberater, Anwaltskanzleien, Versicherungsagenturen, Bauingenieure, Gutachter, Finanzberater und Detektivbüros hinter den Glasscheiben hin. Auf dem Rückweg machte Graham an jedem Eingang halt und las die goldenen, silbernen oder aus Plastik gefertigten Schilder, die Firmen jeder Art und Größe in diesen Steinpalästen vermuten ließen – zu welchem Zweck diese existierten, ließ sich nur in den seltensten Fällen aus den fantasievollen Namen ableiten.
Aber Graham brauchte keine Fantasie – er kannte sich in dem Geschäft aus und er erkannte eine Briefkastenfirma, sobald er eine sah und ein Steuerschlupfloch, selbst wenn es sich als Firma getarnt hatte.
»Sir, kann ich Ihnen helfen?« Graham drehte sich um und sah einen Berg in Form eines Security-Mannes. Der Mann sah wirklich aus, als ob er Graham helfen wollte: dabei, von hier zu verschwinden, nach Möglichkeit in einem hohen Bogen durch die Luft. Graham lächelte nervös.
»Ich..., ich suche ein Fotostudio. Es muss hier in der Nähe sein, ich hab nur die Nummer vergessen.« Graham lächelte noch einmal, diesmal hoffnungsvoller. Es blieb unerwidert.
»Hier gibt es kein Fotostudio.«
»Sind Sie sicher?«
»Ich würde ein Fotostudio erkennen, wenn ich eins sehe. Genauso, wie ich Ärger erkenne, wenn ich welchen sehe.«
»Ich mache keinen Ärger.«
»Das habe ich auch nicht gesagt.«
»Dann ist ja gut.« Graham sah noch einmal zu dem Mann. Nein, der würde nicht mit sich reden lassen. Zeit für einen strategischen Rückzug. Graham spürte die Blicke des Mannes auf seinem Rücken noch zwei Blöcke weiter.
»Sieht nicht nach Frachtplänen aus«, kommentierte Fred, nach einem Blick über Grahams Schulter auf den Computermonitor. Graham zuckte zusammen.
»Das ist...« Fred analysierte das Suchergebnis, das Google ausgeworfen hatte.
»Fotostudios? Ich hoffe, du willst keine Bewerbungsfotos machen lassen.«
»Ich? Nein! Quatsch!«
»Da bin ich ja beruhigt. Also, was ist los?«
»Diese Frau...«
»Und damit fing die Misere an.«
»Das ist Blödsinn. Ich versuche, das Fotostudio zu finden, in dem sie Model ist.«
»Wie wäre es mit Straße abklappern?«
»Macht die Security nervös.«
»Ups. Klingt als hättest du das schon probiert. Ist das die Frau?« Fred hatte schon immer eine fast unnatürliche Beobachtungsgabe gehabt. Und er hatte das Blatt entdeckt, das Graham hastig zwischen seine Papiere geschoben hatte, als die ersten Kollegen nach ihm ins Büro kamen und zog es mit zwei Fingern aus dem Stapel heraus.
»Mira«, murmelte Fred.
»Du kennst sie?« Fred sah Graham an. Es lag etwas undefinierbares in seinem Blick – etwas zwischen Erschrecken und Verwunderung. Es verschwand so schnell aus seinen Augen, dass Graham zweifelte, es überhaupt gesehen zu haben.
»Ich meine Maria. Die Mutter Jesu. Für ein O Gott! reicht die Zeichnung nicht, aber für Maria ist es ok. Ich wusste gar nicht, dass du so gut mit dem Bleistift umgehen kannst.«
»Gehört nicht unbedingt zu den Kernkompetenzen, die ich bei der Bewerbung für diesen Job angegeben habe.«
»Notfalls kannst du dich immer noch als Straßenkünstler betätigen, wenn du hier rausfliegst. Und das wirst du, wenn der Deal nicht rechtzeitig über die Bühne geht. Also hopp hopp!« Graham wusste, dass Fred ihn nicht feuern würde. Denn dann könnte er ihm das Leben nicht zu Hölle machen, falls der Deal platzte. »Nette Braut übrigens. Kein Wunder, dass dir nichts anderes mehr durch den Kopf geht. Du brauchst eine Freundin.« Den nächsten Satz sagten beide gleichzeitig:
»Nach dem Deal!« Fred grinste und ging in sein Büro zurück. Graham drehte sich wieder zum Bildschirm und schloss die Seite mit den Suchergebnissen. In der Gegend um die Bushaltestelle hatte Google keine Fotostudios gefunden. Was hieß, dass es dort keine gab. Graham griff unbewusst in seine Tasche und fand dort die Packung mit Freds Pillen. Eine sollte nicht schaden – es würde ein langer Tag werden.
Als Graham den Bus nach Hause nahm, war er fast der einzige Fahrgast. Unten hatte er einen Penner gesehen4, der sich noch etwas aufwärmen wollte, bevor er irgendwo in einem Pappkarton die Nacht verschlief. Oben knutschte ein verwahrloster Junge ein blasses, pickeliges Mädchen so hingebungsvoll auf der letzten Bank, dass Graham sich nicht sicher war, ob die beiden nicht noch weiter gehen würden. Er setzte sich auf einen Platz im vorderen Drittel, lehnte den Kopf an die kühle Scheibe und schloss die Augen. Freds Pillen waren fantastisch – solange sie wirkten, kam man sich vor wie Superman. Sobald aber ihre Wirkung aufhörte, trat eine bleierne Müdigkeit ein, die Grahams Gehirn betäubte und ihm die Augenlider zudrückte.
Kaum waren seine Lider geschlossen, sah er ihr Bild vor sich. Ihre braunen Augen, die kecke Stupsnase – ein bescheuerter Ausdruck fand Graham, aber passend – eine ungeheure Wolke lockigen Haares, die ihr rundes Gesicht umrahmten. Er fragte sich, was dieses Mädchen von siebenundzwanzig Millionen Pfund halten würde. Brauchte er wirklich eine Freundin?
Eine Bodenwelle ließ seinen Kopf gegen die Scheibe knallen. Graham öffnete die Augen – und sah das Mädchen immer noch. Und sie sah ihn direkt an, durch die Scheibe! Nein, nicht durch die Scheibe, irgendwo dahinter. Es dauerte einen Augenblick, bis Graham begriff, dass das nicht sein konnte, dass es nur eine Reflektion war. Sein Kopf schnellte herum. Auf der anderen Seite des Busses war nichts. Alle Bankreihen waren leer, selbst das knutschende Paar war verschwunden. Graham sah wieder zurück zur Scheibe, aber sah dort nur das nächtliche London und Dunkelheit. In Sekunden war er die Treppe hinuntergerannt, hatte die Notbremse gezogen, die Notverriegelung gelöst und die Tür aufgezogen. Ohne auf die Flüche des Fahrers zu hören, sprang Graham aus dem langsamer gewordenen Bus und rannte die wenigen hundert Meter zurück, zu der Stelle, wo er die Frau gesehen hatte. Untypisch für London war Graham fast allein auf der Straße. Die wenigen Fahrer, die unterwegs waren, hupten und wichen dem Mann aus, der offensichtlich verwirrt auf dem Mittelstreifen der Fahrbahn stand und sich hilflos in der Gegend umschaute.
Hier war niemand, stellte Graham fest. Kein Fußgänger, kein Pizzabote, keine Security, keine Menschenseele. Graham war sich sicher, dass das hier die Stelle war, an der er die Frau gesehen hatte. Er sah sich noch einmal um, als er aus den Augenwinkeln heraus eine Bewegung wahrnahm. Sofort schnellte sein Kopf in die Richtung. Er konnte ihr Gesicht nicht sehen, aber ihre Haare und die seltsame Kleidung, die sie trug: ein hochgeschlossenes, weit aufbauschendes Kleid, der Oberkörper in eine Art Korsett eingeschnürt. Das war die Frau! Ohne nachzudenken rannte Graham ihr nach. Lautes Hupen erschreckte ihn, als der nächste Autofahrer ihm im letzten Moment auswich, aber Graham ließ sich nicht von seinem Ziel abbringen. Er hatte genau gesehen, wohin die Frau verschwunden war: eine schmale Lücke zwischen zwei Bürotürmen, die man auf den ersten Blick für nicht mehr als eine fehlende Verglasung halten konnte.
Als Graham davor stand, glaubte er zuerst, seine Augen spielten ihm einen Streich. Zwischen den Häusern war eine winzige Seitengasse – eigentlich war sie nicht einmal das. Ein schmaler Abstand zwischen den Gebäuden, um irgendeinen Wartungszugang zu erreichen. Breit genug für einen schlanken Mann ohne Platzangst. Aber etwas war seltsam. Obwohl eine Straßenlampe kaum drei Meter entfernt stand, konnte Graham in der Gasse nichts erkennen. Ein eigenartiges Flimmern in der Luft spielte seinen Augen einen Streich. Manchmal sah er sich, manchmal die Kleider einer Frau. Nicht irgendeiner, sondern dieser Frau. Trotzdem zögerte Graham, die Gasse zu betreten. Selbst er hatte von Lockvögeln gehört, die ahnungslose und gutaussehende Opfer in dunkle Ecken lockten, in denen dann finstere Gestalten lauerten. Graham, der wusste, dass er nicht ahnungslos war und sich auch über das zweite Attribut keine Illusionen machte, blieb unschlüssig stehen und lauschte. Konnte er den Atem versteckter Angreifer hören? Er wusste es nicht. Was er aber hörte, war:
»Das ist der Typ! Hat was von siebenundzwanzig Millionen gefaselt.« Graham sah nach, woher die Stimme kam. Es war nicht die Gasse. Es kam von der Straße hinter ihm. Graham drehte sich um und erkannte das knutschende Pärchen aus dem Bus. Das Mädchen zeigte auf Graham. Sie hatte neben ihren Freund noch ein paar andere Gestalten dabei. Im Kino hätte jeder Zuschauer beim ersten Blick nur ein Wort gedacht: Ärger!
»Pass auf, dass keine Bullen aufkreuzen! Los! Den schnappen wir uns!« Als der Typ, der das gezischt hatte, auf ihn zu rannte, begann Grahams Herz zu rasen. Gegen diesen mit Leder und Nieten beschlagenen Stier in Menschenform hatte er nicht die geringste Chance. Hilfe war nirgends zu sehen, kein Mensch, kein Polizist, kein Hauseingang, in den er sich flüchten konnte. Außer der Gasse. Mit einem Sprung rettete Graham sich in die Dunkelheit.
Graham ging nur einen Schritt weit in den Durchgang. Irgend etwas stimmte mit seinen Augen nicht – ein eigenartiges Flirren zitterte in der Luft. Kaum war Graham in die Dunkelheit getreten, erkannte er, dass hier vor langer Zeit eine Straße durch eine dünne Wand vom Fußweg abgetrennt und von außen mit einer Fassade verkleidet worden war, sodass kein Mensch mehr sie von außen erkennen konnte. Hätte die Tür nicht offen gestanden, wäre diese Straße niemanden aufgefallen – sie war Graham nicht aufgefallen, denn an genau dieser Stelle war er am Morgen vorbei gelaufen, ohne dass er etwas Außergewöhnliches entdeckt hatte. Aber ein Schritt durch diese Tür und er war in einer anderen Welt.
Graham konnte Kopfsteinpflaster unter seinen Schuhen spüren. Und die Wände rechts und links schienen nicht zu den Gebäuden zu passen, die vorn auf dem Fußweg standen. Hier waren es Fachwerkhäuser, keine Bürotürme. Graham blickte zurück. Er konnte die Tür sehen, aber das Licht spielte einen seltsamen Trick: die Straße dahinter war nicht zu sehen. Dafür waren deutlich Stimmen von dort zu hören.
»Er ist hier rein!« sagte eine Frauenstimme.
Eine tiefere, bedrohlichere Stimme sagte: »Steh Schmiere. Den kaufen wir uns.« Und dann zu jemand anderen: »Und du bist sicher, dass der Typ Kohle hat?«
»Er hat im Schlaf dauernd was von siebenundzwanzig Millionen gemurmelt. Der hat Kohle. Oder ne Kreditkarte.« Graham zögerte nicht: Er knallte die Tür zu und stemmte sich dagegen, entschlossen, diese Tür mit seinem Leben zu verteidigen5.
Graham wartete, bis er wieder etwas anderes außer seinem eigenen Herzschlag hören konnte und suchte mit den Augen die Gasse ab. Er brauchte etwas, womit er die Tür verkeilen konnte. Aber nichts befand sich in Reichweite. Graham lauschte. Von der Straße aus konnte er nichts mehr hören, kein Sturmtrupp, der sich anschickte die Tür – oder die dünne Wand daneben – einzurennen. Es dauerte eine Weile, bis seine Augen sich an das flackernde Licht der Gasse gewöhnt hatten. Was er dann sah, verblüffte ihn.
Graham hatte schon von Nerdkulturen gehört, kleinen Nischen, in die sich weltfremde Menschen zurückzogen, um bessere Zeiten nachzuspielen – aber das hier war die Krone. Die Gasse war kein dreckiger Wartungszugang mehr, sondern das perfekte Replikat einer vergangenen Zeit. Den Asphalt hatte jemand durch Kopfsteinpflaster ersetzt, die glatten Wände der Nachbarhäuser mit Lehm und Ziegeln verblendet. Über den Türen waren an schmiedeeisernen Haltern handbemalte Holzschilder aufgehängt, die die Namen der Geschäfte verkündeten. M. Brown, Werkzeugmacher, P. Potts, Schneider, T. Duke, Transporte – das waren die Schilder, die Graham in der dürftigen Beleuchtung lesen konnte. Das flackernde Licht stammte von einer Gaslaterne weiter hinten. Graham wunderte sich, dass sowas überhaupt noch erlaubt war – offenes Feuer in der Nähe eines explosiven Gases war in Zeiten, in denen die Benutzung eines Feuerzeugs unter Terrorismusverdacht fiel6, wahrscheinlich nicht behördlich genehmigt. Vielleicht war deshalb der Eingang getarnt. Kleine Anarchisten! ging es Graham durch den Kopf. Er hatte nicht vor, wen auch immer deswegen anzuzeigen. Er hatte nicht einmal vor, zurück auf die Straße zu gehen.
Graham lauschte. Von der Straße konnte er nur einzelne Gesprächsfetzen hören.
»Wo ist er hin?«
»Er muss durch eine Tür sein!«
»Hier ist keine Scheißtür!« Die Stimmen waren noch ein Stück entfernt, aber sie kamen näher. Graham konnte sich ausrechnen, dass er allein die Tür nicht gegen drei Angreifer halten konnte, die noch dazu gewaltbereit waren. Mit seinen Blicken suchte er die Gasse ab, bis er eine schmale Tür fand, die ihm vorher noch nicht aufgefallen war. Das kleine Schild darüber verkündete, dass diese Tür zum Sleepy Badger führte, einem Pub, der seinem Namen entsprechend um diese Zeit schon geschlossen hatte. Was Graham aber wirklich ins Auge fiel, war ein Spazierstock, den dort jemand neben den Stufen, die zum Eingang hinauf führten, vergessen hatte. Ein Spazierstock mit einer Eisenspitze, die sich perfekt als Keil eignen würde. Nur leider ein paar Schritte von seiner jetzigen Position entfernt. Um den Stock zu bekommen, musste er die Tür unbewacht lassen.
»Wenn ich den Typen nicht finde, mach ich dich fertig, Alte!« Grahams Mitgefühl für das blasse Mädchen hielt sich in Grenzen. Aber etwas anderes war ihm aufgefallen: die Stimme war noch ein paar Meter weg. Er musste es riskieren.
Graham ging so weit nach vorn, wie er die Tür noch mit ausgestrecktem Arm zuhalten konnte, dann sprintete er los.
»Da wackelt was!« brüllte es von der anderen Seite.
»Los! Dort muss er sich verkrochen haben!« Panisch griff Graham nach dem Stock, wirbelte herum und rannte zurück, die Spitze des Stocks nach vorn gestreckt, auf den schmalen Spalt zwischen Tür und Boden zielend. Von der anderen Seite hörte er, wie harte Stiefelabsätze auf den Fußweg knallten. In der Sekunde, in der er, vom eigenen Schwung getragen, seinen provisorischen Keil in den Spalt rammte, knallte von Draußen etwas Schweres gegen die Tür. Für einen Moment fürchtete Graham, dass der Typ durch den dünnen Metallrahmen brechen würde, aber das geschah nicht. Stattdessen gab es einen Blitz, vielleicht nur eine optische Täuschung, danach war auf der anderen Seite Stille.
Graham vermutete, dass die Glasscheibe der Fassade, die von draußen an der Tür angebracht war, beim Aufprall gesplittert und einer diese Splitter seinem Angreifer die Kehle durchgeschnitten hatte. Auch das erregte nicht Grahams Mitgefühl, der sich völlig sicher war, dass bei einem erfolgreichen Durchbruch er selbst jetzt hier in dieser namenlosen Gasse liegen und verbluten würde. Aber von der anderen Seite war überhaupt nichts zu hören. Waren alle drei tot?7 Hätte es nur einen erwischt, dann würden seine Kumpane diesen Typen wegschleifen und zur nächsten Notaufnahme bringen, oder? Doch Graham konnte von draußen kein einziges Geräusch hören. Vielleicht waren sie auch einfach weggerannt und hatten die Leiche zurückgelassen. Graham lehnte sich gegen die Tür und keuchte. Die Wirkung des Adrenalins, welches bis eben durch seinen Kreislauf geflutet hatte, ebbte langsam ab, das Rauschen in seinen Ohren ließ nach und das dauernde Dröhnen wurde langsamer, bis sich wieder einzelne Herzschläge unterscheiden ließen. Nach einer Weile wurde sich Graham seiner Situation bewusst. Er saß hier in relativer Sicherheit. Aber auf der anderen Seite lag sein Angreifer. Vielleicht tot – vielleicht aber auch nicht. Und Graham konnte nicht ewig hier sitzen bleiben. Irgendwann würde jemand die blutende Gestalt vor der Tür finden und die Polizei rufen. Die würden Graham finden und zu ermitteln beginnen und es würde eine Weile dauern, bis sie die richtigen Fragen stellten und seine Unschuld bestätigten – wenn er Glück hatte. Damit stand fest, er musste hier weg. Bevor sein Gegner sich erholt hatte und bevor die Polizei kam.
Langsam rappelte Graham sich auf und presste zur Sicherheit sein Ohr an die Tür. Er hörte kein schweres Atmen auf der anderen Seite, auch nicht die Stille die jemand verursacht, der kein Geräusch machen will. Aber noch etwas fiel ihm auf: Die Tür, an die er sein Ohr presste, war aus Holz. Dabei war Graham sich sicher gewesen, dass es eine Metalltür gewesen war; mehr noch: eine Gittertür aus Metall, die von außen verkleidet war. Oder auch von innen? Graham hielt sich nicht mit solchen Fragen auf. Vorsichtig öffnete er die Tür und sah durch den Spalt nach draußen. Dann klappte ihm das Kinn nach unten.
Notiz 1 An einem Sandstrand ohne Menschen konnte man mit einem Blatt Papier und einem Bleistift eine Menge Spaß haben. Vielleicht sollte er sich den Luxus eines Taschenrechners gönnen.
Notiz 2 Das war nicht ganz korrekt: Graham hatte nichts gegen Busse. Nur gegen die Masse an Passagieren.
Notiz 3 An den meisten hatte Graham unfreiwillig teilgenommen; es waren diejenigen, die Fred auf ihrer gemeinsamen Bude organisiert hatte.
Notiz 4 Und war schnell vorbei geschlichen, bevor dieser auch nur den Hauch einer Chance hatte »Etwas Kleingeld, Sir?« zu sagen.
Notiz 5 Und wenn er es nicht geschafft hätte, wäre sein Leben auch vorbei gewesen. Das lief auf eine Win-Win-Situation im negativen Sinn heraus.
Notiz 6 Und in der Nähe einer Zigarette erst recht!
Notiz 7 Bei diesem Gedanken machte sein Herz einen moralisch absolut verwerflichen Freudenhüpfer.
Kapitel 2 - Der Weg in die Schatten
Graham hatte erwartet, eine Straße zu sehen. Mit Straßenlaternen, Autos, Müll aus einem umgekippten Papierkorb und allem, was zu einer Londoner Straße gehört. Er hatte nicht erwartet, einen Holztisch mit zwei Bänken in einem engen Raum zu sehen, der von einem Kaminfeuer erleuchtet wurde.
Graham zuckte zurück. Er musste sich geirrt haben – die Tür zur Straße hin musste woanders sein. Aber das hätte auch bedeutet, dass er sich auf einer Strecke von drei Schritten verlaufen hätte. Was durchaus eine Folge des Schlafmangels sein konnte, er aber nicht für wahrscheinlich hielt. Trotzdem schaute Graham sich um und stellte fest, dass es an dieser Wand keine weiteren Türen gab. Er stand am Ende einer Sackgasse. Weiter vorn ging es auf einen kleinen Platz, aber Graham wollte nicht weiter in die Dunkelheit laufen und komplett die Orientierung verlieren. Es gab nur eine Tür in Richtung Straße und das hieß, der Weg zurück führte dort durch. Hatte er vorhin in der Panik einen ganzen Raum durchquert, ohne es zu merken? Schon möglich.
Plötzlich schnippte Graham mit den Fingern. Versteckte Kamera! Das war es! Besser noch: das würde alles erklären! Diese Straße hier, der Raum, der aufgetaucht war – das alles war nur ein Trick und hunderte versteckte Kameras zeichneten jede seiner Bewegungen und jedes Zucken seines Gesichts auf. Und während er hier drinnen die Tür zugehalten und seine vermeintlichen Verfolger ausgesperrt hatte, hatte draußen ein Team gut geübter Szenenbildner einen Container vor die Tür geschoben, die Szenerie einer hundert Jahre alten Küche lebendig werden lassen und nun waren Gott weiß wie viele Menschen begierig darauf, zu sehen, wie Graham verwirrt durch die Kulissen stolperte. Graham setzte ein siegessicheres Lächeln auf. Nicht mit mir! dachte er. Nein, das hier war alles ganz normal. Es gab eine logische Erklärung und er würde sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen.
Graham atmete tief durch und strich sich mit den Fingern durch die Haare. Wenn ihm das halbe Land zuschaute, dann wollte er gut aussehen. Ohne anzuklopfen öffnete Graham zum zweiten Mal die Tür und trat ein.
»Hallo!« rief er. »Ich muss hier nur kurz mal durch. Lassen Sie sich nicht stören!« Graham lauschte, aber nichts war zu hören. Keine knarrenden Dielen, kein Schnarchen aus angrenzenden Schlafzimmern, keine eiligen Schritte, die in seine Richtung kamen oder von ihm wegliefen. Das war auch nicht zu erwarten, schließlich handelte es sich hier nur um einen Container, bei dem es keinen angrenzenden Flur gab und keine angrenzenden Räume, in denen Menschen lebten wie in einem richtigen Haus. Das war nur ein Container, sagte sich Graham. Mit zügigem Schritt durchquerte Graham den Raum. Nach seiner Theorie musste es auf der anderen Seite eine zweite Tür geben, durch die er wieder auf die Straße gelangen konnte.
Die gab es aber nicht. Dafür zwei Fenster, durch die Graham auf die Straße sehen konnte. Nur dass es keine moderne Londoner Straße war – es sei denn, die Verwaltung hatte beschlossen, dass Kopfsteinpflaster jetzt der Straßenbelag der Wahl war. Zur Senkung der Schadstoffbelastung war diesen Schreibtischtätern schließlich alles zuzutrauen. Jetzt sah die Straße da draußen aus, wie zu Dickens Zeiten. Graham sah Gaslaternen, eine Regenrinne, die gleichzeitig als Kanalisation diente und Stroh auf dem Pflaster. Wo bekam man heute überhaupt noch Stroh her? Gegenüber – und zwar ziemlich nah gegenüber; keine Chance, dass auf dieser Straße Autos in zwei Richtungen fahren konnten – sah Graham auf der anderen Straßenseite niedrige Haustüren. Die Schilder darüber zeugten vom Stolz der Geschäftsinhaber dahinter: zwei Schneider, ein Tischler, ein Goldschmied und mindestens vier Mechaniker. Alle Schilder waren kunstvoll gearbeitet, jeweils im Stil des zugehörigen Handwerks und klar darauf ausgelegt, ein Zeugnis der Geschicklichkeit ihres Herstellers zu sein. Sie waren liebevoll gepflegt, aber keines davon modern. Diese Fernseh-Fuzzies hatten echt zu viel Geld. Der ganze Aufwand, zusätzlich zu einem Raum noch eine ganze Straße nachzubauen? Obwohl: wahrscheinlich handelte es sich da draußen vor dem Fenster um Monitore und bei dem, was er sah, um die BBC-Aufzeichnung einer opulenten Jane-Austen-Verfilmung.
Wenn das vor dem Fenster Monitore waren, dann machte es keinen Sinn, sie zu öffnen. Graham nahm sich deshalb Zeit, das Zimmer, in dem er stand, genauer zu untersuchen. Es sollte wohl eine Küche darstellen. Grahams Wissen über Küchen in der Neuzeit war schon stark eingeschränkt – das über Küchen aus dem vorigen Jahrhundert tendierte gegen Null. Der Drehspieß über dem offenen Kamin gab den Hinweis. Er klopfte auf den Tisch. Das klang nach massivem Holz und nicht nach billiger TV-Requisite. Dann klopfte er an eine Wand. Das hallte nicht so wieder, wie Graham es von den Blechwänden eines Containers erwartet hatte; das Klopfen wurde verschluckt, als wären die Wände massive Steinmauern. Gut, beim Fernsehen arbeiteten auch Tontechniker, die sich mit schallschluckenden Wandbeschichtungen auskannten.
Die Bänke waren schwer und ebenfalls aus massivem Holz, glattgewetzt durch hunderte von Hosenböden, die im Laufe der Zeit darauf gesessen haben mussten. Das Feuer. Graham sah nachdenklich in den Kamin. Das war kein Elektro-Imitat und auch keine Gasflamme. Das da war ein Holzfeuer und verstieß damit gegen jede baurechtliche Vorschrift und einen verbrannten Finger später hatte Graham keinen Zweifel daran, dass es sich hier nicht um eine Illusion handelte. Wenn das ein Container war, dann mussten sich die Produzenten eine Menge Mühe mit ihrer Sendung geben. Ob das der Pilot ist? Sobald man die Quote erstmal erreicht hatte, konnte man immer noch an der Ausstattung sparen.
Fast unsichtbar im unruhigen Schatten des Kaminfeuers entdeckte Graham schließlich die zweite Tür. Er war beeindruckt vom Aufwand und von der Idee, die derjenige, wer auch immer hierfür verantwortlich war, in die Ausführung gesteckt hatte. Aber es war auch ein wenig creepy und Graham wäre froh darüber gewesen, gleich wieder auf irgendeiner dreckigen, menschenleeren Londoner Straße zu stehen. Graham ging zu der kleinen Seitentür und öffnete sie mit Schwung.
Keine Chance, dass er immer noch in einer Requisite stand. Das hier vor ihm war ein Flur, die Wände rechts und links aus massiven Stein und nicht aus schallschluckendem Schaumstoff. Die Türen waren echte Türen, keine Pappmaché-Nachbildungen. Die Dielen, auf denen er lief, knarrten wie echte Dielen in einem Haus, das mindestens ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hatte. Aber Graham hörte keine Geräusche aus den Zimmern, die irgendwie darauf hindeuteten, dass sich hier noch andere Menschen aufhielten.
Graham lief durch die Küche zurück und öffnete die Hintertür: die selbe enge Gasse, in die er durch eine kleine Tür von einer Londoner Hauptstraße aus getreten war. Graham trat ein paar Schritte vor das Haus, in dem er eben gewesen war, und schaute nach oben. Das Schild über der Tür war alt und im Gegensatz zu den anderen Schildern wohl seit längerer Zeit nicht mehr neu bemalt worden. Was auch immer dort einmal gestanden hatte, war jetzt nicht mehr zu lesen. Über dem Erdgeschoss waren noch zwei weitere Stockwerke, die Fensterläden geschlossen und durch die Spalten der Läden kein Licht zu sehen. Graham achtete darauf, dass die Tür nicht zufiel. Dann rüttelte er an den anderen Türen in der Gasse – sie waren alle abgeschlossen. Graham spielte mit dem Gedanken, die Straße hinunter zu gehen, bis er einen Menschen traf, den er nach diesem Ort fragen konnte. Aber er entschied sich dagegen. Je näher er an dem Punkt blieb, an dem er die Orientierung verloren hatte, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass er den Weg zurück wieder fand. Außerdem war es bei seiner Geschichte möglich, dass der andere Mensch ihn ziemlich schnell ziemlich weit weg bringen würde; an einen Ort, von dem er dann nicht wieder wegkam und in Klamotten, deren Ärmel sich hinter dem Rücken zusammenbinden ließen. Graham drehte um und betrat wieder das seltsame Haus.
Was er brauchte, war ein Plan. Die Bewohner würden sicher nicht begeistert sein, wenn ein Fremder ihr Haus durchwühlte, aber irgendwo musste Graham anfangen. Es musste eine logische Erklärung geben. Hatte ihm jemand K.O.-Tropfen verabreicht und den Blackout genutzt, ihn irgendwohin zu verschleppen? War es eine von diesen perversen TV-Reality-Shows, die ahnungslose Opfer verschleppten und dann dokumentierten, wie sich das Opfer in einer völlig ungewohnten Umgebung zurechtfand? Dann war dieses Haus mit Kameras und Mikrofonen vollgestopft, die sich finden lassen würden und einen Hinweis auf seine Entführer brächten1Notiz . Wenn es keine TV-Show war, wer hatte ihn dann entführt? Graham hatte seit der Uni bei Poor, Moore & Moody gearbeitet und war dort nur ein kleines Licht. Oder vielleicht eine mittelhelle Leuchte. Selbst siebenundzwanzig Millionen waren in einer Firma, die mit Milliarden jonglierte, keine große Summe. Graham war spezialisiert auf kleine, dafür komplizierte Fälle. Die, bei denen es Schwierigkeiten geben konnte. Schwierigkeiten in Form von Menschen.
Das war durchaus eine Möglichkeit, die er in Betracht ziehen musste. Hatten ein paar Angestellte der Brooklyn-Reederei mitbekommen, was wirklich los war und ihn aus dem Verkehr ziehen wollen? Wen auch immer Graham hier treffen würde – es war nicht ganz ausgeschlossen, dass sich derjenige nicht unbedingt als Freund entpuppen würde.
Zuerst musste er herausfinden, wo er war. Automatisch griff Graham nach seinem Smartphone. Falls seine Entführer es ihm nicht abgenommen hatten, konnte er seinen Aufenthaltsort per GPS exakt feststellen. Graham war erleichtert, als seine Finger sich um dessen glatte Form schlossen, denn es bedeutete auch, dass es sich um entsetzlich dumme Entführer handelte. Doch der Blick auf das Display enttäuschte Graham: Kein Netz, sagte der Provider und Keine Satelliten gefunden meldete das GPS.
»Mist!«, murmelte Graham, als er das Gerät ausschaltete und wegsteckte. Vielleicht ergab sich später eine Gelegenheit, Hilfe zu rufen. Ein leerer Akku wäre dann das Letzte, was er gebrauchen könnte. Nach einem Blick durch die Küche entschied sich Graham, den Rest des Hauses zu durchsuchen. So still, wie es hier war, waren die Besitzer entweder nicht da, oder sie schliefen so tief und fest, dass sie ihn nicht mitbekommen würden. Aber je mehr Graham wusste, desto schneller würde er auch einen Weg wieder raus finden.
Langsam und vorsichtig, jedes Geräusch vermeidend, schlich Graham zur Seitentür. Die kleinen Gaslampen, die an der Wand angebracht waren, verbreiteten ein blaues, flackerndes Licht. Graham hatte sich Gaslicht immer anders vorgestellt: wärmer und orange. Da aber seine einzige Erfahrung mit Gaslicht auf alten Schwarz-Weiß-Fotos von Museumsbesuchen in Kindertagen basierten, konnte er keinen Vergleich anstellen.
Das Licht würde es schwierig machen, sich in die Räume zu schleichen, ohne dort drin jemanden aufzuwecken, aber Graham fand keinen Hahn, an dem er das Gas abdrehen konnte. Mit einem Schulterzucken akzeptierte er das Risiko, als er leise die Klinke der ersten Tür auf der linken Seite herunterdrückte.
Die Vorsicht war unbegründet: er war in der Abstellkammer gelandet. Der Reisigbesen gab den Hinweis darauf, ein paar verbeulte Zinkeimer und ein Regal mit Einmachgläsern, Kerzen und Weinflaschen. Aus einem unbewussten Reflex heraus nahm Graham eine der Flaschen und las das Etikett. Nicht das ganze, sondern nur die Jahreszahl: 1857.
Es gab keine Chance, dass in einem normalen Haushalt so eine Flasche zu finden war. Graham war kein Experte, aber über hundert Jahre alter Wein lagerte in Tresorräumen von Banken und Auktionshäusern und wurde für horrende Summen versteigert. So ein Wein in einer Abstellkammer? Das würde kein normaler Mensch tun. Es sei denn ... Ein Gedanke zuckte durch Grahams Kopf: Was, wenn das hier kein Haus, sondern ein Museum war? Eine exakte Nachbildung eines Anwesens aus Königin Viktorias Zeit. Das würde alles erklären! Und auch, warum hier keine Menschen waren. Ein Museum! Graham atmete tief durch. Ein Museum. Das war es.
Mit diesem Gedanken fiel die Anspannung von Graham ab. Ein Museum bedeutete, dass irgendwann – und zwar eher früher als später – Besucher auftauchen würden. Und das würde bedeuten, dass er hier bald wieder rauskommen würde.
Ohne weiter auf Vorsicht zu achten, ging Graham in den nächsten Raum. Das war eine Werkstatt. Wer auch immer hier arbeiten sollte, hatte eine Menge mit Mechanik und Metallbearbeitung zu tun, aber auch mit Feinschmiedearbeiten, Kunst, Optik und einigen Dingen, mit denen Graham überhaupt nichts anfangen konnte. Er sah Zahnräder, die aus Messingplatten gefeilt und solche, die aus Gusseisen gefertig waren. Kaum eines war größer als ein Handteller, dafür waren viele so klein, dass die Bearbeitung unter der Lupe stattfand. Auf der Werkbank lagen halb fertige und halb auseinandergebaute Mechanismen, funkelnd wie kleine Juwelen im Licht der flackernden Gaslampe, die sogar in diesem Raum installiert war. Nach dem, was er sah, vermutete Graham einen Uhrmacher. So etwas hatte es früher gegeben, vor Digitaluhren, vor Smartphones.
Graham ging zum nächsten Zimmer auf der linken Seite. Wer auch immer hier wohnen sollte, es war nicht der Ordnungsfanatiker aus der Werkstatt. Untypisch für ein Museum lagen hier Sachen kreuz und quer auf den Stühlen und Tischen. Das Bett war so hergerichtet, als hätte jemand darin geschlafen und es anschließend in aller Eile verlassen, weil er verschlafen hatte. Graham betrachtete die Kleidung genauer. Die Sachen mochten einem jungen Mann gehören, der ungefähr die Größe und Statur von Graham hatte. Mit geübten Blick erkannte Graham, dass das Material von guter Qualität, aber kein Luxusprodukt war, eben das, was sich ein gutsituierter Handwerker leisten konnte. Seltsam, dachte Graham, das ich nie von so einem Museum mitten in der City gehört habe. Und das es sich hier halten konnte, während die Immobilienpreise in die Höhe schossen. Graham drehte sich um und inspizierte den ganzen Raum. Etwas störte ihn, etwas fehlte und Graham brauchte eine Weile, bis er darauf kam: es gab keine Hinweistafeln. So etwas gehörte in jedes Museum; kleine Schilder, die die gezeigten Gegenstände erklärten und die Daten präsentierten, aus welchem Jahr, welcher Epoche und welchem Ort die ausgestellten Stücke stammten. Das fehlte hier völlig. Oder war das hier eins der Museen, die nur mit Führung zu betreten waren? Vielleicht hätte es mehr Aufschluss gebracht, die Schubladen zu durchsuchen, aber die waren garantiert mit Alarmanlagen gesichert. Und so sehr Graham sich wünschte, hier rauszukommen: es musste nicht durch die Polizei und in Handschellen sein.
Das nächste Zimmer war ebenfalls ein Schlafzimmer, aber das volle Gegenprogramm zu dem nebenan. So hatte ein Museum auszusehen! Kein Stäubchen in Sicht, die Kleidungsstücke lagen ordentlich zusammengelegt im Schrank oder hingen auf Bügeln. Das Bett war gemacht, die Gegenstände auf dem Toilettentisch penibel angeordnet. In so einem Zimmer lebte kein Mensch, das hier war das Musterbeispiel einer Ausstellung mit dem Titel Leben im 19. Jahrhundert. Aber in einer Nische neben dem Bett stand etwas, was Grahams Aufmerksamkeit fesselte: eine Schneiderpuppe mit einem Kleid. Nicht mit irgendeinem Kleid, sondern dem, welches die Frau immer getragen hatte. Hatte dieser Ort irgendwas mit seinen Halluzinationen zu tun? Die einfachste Erklärung lautete, dass er eine Spiegelung gesehen hatte; nicht die eines Fotomodells, sondern einer jungen Frau, die hier Museumsführungen machte und dabei die Kleidung aus der entsprechenden Zeit trug. War das ihre Arbeitskleidung? Dann gab es hier sicher einen Spind, in dem sich weitere Hinweise finden ließen. Solche, die erklärten, wer diese Frau und was dieser Ort genau war. Graham riskierte es: Ausstellungsstücke mochten alarmgesichert sein, die Sachen der Angestellten waren es normalerweise nicht. Vorsichtig öffnete er den Schrank neben dem Kleid.
Es war kein Kleiderschrank. Es war überhaupt kein Schrank. Es war ein Wunderwerk der Technik, der Traum eines jeden Mechanikers.
Als Graham die Türen öffnete, entfaltete sich der ganze in die Holzkiste dahinter gequetschte Raum und breitete sich in das Zimmer davor aus. Statt nur Stauraum zu sein, beinhaltete dieser Schrank größeres. Es schoben sich Regale, Schubkästen, Ablageflächen, Werkzeughalter und eine Werkbank nach draußen. Als Graham die Tür ganz geöffnet hatte, war das halbe Zimmer, in dem er stand, kein Schlafzimmer mehr, sondern eine Werkstatt. Graham stutzte. Warum eine Werkstatt hier, wenn auf der anderen Seite des Flurs schon eine war? Und warum versteckte das Museum diesen Schatz, der doch wesentlich beeindruckender war, als alles andere in diesem Haus? Doch das, was wirklich Grahams Aufmerksamkeit auf sich zog, war ein dünnes Notizbuch, das in ein Seitenfach geklemmt war. Graham zog es vorsichtig heraus und öffnete es ohne die geringste Spur von schlechtem Gewissen. Wem auch immer dieses Notizbuch gehört haben mochte, er war längst tot und vergessen.
Schon beim ersten Blick sah Graham, dass das Buch einer Frau gehörte. Die Handschrift war weiblich. Der Inhalt nicht. Graham konnte schon von Berufs wegen mit mathematischen Formeln umgehen und betrachtete sich selbst gern als Genie, aber was er hier sah, überstieg seine Auffassungsgabe. Das Buch musste einer zweiten Marie Curie gehören. Oder jemanden in dieser Klasse. Graham hatte nicht die geringste Idee, was hier beschrieben wurde, nur dass es sich um etwas an der Grenze zwischen Mechanik und Physik bewegte. Präzise Miniaturskizzen zeigten detaillierte Geräte, die von einer Art Dampfmaschine angetrieben wurden. Einer Dampfmaschine, die kleiner war als ein Akku, falls es sowas jemals gegeben hatte. Aber statt darauf seine Aufmerksamkeit zu lenken, suchte Graham nach etwas anderem: einem Datum, einer Adresse oder einem Namen. Das würde ihm verraten, wo er hier war. Graham blätterte das Notizbuch durch, ohne weiter auf den Inhalt zu achten. Museumsstücke hatten immer eine Inventarnummer und manchmal auch einen Stempel des Instituts, dem das Stück gehörte. Aber nicht dieses Buch. Graham warf einen prüfenden Blick auf die Werkzeuge. Keins davon war inventarisiert. Ob der Schrank als ein einziges Stück geführt wurde? Graham steckte das Buch wieder zurück. Das alles brachte ihn nicht weiter. Aber einer der anderen Räume musste das Verwaltungsbüro sein und spätestens dort würde er seine Antworten finden.
Graham ließ den Schrank offen stehen. Das würde zwar verraten, dass er hier gewesen war und herumgeschnüffelt hatte, aber er hatte keine andere Wahl: ein cleverer Sperrmechanismus hatte die einzelnen Teile so fest verankert, dass sich nichts mehr zurück bewegen ließ. Graham vermutete, dass es sich an einer stabil verankerten Werkbank besser arbeitete.
Graham ging wieder nach draußen auf den Flur und zur letzten verschlossenen Tür. Er hörte gar nicht erst, ob dahinter Geräusche anwesende Personen verrieten, sondern trat gleich ein und ging ein paar Schritte in den Raum. Als sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sah er die sechs Personen, die am Tisch saßen. Sie waren unnatürlich still, wie Puppen. Kaum war Graham dieser Gedanke in den Kopf gekommen, sprangen gleichzeitig ihre Augenlider auf, drehten sie synchron ihre Köpfe und sahen Graham an. Nach drei Sekunden lächelten sie.
»Entschuldigen Sie«, stammelte Graham, »ich wusste wirklich nicht ...« Der Mann, der am nächsten zu ihm saß, erhob sich langsam. Er trug einen tadellos gearbeiteten Anzug. Hätte Graham sich etwas mehr mit der Geschichte beschäftigt, hätte er sofort gemerkt, dass es das Livree eines Hausdieners war. »Ich wollte hier wirklich nicht einbrechen!« erklärte Graham hastig. »Ich bin nur ... Das ist jetzt eine echt verrückte Geschichte.« Der Mann schien ihm nicht zuzuhören. Stattdessen machte er eine Geste, mit der er Graham bedeutete, ihm zu folgen. Die anderen – vier Frauen, gekleidet wie Dienstmägde aus dem guten, alten England, und ein Mann, der, seiner Kleidung nach zu urteilen, Koch sein musste – hatten sich ebenfalls erhoben und begannen geschäftig hin und her zu laufen. Graham folgte dem Hausdiener, der ihn zurück in den Hauptraum führte.
»Mein Name ist Graham Rodderik«, begann Graham die Stille zu füllen. »Und Sie werden es nicht glauben, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich meine, das ist die City! Dass sich hier so ein kleines Museum halten kann! Nichts gegen Sie, aber das ist schon anachronistisch.« Der Mann hatte einen Stuhl links neben dem Kopfende des langen Esstischs zurückgezogen und lud Graham ein, sich zu setzen. Obwohl die Geste freundlich aussah, machte sie den Eindruck, als wäre sie nur einstudiert. Und als würde ihre Nichtbefolgung ernste Konsequenzen haben. »Aber entschuldigen Sie: Wo bin ich hier?« Der Mann ignorierte Grahams Frage. Statt dessen schnippte er nur mit den Fingern, worauf eine der Mägde mit atemberaubender Geschwindigkeit begann, vor Graham aufzutafeln.
Sie setzte einen Teller vor Graham, der so groß wie eine kleine schottische Insel war. Darauf einen weiteren Teller und einen Suppenteller. Rechts erschienen drei Gabeln, links zwei Messer und etwas, was Graham schon mal im Zusammenhang mit Fisch gesehen hatte. Oben wurden fünf Löffel der Größe nach geordnet hingelegt, daneben drei Weingläser aufgestellt. Eine zweite Magd wartete geduldig und mit ernster Miene neben Graham. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er die Weinflasche, die sie ihm hinhielt, begutachten und seine Zustimmung geben musste. Er nickte vorsichtig. Kaum hatte er das getan, erschien ein bezauberndes Lächeln auf ihrem Gesicht, das ihre Augen nicht erreichte. Konzentriert füllte sie das erste Weinglas mit der Eleganz eines Sommeliers im Vier-Sterne-Restaurant.
Bis jetzt hatte Graham nicht gedacht, dass er hungrig wäre. Dann trugen die letzten beiden Mägde eine riesige, randvoll gefüllte Suppenterrine herein und setzten sie auf dem Tisch ab. Die zwei Zoll starken Eichenholzbohlen bogen sich unter dem Gewicht. Der Hausdiener nahm eine Kelle und füllte den Suppenteller vor Graham. Dann trat er zurück und lächelte.
Etwas an diesem Lächeln sagte Graham, dass er die Suppe essen und in den höchsten Tönen loben sollte. Denn andernfalls würde dieses Lächeln schnell verschwinden, genauso wie die Freundlichkeit dieser Leute. Vorsichtig probierte Graham die Suppe. Für jemanden, dessen Nahrung bisher aus Geschmacksverstärkern, Ersatzstoffen, Formfleisch und Kunstkäse bestand, war das Erlebnis einer echten Lauchsuppe ... enttäuschend. Es schmeckte bei Weitem nicht so stark nach Lauch wie die aufgekochten Tütensuppen, die Grahams Krone persönlicher Kochkunst darstellten. Diese Suppe schmeckte wesentlich milder, so als hätte der Koch den Geschmack genommen und um ein paar Stufen zurück geschaltet. Aber Graham aß weiter. Erst um seine Gastgeber nicht zu enttäuschen und wer weiß welche Reaktionen zu provozieren, dann, weil dieser Geschmack etwas süchtig machendes hatte. Etwas Echtes, dem Graham bisher noch nicht begegnet war. Sein Teller war fast leer, als er wieder aufblickte und den Hausdiener ansah.
»Das ist sehr gut. Der Koch ist wirklich Spitze!« Der Hausdiener lächelte unbeirrt und schnippte mit den Fingern. Eine der Mägde verschwand durch die Tür Richtung Küche. Als Graham auf seinen Platz sah, hatte die zweite Magd den Suppenteller schon abgeräumt.
»Ich hätte das noch...« begann Graham, hörte aber auf, als er merkte, dass niemand ihm zuhörte. Die Abläufe in diesem Haus erinnerten ihn an ein Ballett, an eine sorgfältig einstudierte Choreografie, bei der alles fehlerfrei und reibungslos funktionierte. Die aber auch nicht die geringste Abweichung vom Ablauf vertrug.
»Hören Sie, wie ist Ihr Name?« Der Hausdiener sah Graham mit einem geduldigen, irgendwie leeren Blick an. Graham seufzte. »Ok, wahrscheinlich durfte die Dienerschaft vor hundert Jahren nicht mit der Herrschaft sprechen und ich finde es echt toll, was Sie hier abziehen, diese Show und alles, aber Ihren Namen können Sie mir doch wenigstens sagen.« Nichts am Gesichtsausdruck änderte sich. Graham klopfte ihm auf die Schulter. Und er schluckte. »Sind die Muskeln echt? Da würde selbst Arnold blass werden.« Und ich möchte auf keinen Fall eine Ohrfeige von dir bekommen. »Ich sag Ihnen was: ich werde Sie Arnold nennen. Wenn Ihnen das nicht gefällt, brauchen Sie nur ein Wort zu sagen.« Die Reaktion blieb die gleiche wie vorher. Graham wusste nicht, ob das an seinem Humor oder Arnolds Verständnis davon lag. »Ok Arnold, diese Show hier ist toll und total realistisch und ich werde Sie auch bezahlen, vorausgesetzt Sie akzeptieren auch Kreditkarten, obwohl es die zu der Zeit nicht gab, aber der Punkt ist: ich habe keine Ahnung, wie ich hier reingeraten bin. Und vielleicht steht da draußen auf der Straße Ihr eigentlicher Kunde und wird jetzt ziemlich sauer. Was ich eigentlich möchte, ist auf schnellsten Weg wieder nach Hause.« Arnold richtete sich gerade auf und sah zur Tür. Der zum Flur, nicht der Haustür. Diese Tür wurde geöffnet und eine Magd trat mit einem riesigen Fisch ins Zimmer. Graham, der Fisch nur in Stäbchenform kannte, klappte das Kinn nach unten.
Auf einem Silbertablett wurde ein Tier präsentiert, dass die Größe eines Spanferkels hatte, nach Grahams Biologiekenntnissen aber ein Karpfen sein musste. Von dem Tier konnte eine achtköpfige Familie leicht eine Woche leben. Trotzdem balancierte die Magd die Platte mit einer Leichtigkeit und Anmut, als ob sie gar nichts wiegen würde. Als der Fisch vor Graham auf dem Tisch abgestellt wurde, überrollte eine Welle von Wohlgerüchen Graham mit einer Wucht, die dieser von Microwellenmahlzeiten nicht gewohnt war. Der Fisch badete in einem See aus Zitronensaft, war umhüllt von einer krossen Kruste, die von geschmolzener Butter troff. Unwillkürlich lief Graham das Wasser im Mund zusammen. Arnold schnitt mit geübter Hand ein Stück aus der Seite des Fischs und legte es auf Grahams Teller. Dessen Hirn hatte nach einigen statistischen Berechnungen über die Wahrscheinlichkeit, jemals wieder so einen Leckerbissen zu bekommen, festgestellt, dass ein voller Magen und mangelnder Appetit kein Grund darstellten, dieses Mahl abzulehnen.
Graham spießte mit der Gabel, von der er vermutete, dass es die richtige war, ein Stück Fisch auf und führte es zum Mund.
Der Fisch zerging auf der Zunge. Bisher völlig unterforderte Geschmacksknospen erkannten plötzlich den wahren Zweck ihrer Bestimmung und lieferten Informationen ans Gehirn, welches seinen Standard bezüglich wohlschmeckender Nahrung einige Stufen nach oben schraubte. Die Komposition aus der feinen Säure der Zitrone zusammen mit der Süße der Kruste (die aus dem Honig stammte, eine Feinheit, die Graham nie erkannt hätte) war perfekt abgestimmt, um beim Genießer so etwas wie einen Rausch zu erzeugen. In Grahams Fall übersprang das Gehirn den Rausch und schaltete gleich auf Ekstase. Alles, was Graham nach diesem ersten Bissen vorbringen konnte, war ein glückseliges »Wow!« als er sich mit geschlossenen Augen nach hinten in den Stuhl sinken ließ. Für zwei Sekunden. Dann forderte sein Körper unerbittlich Nachschub.
Graham öffnete die Augen wieder und sah die Angestellten um ihn herum versammelt, die ihn lächelnd, aber verständnislos ansahen.
»Das ist wirklich grandios. Ihr habt da echt eine Nische entdeckt! Schlemmen, wie die Könige! Und der Koch! Der ist ein Genie!« Das Lächeln blieb. Die Verständnislosigkeit auch.
Graham widmete sich wieder dem Fisch. Ohne sich ablenken zu lassen, genoss er ihn bis zum letzten Bissen. Als er sich satt und zufrieden nach hinten lehnte, schnippte Arnold mit den Fingern. Der Fisch wurde abgetragen und im gleichen Moment trat die zweite Magd mit einem weiteren Tablett durch die Tür.
Wenn der Fisch schon eine Offenbarung war, dann war das hier... das Himmelreich.
Auf dem Tablett lag, stilecht mit Apfel im Maul drapiert, ein ganzes gebratenes Schwein. Keine einzelnen Steaks, keine kleinen Medaillons, keine einzelne Keule, sondern das ganze Tier. Graham, der Ferkel nur von den Ein Schweinchen namens Babe-Filmpostern kannte, konnte es nicht fassen. Zum Glück hatte der Koch daran gedacht, dem Tier die Augen zu schließen, bevor er es mit einer Marinade bestrich. Das Schwein sah im flackernden Schein des Kaminfeuers aus, als würde es noch leben, als hätte es sich in ein Nest aus Kräutern und Tomaten zu einem Schläfchen hingelegt. Nur die zwei Messer in seinem Rücken trübten das Bild. Die blonde Magd, die Graham in seinem Kopf Magda nannte, stellte das Tablett mit formvollendeter Anmut auf den Tisch, während Arnold die Messer zog und mit atemberaubender Geschwindigkeit ein Filet aus der Hinterkeule schnitt und es auf Grahams Teller legte. Das ganze übergoss Magda mit einer dicken, braunen Soße und umrahmte es mit Kartoffeln, die sie geschickt aus einer Terrine holte, die Maria (Graham war nicht sehr einfallsreich, wenn es um Namensgebung ging) gleich hinter ihr aus der Küche getragen hatte. Die Kartoffeln platzierte sie in perfekter Symmetrie und trat zurück, als sie die Aufgabe beendet hatte. Graham wusste nicht, ob Applaus angebracht war. Als der Duft seine Nase erreichte ließ ihn sein Riechzentrum sofort vergessen, dass er gerade einen riesigen Fisch gegessen hatte. Graham schnappte sich das Besteck – ohne auf Arnolds missbilligenden Blick zu achten, weil er das falsche Messer erwischt hatte. Graham machte sich über das Fleisch her, als wäre er ein Schiffbrüchiger, der nach sieben Jahren auf einer einsamen Insel endlich wieder einmal eine zivilisierte Mahlzeit bekommt. Nach und nach verschwanden Fleisch, Kartoffeln und Beilagen in seinem Mund. Graham ließ sich noch zweimal nachlegen, bevor er sich zurücklehnte.
»Das war ... grandios. Unbeschreiblich. Wahnsinn. Ihr Jungs solltet echt mehr Werbung machen.« Er hörte, wie die Tür zum Flur aufging und stöhnte. »Ich schaff keinen Bissen mehr. Nachtisch? Nein, danke! Nehmt's mir nicht übel, aber das schaffe ich echt nicht mehr.«
»Hat's geschmeckt?« fragte eine weibliche Stimme. Graham zuckte zusammen. Er hatte sich daran gewöhnt, dass diese seltsamen Diener keinen Laut von sich gaben, sodass die Stimme eine beängstigende Abwechslung war. Er sah sich um.
Dort stand sie. Die Frau aus dem Spiegel. Das altertümliche Kleid. Die wilden Locken. Die Stupsnase.
Aber ohne das Lächeln. Und das Feuer der Wut in den großen, braunen Augen.
Notiz 1 Die sich danach ganz sicher wünschen würden, nie auf so eine bescheuerte Idee gekommen zu sein.
Kapitel 3 - Das Haus der Puppen
»Das! War! Das! Mahl! Für! Königin! Viktoria!« Jedes Wort wurde einzeln durch zusammengepresste Zähne gequetscht. »Nicht für einen dahergelaufenen Taugenichts!«
»Hey, ganz ruhig! Ich werde das bezahlen!«
»Bezahlen? Es dauert Ewigkeiten, die Programmierung wieder zurückzusetzen! Und wir haben keine Ewigkeiten! Wir haben nicht einmal sechs Stunden! Dass reicht nicht, um ein Schwein durchzubraten!« Einem wagemutigen Gedanken gelang es, sich durch das Chaos zu kämpfen und Grahams Aufmerksamkeit zu erregen.
»Moment! Viktoria? Die Königin heißt Elisabeth.« Die Frau sah Graham mit einem Ausdruck in den Augen an, den er nur als reine Mordlust beschreiben konnte.
»Ich werde doch wohl wissen, für wen ich die letzten Monate die Fenster poliert habe, bis kein Fleckchen mehr darauf zu sehen war und das in einem Land, in dem ein Tag ohne Regen nicht nur ein guter Tag, sondern ein Wunder ist!« Graham hätte gern etwas erwidert, aber mit einer Furie vor sich war es klüger zu schweigen. Stattdessen wurde Graham etwas Seltsames bewusst: Die Angestellten standen vollkommen unbeteiligt im Raum und rührten sich nicht. Überhaupt nicht. Sie atmeten nicht einmal. Als ob ihnen der Ausbruch der Hausherrin entweder extrem unangenehm war oder die Situation sie schlicht überforderte. In beiden Fällen stellten Arnold und seine Kollegen keine Hilfe dar1. »Acht Monate von früh bis abends putzen, putzen, putzen, nur um einmal nah genug an die Königin zu kommen, um die einzige, winzige Chance zu bekommen, die unseren Durchbruch bedeutet hätte! Und jetzt kommt ein Hanswurst und macht alles kaputt!«
»Hey, ich bin kein Hanswurst!« Graham war sich nicht sicher, ob sein Einwurf hilfreich war, aber er hatte keine Lust, sich weiter herumschubsen zu lassen. »Ich dachte, das wäre ein Museum.«
»Pah!« In dieser Silbe lag so viel Verachtung, dass Graham sofort wusste, was diese Frau – bei genauerer Betrachtung eigentlich eher dieses Mädchen, denn älter als siebzehn konnte sie nicht sein – von Menschen hielt, die selber dachten. Wahrscheinlich glaubte diese Ziege, dass sie allein alle Intelligenz der Welt für sich gepachtet hatte. Unglaublich, dass er wegen ihr ein paarmal früh aufgestanden war.
»Und ich bin hier nicht eingebrochen. Ich wurde überfallen und bin auf der Flucht den Räubern hier ... reingestolpert.«
»Durch die verschlossene Tür?«
»Die war offen.«
»Was?« Mit schnellen Schritten war das Mädchen bei der Tür und untersuchte das Schloss. »Dieser Idiot!« murmelte sie schließlich. »Das mein Bruder vergessen hat, die Tür abzuschließen, ist keine Entschuldigung dafür, hier einzudringen.« Graham öffnete den Mund, aber eine herrische Geste gebot ihm Einhalt. »Ich habe mich noch eben mit dem Polizisten unterhalten, der mich freundlicherweise noch bis zum Haus begleitet hat. Und er hat mir erzählt, dass es eine außergewöhnlich ruhige Nacht war. Sparen Sie sich also das Märchen mit dem Überfall. Er müsste noch in Rufweite sein. Mal sehen, was er zu Ihrer Geschichte sagt. Wahrscheinlich wird er Sie in eine Zelle stecken. Und wenn ich Glück habe, werden Sie gleich mit dem nächsten Schiff nach Australien verfrachtet.« Das Mädchen machte den Schritt zum Flur, wo es auf der anderen Seite eine Tür zur Straße geben musste, wo dieser Polizist war, der wahrscheinlich dieses Mädchen kannte und sich ihre Geschichte anhören würde. Graham schaltete schnell. Es sah nicht gut für ihn aus; er war in einem fremden Haus, hatte es sich gut gehen lassen und für seine Version der Ereignisse keine Beweise. Jeder halbwegs vernünftige Bobby würde ihn nehmen und im Revier in eine Zelle sperren. Das durfte er zwar nur für vierundzwanzig Stunden, aber vierundzwanzig Stunden genügten, um den Ruf eines Finanzgenies nachhaltig zu schädigen. Zumindest so weit, dass kein vernünftiger Kunde ihm noch sein Geld anvertrauen würde.
»Hören Sie, was auch immer ich für einen Schaden angerichtet habe, ich bezahle das. Hier ist meine Kreditkarte.« Das Mädchen nahm die Karte und drehte sie in ihrer Hand hin und her. Graham hatte den Eindruck, dass sie damit nichts anfangen konnte. »Sie akzeptieren doch Kreditkarten?«
»Was soll das?«
»Sie stecken das in Ihr Lesegerät und belasten mein Konto mit welcher Summe auch immer Sie denken.«
»Und Sie glauben, Sie brauchen nur mit dieser Karte zu wedeln und alles ist gut? Ich werde die hier als Pfand behalten, bis klar ist, welchen Schaden Sie angerichtet haben. Ist das Ihr Name? Graham Rodderik?«
»Ja.« Mist, jetzt kannte sie seinen Namen!
»Ist das Ihr richtiger Name?«
»Sind Sie immer so misstrauisch?«
»Nur gegenüber Dieben.«
»Ich bin kein Dieb. Und ich möchte Ihnen gerne helfen, dieses Missgeschick wieder auszubügeln.« Graham versuchte es mit einem charmanten, vertrauenserweckenden Lächeln, so wie es in den Seminaren für Profi-Verkäufer gelehrt wurde. Früher, als er noch Versicherungen verkaufen musste.
»Das Sie dazu fähig sind, wage ich zu bezweifeln. Ich habe mir den Allerwertesten abgeschuftet, um das alles hinzubekommen.« Das mit dem Lächeln hatte schon früher nicht geklappt.
»Und es ist ein entzückender Allerwertester.« Graham hatte gesprochen, ohne vorher nachzudenken. Und er sah auch nicht, was als Nächstes passierte. Er spürte nur einen brennenden Schmerz auf der Wange und sah die Augen einer Furie vor seinem Gesicht.
»Impertinent!« zischte das Mädchen. »D1, fesseln!« Arnold erwachte plötzlich wieder zum Leben. Seine Bewegungen hatten jetzt nichts Steifes mehr, sondern waren schnell, effizient und überraschend stark. Arnold war hinter Graham getreten, hatte seine Handgelenke gepackt und hielt sie zusammen. Graham versuchte, seine Arme zu bewegen, aber es war, als ob die in einem Schraubstock eingeklemmt wären. »Auf den Stuhl mit ihm und gut festbinden. Ich will nicht, dass er entwischt.«
»Das geht jetzt zu weit«, protestierte Graham. »Ich werde mich beschweren!«
»D1, knebeln!« Sekundenbruchteile später hatte Graham ein gestärktes Taschentuch im Mund und keine Chance mehr, seine Version zu erzählen. Aber er musste es versuchen.
»Mmmpf! Hrrg!« Das Mädchen beachtete ihn überhaupt nicht. Sie sah sich um, als suchte sie etwas.
»D1, wo ist Geert?« Arnold machte einige Gesten.
»Aha. Und wann wird er zurück sein?« Arnold zuckte mit den Schultern.
»Gut. Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. M1, du gehst nach draußen, auf die Sankt Georg Road und suchst nach einem Polizisten. Du gibst ihm das hier!« Das Mädchen kritzelte eine kurze Notiz auf ein Blatt Papier und gab sie Maria. Diese verzog keine Miene und rührte sich nicht. Das Mädchen bemerkte das offensichtlich auch. »M1 führe Anweisung P drei acht sieben aus. Im Fehlerfall führe Fehlerbehandlungsprotokoll zwei fünf neun durch. Verstanden?« Die Magd nickte.
»Los.« Mit einem Rauschen ihrer Kleider verschwand die Magd durch die Tür. Das Mädchen lief ein paar Mal durch den Raum und sah aus, als wälzte sie in ihrem Kopf eine Menge Probleme. Schließlich zog sie ein Notizbuch aus einer Tasche, die in den weiten ihrer Röcke verborgen sein musste, nahm sich einen Stuhl, den sie vor Graham stellte und setzte sich darauf.
»Ich werde Ihnen jetzt den Knebel rausnehmen«, sagte sie, »und Ihnen einige Fragen stellen. Ich erwarte umfangreiche, detaillierte Antworten, keine Abschweifungen und keine Versuche zu schreien. Haben Sie das verstanden?« Graham nickte. »In Ordnung. D1, Knebel!« Arnold zog Graham das Taschentuch aus dem Mund.
»Danke«, murmelte Graham. Solange er in der unterlegenen Position war, gab es keinen Sinn, Ärger zu machen. Das Mädchen kritzelte in ihr Buch. Graham fragte sich schon, ob sie ihn vergessen hatte, als sie ihn ansah.
»Wie sind Sie in dieses Haus gekommen?«
»Die Tür war offen. Als einzige in der Straße. Und ich war auf der Flucht, wie ich schon sagte.«
»Sie haben alle Türen in der Straße ausprobiert?«
»Ja.«
»Aha.« Etwas an der Betonung dieses Aha klang, als hätte er eben ein Kapitalverbrechen zugegeben.
»Woher wussten Sie über unser Haus Bescheid?«
»Ich wusste gar nicht Bescheid. Ich weiß nicht einmal jetzt, wo ich überhaupt bin. Wo bin ich?«
»Das werden Sie schon früh genug erfahren. Von wem haben Sie die Informationen über die Mechanoiden?« Graham runzelte die Stirn.
»Als Kind hatte ich MatchBox-Autos.« Das Mädchen zögerte.
»Autos aus Streichhölzern? Was soll das sein?«
»Nicht aus Streichhölzern. Ich meine Autos in der Größe von Streichholzschachteln.«
»Und ich meine nicht Streichholzschachteln«, erwiderte das Mädchen scharf, »sondern Autos. Was soll das sein?« Jetzt klappte Graham das Kinn nach unten.
»Autos sind ...«, sagte er überrascht. »Sie müssen doch wissen, was Autos sind!«
»Ich muss gar nicht!« schnappte sie. »Was sollen diese Autos sein?«
»Vier Räder, ein Motor, ein paar Sitze und man kann damit durch die Gegend fahren.«
»So wie Droschken.«
»Bloß ohne Pferde.« Das Mädchen schnaubte verächtlich.
»Natürlich ohne Pferde. Wer fährt heute noch Droschken mit Pferden?«
»Wie ist Ihr Name?« fragte Graham, solange sie abgelenkt war. Die Antwort kam automatisch, bevor ihr Gehirn intervenieren konnte.
»Miranda.« Mit einem Ruck kehrte das Mädchen aus seiner Gedankenwelt zurück. »Und ich stelle hier die Fragen! Wie haben Sie die Mechanoiden gefunden?«
»Welche Mechanoiden? Ich habe im Haus nach jemanden gesucht, den ich um Hilfe bitten kann, und im letzten Zimmer Ihre Angestellten gefunden.«
»Sie haben das Haus durchsucht?« Graham merkte sofort, wonach sich das anhörte.
»Weil ich einen Menschen finden wollte, der mir helfen kann.«
»Was haben Sie gesehen?« Graham zögerte einen Sekundenbruchteil. Er hätte seine Aktion runterspielen können, sagen können, er hätte nur an die Türen der Zimmer geklopft. Andererseits hatte er ganz sicher irgendwo Spuren hinterlassen – nicht zu vergessen den Werkzeugschrank, der oben immer noch aufgeklappt dastand und ganz bestimmt nicht aussah, als hätte Graham nichts angefasst – und vielleicht erzählte die Dienerschaft eine ganz andere Version. Graham entschied sich für schonungslose Ehrlichkeit.
»Die Abstellkammer, eine Werkstatt. Ein chaotisches Schlafzimmer und ein ordentliches Schlafzimmer. Und das Zimmer mit Ihren Angestellten. Von da an lief alles automatisch. Ich habe versucht Arnold zu erklären ...«
»Arnold? Ist das Ihr Komplize? Ist er noch hier im Haus?« Miranda zog etwas aus einer anderen Rocktasche, was verdächtig nach einem Gegenstand aussah, mit dem man seinen Mitmenschen empfindlich weh tun konnte. Graham wies auf ihren Hausdiener.
»Ich meine ihn. Er wollte mir seinen Namen nicht sagen, also hab ich ihn Arnold genannt. Was ist das überhaupt für ein Verein? Irgendwas Wohltätiges? Stellen Sie nur Behinderte ein?« Miranda schwang ihre Aushilfskeule bis kurz vor Grahams Schädel.
»Sie wissen sehr genau, was für ein Haus das ist! Ansonsten wären Sie hier nicht eingebrochen!«
»Wie oft soll ich es noch sagen: Ich bin hier nicht eingebrochen! Es war Zufall, dass ich hier rein gestolpert bin!« In diesem Moment wurde die Tür geöffnet und zwei Männer, gefolgt von der entsandten Magd, betraten das Zimmer. Sie trugen keine Uniformen, was entweder ein gutes Zeichen war, oder ein besonders schlechtes, wenn diese zwei Herren von Scotland Yard direkt kamen.
»Miranda, was ist hier los?« sagte der erste der beiden Männer. Er war jung, glatt rasiert, gut, wenn auch nicht teuer, gekleidet und hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Mädchen, dass er mit ihr verwandt sein musste. Ihr Bruder, vermutete Graham. Dass ein leicht spöttisches Grinsen auf seinem Gesicht blieb, während er mit Miranda redete, unterstützte diese Annahme.
»Wir haben gehört, dass eine Dame in Not gerettet werden muss.« Miranda funkelte den zweiten Mann an.
»Sehe ich aus, als ob ich gerettet werden müsste?«
»Nein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass ich mich der schönsten Frau der Welt als Held erweisen kann.« Dieser Mann war älter als der erste, ebenfalls glatt rasiert, geschmackvoll und – im Gegensatz zu Nummer Eins – teuer gekleidet. Er sah aus, als wäre er der Traum jeder Schwiegermutter und jeder Schwiegertochter. Graham konnte ihn auf den ersten Blick nicht leiden.
»Ich habe diesen Einbrecher gestellt. Allein. Keine Notwendigkeit für Helden.« Nach kurzer Überlegung fügte Miranda hinzu: »Obwohl die Bereitschaft sehr geschätzt wird.« Nummer Zwei seufzte leise.
»Diese Worte erfreuen mein Herz. Was meinst du Geert, sollten wir diesen armen Tropf von seinen Fesseln befreien und herausfinden, was seine Intentionen sind?« Geert nickte und trat sofort zu Grahams Stuhl, um seine Fesseln zu lösen.
»Halt!« rief Miranda. »Das ist ein Spion. Ich weiß nicht, wer ihn geschickt hat, aber« – und bei diesen Worten zerrte sie Geerts Hand weg von Graham – »er hat unsere Diener sabotiert.«
»Ich habe gar nichts!« schnappte Graham. »Ich bin versehentlich in das Zimmer und von da an lief alles auf Automatik. Ich wollte es ja erklären, aber mir hört ja keiner zu!« Geert sah Miranda fragend an.
»Stimmt das, Schwester?« Miranda nickte.
»Es ist alles weg. Die Suppe, der Fisch, das Schwein.«
»Ich bezahle das natürlich«, warf Graham ein.
»Das ist schlecht, Alexander.« Was auch immer das zu bedeuten hatte, Graham merkte sofort, dass die beiden Männer sich Sorgen machten.
»Wann ist das Essen?«
»Heute Abend.«
»Das sind noch vierzehn Stunden. Wie lange braucht ihr, um die Mechanoiden neu zu programmieren?«
»Sechs Stunden.«
»Gut. Tut das. Ich werde sehen, ob ich für viel Geld und ein paar gute Worte einen Spitzenkoch auftreiben kann.«
»Das kannst du nicht tun!« rief Miranda. Wider Erwarten huschte ein Lächeln über Alexanders Gesicht.
»Doch das kann ich. Vielleicht komme ich heute doch noch dazu, mich als Held zu erweisen.« Er nahm ihre Hand und hauchte einen galanten Kuss darauf. »Ich glaube an euch. An euch beide.«
»Und was machen wir mit ihm?« fragte Geert.
»Lasst ihn da sitzen. Solange er gefesselt ist, kann er keinen weiteren Schaden anrichten.« Mit den Worten verließ Alexander das Haus.
»Das können Sie nicht tun!« rief Graham. »Das ist Freiheitsberaubung! Das wird ein Nachspiel haben! Ich werde meine Anwälte auf euch hetzen und die werden euch fertig machen!« Miranda bezog Stellung vor ihm.
»Mein Bruder und ich müssen uns jetzt konzentrieren, um den Schaden zu reparieren, den Sie angerichtet haben. Sie können still hier sitzen, bis wir fertig sind, oder ich gebe D1 den Befehl, Sie wieder zu knebeln. Und in die Abstellkammer zu bringen. Wo ich Sie höchstwahrscheinlich vergessen werde. Ihre Entscheidung?«
»Ich bin ja schon still.«
»Gut.« Geert hatte nichts davon mitbekommen. Er war bereits in seine Arbeit vertieft. Alle Diener hatten um den großen Tisch herum in genau derselben Reihenfolge Platz genommen, in der sie bereits in dem anderen Zimmer gesessen hatten. Sie wirkten seltsam leer und unbeteiligt, auch als Geert einen langen Schraubendreher nahm, den Hemdkragen von Arnold nach unten zog und den zwanzig Zentimeter langen Metallstab in dessen Rückgrat rammte. Graham klappte das Kinn nach unten. Dann drehte Geert den Kopf des Hausdieners so weit nach links, dass Graham glaubte, die Halswirbelsäule brechen zu hören. Dann riss er einmal am Kopf und zog ihn nach oben ab.
»Sie haben ihn umgebracht«, stammelte Graham. »Sie sind ein irres Monster. Sie haben ihn einfach umgebracht!«
»Was?« Geert stand mit dem Kopf in der Hand da und schaute jetzt Graham ungläubig an. »Wer wurde umgebracht?«
»Ihr Hausdiener! Sie haben seinen Kopf in der Hand!« Geert schaute verwundert auf den Kopf in seiner Hand. Bisher hatte Graham geglaubt, dass so eine Todesart mit viel mehr Blut verbunden war. Aber davon war kein Tropfen zu sehen. Dann sah Geert Graham an.
»Sie haben wirklich geglaubt, D1 wäre ein Mensch?«
»Er sieht aus wie einer, er geht wie einer, er verhält sich wie einer, natürlich ist es ein Mensch!«
»Hast du das gehört Miranda! Er hat geglaubt, meine Mechanoiden wären echte Menschen!«
»Lass dich nicht einwickeln, Geert. Ich bin sicher, das ist nur ein Ablenkungsmanöver.«
»Was soll das heißen? Mechanoiden? Diener sind keine Mechanoiden. Sie sind Menschen. Mit allen Rechten. Das steht in irgendeiner Konvention. Und Sie werden sich wünschen, Sie hätten das beachtet, denn so kriegen meine Anwälte Sie auch wegen Sklavenhandels dran!«
»Lass dich nicht ablenken, Geert«, warnte Miranda.
»Nein sieh mal«, erwiderte Geert. »Er glaubt echt, was er sagt.« Dann kam er mit dem Kopf in der Hand auf Graham zu. »Hier, schauen Sie.« Er hielt Graham das Halsende hin. Widerwillig, so wie ein Gaffer nicht seinen Blick vom zerfetzten Kadaver auf der Autobahn abwenden kann, schaute Graham auf das Ergebnis des Gemetzels. Er hatte erwartet, Fleisch, Sehnen, Knochen, Adern und jede Menge Blut zu sehen. Was er wirklich sah, waren Zahnräder, Gestänge, Drähte. Arnold, oder D1, war eine mechanische Puppe.
»Er wickelt dich ein«, flötete Miranda.
»Nein, tut er nicht.«
»Das ist eine Puppe!« stellte Graham das Offensichtliche fest.
»Nicht nur irgendeine!« rief Geert mit kindlicher Begeisterung. »Meine Mechanoiden sind die besten der Welt!«
»Fängt das wieder an«, murmelte Miranda. Graham brauchte sie nicht zu sehen, um zu wissen, dass sie dabei ihre Augen rollte. »Geert, konzentrier dich. Wir müssen die Mechanoiden bis heute Abend wieder neu programmiert haben und das schaffen wir nicht, wenn du mit diesem Trottel schwatzt!«
»Er ist kein Trottel!«
»Ihr Bruder hat recht.«
»Nein, auf keinen Fall hat der das«, stimmte Miranda mit unüberhörbaren Sarkasmus in der Stimme zu. »Oder war es etwa ein Geniestreich, weswegen wir mit sechs abgelaufenen Mechanoiden und ohne Zeit dastehen?« Mit einer raschen Drehung stand Miranda plötzlich vor Graham und zielte mit einem Gegenstand auf seine Brust, mit dem sie die Mechanoiden reparieren, einen Menschen aber wahrscheinlich auch umbringen konnte. »Wie gut kennen Sie Stokesham?«
»Gar nicht!« erwiderte Graham verblüfft. »Wer ist das?«
»Stokesham ist einer unserer ärgsten Konkurrenten«, erklärte Geert. »Seine Produkte sind unseren in jeder Hinsicht unterlegen.«
»Außer in der Produktion. Er stellt sie in Massen her, während wir nur unsere Prototypen haben« ergänzte Miranda. »Und er wäre der Typ, der einen Saboteur schicken würde.«
»Aber der Name sagt mir nichts.«
»Ich bin mir sicher, dass Ihnen auch eine Menge anderer Dinge nichts sagt«, entgegnete Miranda. »Aber diesmal bin ich mir sicher, dass Sie die Wahrheit sagen.«
»Schwester, du solltest diesem Herrn mit etwas mehr Respekt begegnen.«
»Warum?«
»Es könnte sein, dass seine Geschichte wahr ist.«
»Ja und es könnte sein, dass die Kontinente große Platten sind, die auf einem Meer aus flüssigem Stein langsam über die Erdoberfläche schwimmen.«
»Das tun sie«, warf Graham ein.
»Jetzt werden Sie lächerlich.« erwiderte Geert. »Das ist eine wilde, neumodische Theorie.« Graham war verblüfft. Er hatte schon von Plattentektonik gehört, als er als kleines Kind seine Nachmittage mit BBC-Dokumentationen verbracht hatte, die seine Eltern ihm erlaubten zu sehen, während sie ihren Jobs nachgingen, um die Familie über Wasser zu halten. Wann hatte man das rausgefunden? Vor hundert Jahren? Oder noch eher? Graham überlegte einen Moment, bevor er die nächste Frage stellte. Denn es konnte sein, dass die Antwort ihm nicht gefiel.
»Nur so eine Frage, um ganz sicher zu gehen. Welches Jahr haben wir?«
»1857.«
»Mist!«
»Wieso? Welches Jahr sollten wir denn haben?«
»2016. Und das hier ist kein Method-Acting?«
»Wahrscheinlich nicht«, antwortete Geert. »Ich muss aber zugeben, dass es sich meiner Kenntnis entzieht, was Method-Acting ist.«
»Eine Schauspielmethode, in der der Schauspieler so sehr in seiner Darstellung aufgeht, dass sie seine Realität ersetzt.«
»Klingt nach einem Insassen der städtischen Irrenanstalt. Nicht nach uns«, ergänzte Miranda. »Was ist mit Ihnen? Sind Sie ein Method-Actor?« Geert legte seiner Schwester eine Hand auf den Arm.
»Miranda! Was, wenn er recht hat?«
»Und er wirklich aus der Zukunft kommt? Geert, das ist zu verrückt. Nicht mal dieser Jules Verne kommt auf so einen Schwachsinn. Das da ist ein ganz gewöhnlicher Einbrecher, der versucht, dich mit einer wilden Geschichte um den Finger zu wickeln. Du solltest nicht so leichtgläubig sein.« Geert beugte sich vor und flüsterte seiner Schwester etwas ins Ohr. Graham hatte Mühe, es zu verstehen.
»Erinnerst du dich, was der Bibliothekar über hohe Konzentration von Aether gesagt hat? Über die Nebeneffekte?« Miranda sah Geert mit großen Augen an.
»Das ist nur eine Theorie!«
»An der vielleicht etwas dran ist.«
»Wenn das so ist, sitzen wir in der Klemme.«
»Nicht wir. Er.«
»Ja. Und er sitzt im gleichen Zimmer«, schaltete Graham sich ein. »Und er hat sehr gute Ohren. Was sind die Nebeneffekte von Aether?« Geert rieb sich das Kinn.
»Das ist nicht mein Spezialgebiet. Und seine Erklärungen waren sehr speziell. Aber ich glaube, die Kurzfassung lautet, dass in der Nähe von hohen Aetherkonzentrationen Zeitverzerrungen auftreten können.«
»Und das heißt?«
»Sie sind irgendwie durch ein Loch hundertfünfzig Jahre in die Vergangenheit gefallen.«
»Das ist lächerlich!«
»Das könnten wir über Ihre Behauptung, aus der Zukunft zu kommen, auch sagen. Oder haben Sie Beweise dafür?«
»Natürlich!« antwortete Graham schnell. »Die Kreditkarte! Läuft 2018 ab und es wäre wohl keine Bank so bescheuert, eine Karte über hundert Jahre gültig zu stellen.«
»Kreditkarte? Was soll das sein?« fragte Geert.
»Ich glaube, er meint das hier.« Miranda zog aus ihrer Rocktasche die Kreditkarte, die Graham ihr vorhin gegeben hatte. Geert nahm das Plastikstück und drehte und wendete es hin und her.
»Da sehen Sie, da steht 2018 drauf.« Miranda kritzelte etwas auf ein Blatt Papier und hielt es Graham vor die Nase. Darauf stand: Ich komme aus der Zukunft. 31.12.3198.
»Das ist als Beweis genauso viel wert wie Ihre sogenannte Kreditkarte.« Geert hatte die Kreditkarte weiter untersucht und tippte seine Schwester an.
»Hier, sieh mal.«
»Was ist das?« Die beiden wandten ihre Rücken Graham zu und beugten sich über die Karte.
»Siehst du, wie es sich verändert, wenn der Lichteinfall wechselt?«
»Ich habe davon gehört, aber es war nur ein theoretisches Papier. Ich wusste nicht, dass man es schon herstellen kann.«
»Was, verdammt nochmal!« rief Graham dazwischen. Er wurde von beiden Geschwistern ignoriert.
»Und dieses Material. Ich kenne es nicht.«
»Was ist an einer kleinen Plastikkarte so interessant? Da steht ein Datum und mein Name drauf, das sollte doch reichen!« Geert drehte sich um.
»Tut mir leid, meine Schwester hat recht. Jeder kann ein beliebiges Datum auf ein Stück Papier schreiben. Aber was ist das für ein Material?« Graham stutzte.
»Plaste, nehme ich an?«
»Und was ist Plaste für ein Stoff?«
»Ein ... Polymer?« Graham kam langsam in Bereiche, in denen sein Wissen eher dünn und vage war.
»Polymer sagt mir nichts. Davon habe ich noch nie etwas gehört.«
»Wie solltest du auch, Schwester? Du hast nicht die Universität besucht.« Der Blick, den Geert dafür abbekam, hätte ihn getötet. Wenn er ihn bemerkt hätte.
»Was ist Polymer für ein Stoff? Wo findet man ihn?«
»Es sind ... Kohlenwasserstoff-Verbindungen? Organische Chemie?« Graham versuchte sich an die Buzzwörter zu erinnern, die ihn im Chemieunterricht durch die Tests gebracht hatten, ohne dass er genau wissen musste, was sie bedeuten. Viele waren es nicht und er nahm Zuflucht zu einer Floskel, die jede Diskussion beendete; vorausgesetzt, der Diskussionspartner hatte Angst davor, in Gesellschaft seine Unwissenheit zuzugeben: »Sie wissen schon.«
»Nein, wir wissen es nicht«, schnappte Miranda. »Deshalb fragen wir ja. Und Sie hätten sich eine bessere Geschichte ausdenken sollen, wenn Sie schon einen Mann aus der Zukunft spielen wollen.«
»Muss ich nicht! Dafür gibt es Experten. Genauso wie den für Ihr Aetherloch – wobei jedes Kind weiß, dass es diesen Aetherstoff nicht gibt. AU!« Graham zog seine Hand zurück, soweit seine Fesseln das zuließen. »Was sollte das?«
»Nichts«, erwiderte Miranda unschuldig und zog die kleine, blau brennende Lötlampe weg. »Aber wenn es Aether nicht gibt, dann kann man Aether auch nicht brennen und Ihrer Hand ist nichts passiert.«
»Das soll Aether sein? Sie können mir viel erzählen!«
»Sie mir auch. Geert, wir haben Besseres zu tun, als mit diesem Kerl zu schwatzen. Los, an die Arbeit.«
»Er könnte uns helfen.«
»Das bezweifle ich.«
»Ich könnte helfen«, sagte Graham. »Aber ich will nicht.«
»Gut. Dann bleiben Sie hier sitzen, bis wir fertig sind.« Damit war für Miranda das Thema erledigt und sie schenkte Graham keine Beachtung mehr. Geert schaute fragend zu Graham, dann aber spannte ihn seine Schwester so in die Arbeit ein, dass er keine Zeit mehr hatte, sich umzuschauen. Dafür beobachtete Graham fasziniert die Geschwister.
Es sah gruslig aus, wie sie dem Hausdiener Arnold zuerst die Haare und dann das Gesicht abnahmen. Es blieb nur noch ein Metallgestell übrig, das Graham an die Foltermasken aus dem Mittelalter erinnerte. Aber dieses Gestell war vollgestopft mit Mechanik: Zahnräder, Wellen, Getriebe, Federn, Gewichte, Gegengewichte und eine kleine, sich rasend schnell drehende Trommel, die seiner Vermutung nach der zentrale Datenspeicher sein musste. Mit einem langen, sehr dünnen Schraubenzieher legte Miranda einen kleinen Sperrhebel in der Mitte dieses Gebildes um und langsam kam die Trommel zum Halt. Sie bestand aus hell glänzendem Messing, dass mit kleinen Löchern und Einkerbungen übersät war. Geert untersuchte die Trommel mit einer Lupe.
»Es sieht aus, als wäre nichts beschädigt. Der wievielte Durchlauf war das?«
»Der vierzehnte.«
»Soweit scheint alles in Ordnung zu sein. Aber da, die Steuerungsmarkierungen, siehst du dort?« Miranda nickte. »Scheint, als ob sie ausschlagen.«
»Wir brauchen unbedingt ein härteres Material.« Widerwillig fasziniert hatte Graham sich das mit angeschaut.
»Wie wäre es mit Diamant? Es gibt nichts Härteres.« Miranda schnaubte verächtlich.
»Der einzige Diamant, der groß genug wäre, ist im Zepter der Königin. Sie wird ihn uns wohl kaum geben. Und fünf weitere für die anderen Mechanoiden.«
»Ich wollte nur helfen.«
»Wollten Sie doch eben nicht.«
»Wäre wohl auch besser so.«
»Genau.« Geert hatte in der Zwischenzeit die Trommel mit einem weichen Pinsel gereinigt und sie wieder an ihren Platz gesetzt. Dann zog er mit einem Spezialschlüssel die Feder wieder auf, die den Mechanismus mit Energie versorgte und legte den Sperrhebel wieder um. Sofort kam wieder so etwas wie Leben in den Kopf. Die Augen richteten sich gerade aus, die künstlichen Lider klappten auf und aus dem Inneren kam eine Reihe Klicklaute, auf die Geert lauschte. Graham sah, wie er mit den Fingern mitzählte.
»Alles in Ordnung«, sagte er schließlich. Dann setzten die Beiden wieder das Gesicht und die Haare an den Kopf, schraubten die Ohren an und setzten ihn wieder auf den steif dasitzenden Körper. Es dauerte wenige Sekunden, bis die Steuereinheit wieder die vollständige Kontrolle über ihn übernommen hatte. Dann stand D1 auf.
»Geh auf Ausgangsposition für Protokoll siebenundzwanzig B. Gehe dann in den Ruhemodus und warte auf weitere Instruktionen«, kommandierte Geert. D1 marschierte durch die Tür zum Flur, wahrscheinlich in das Zimmer, in dem ihm Graham zum ersten Mal begegnet war.
»K1 ist der Nächste«, wies Miranda an. Der Koch kam, nahm Platz und Graham sah widerwillig fasziniert zu, wie an ihm die gleiche Prozedur vollzogen wurde: Der Kopf wurde ihm abgenommen, die Gesichtsmaske und die Haare abmontiert und das mechanische Innere gereinigt. Graham konnte sehen, dass dieses Modell ungleich komplizierter aufgebaut war als der Hausdiener. Statt einer drehten sich dort drei Walzen in perfekter Synchronität. Graham pfiff durch die Zähne.
»Bemerkenswert«, murmelte er leise, aber Geert hatte es gehört. Miranda, die Graham wesentlich näher stand, wahrscheinlich auch, aber sie ignorierte es. Im Gegensatz zu ihrem Bruder.
»K1 ist unser Meisterstück. Seine Programmierung enthält die gesamte Zubereitung des Mahls. Von der Vorbereitung bis zur letzten Dekoration auf dem Teller steckt alles hier drin! Eintausendsiebenhundertdreiundfünfzig verschiedene Rezepte.« Geert wies auf die drei Walzen.
»Und es ist eine Heidenarbeit, das alles wieder hinzubekommen, wenn ein unfähiger Tölpel das Programm in einer unbeobachteten Umgebung ablaufen lässt« warf Miranda ein. »Also konzentrier dich, Geert!«
»Und du sei nicht so unhöflich zu unserem Gast. Ich bin sicher, er hat es nicht absichtlich getan.«
»Du meinst, er ist dumm geboren?«
»Miranda!« rief Geert. »Das geht zu weit!«
»Du bist viel zu naiv, Geert. Er kann immer noch ein Spion von Stokesham sein.«
»Wie oft soll ich es noch sagen? Ich kenne diesen Stokesham nicht!«
»Da hörst du es, Schwesterchen. Er kennt Stokesham nicht. Wie oft soll er das noch sagen?«
»So lange, bis ich ihm glaube.« Geert seufzte.
»Dann wird es in diesem Jahrhundert wohl nichts mehr.« Schweigsam wandte Geert sich wieder der Puppe zu. Seine Finger glitten mit einer Virtuosität durch den Mechanismus, die Graham vorher nur bei einem Weltklasse-Klavierspieler gesehen hatte. Wenn man nicht genau darauf achtete, konnte man glauben, dass Geert mit vier Händen arbeitete, genauso wie Graham dem Pianisten kaum abnehmen konnte, dass er sein Instrument nur mit zwei Händen spielte.
Aber Geert war ein Meister seines Fachs. Jeder Griff saß, eingespielt durch eine jahrelange Routine, winzige Schrauben passten in ihre Gewindelöcher, glitten hinein oder hinaus, kaum dass Geert sie mit seinem Schraubenzieher berührte. Federn wurden wieder aufgezogen, Zahnräder an neue Positionen gerückt, wo sie geräuschlos ineinander griffen und nur gelegentlich ein Klicken von sich gaben, wenn sie in der richtigen Stellung einschnappten. Über Geerts Fähigkeiten hatte Graham kaum auf dessen Schwester geachtet, bis er durch Zufall ihr beim Arbeiten zusah.
Gegenüber Miranda war Geert ein Grobmotoriker. Ihre Hände waren schmaler, ihre Finger feiner und beweglicher, sodass sie an Stellen arbeitete, die für Geert unzugänglich waren. Aber das tat sie mit einer Geschwindigkeit, die die ihres Bruders in den Schatten stellte; Graham war überzeugt, dass das Mädchen sechs Hände haben musste. Konnten sich die Geschwister mechanische Arme herstellen? Aber das war unmöglich! Wenn die Industrie in der Lage gewesen wäre, solche Prothesen herzustellen, dann hätte Graham davon gehört. Wahrscheinlich hätte er die Firma aufgekauft, die Preise der Prothesen verzehnfacht und die Krankenkassen geschröpft, bis auch der letzte Cent in seiner Tasche gelandet wäre. Und definitiv war so eine Technik vor hundert Jahren weit außerhalb des Möglichen gewesen. 1857? Schwachsinn! Vielleicht waren die Geschwister Autisten, die sich ihre eigene Welt erschaffen hatten? Es würde passen. Grahams Unterbewusstsein hatte sich unterdessen mit anderen Fragen beschäftigt und übernahm nun die Kontrolle seines Mundwerks, ohne die Zustimmung des Großhirns abzuwarten.
»Kann der Koch auch neue Rezepte entwickeln?« Von Miranda kam nur ein abfälliges Grunzen. Geert zögerte kurz, bevor er antwortete.
»Kreativität ist ein Problem. Also.« Er hob die Schultern und suchte mit den Augen etwas an der Zimmerdecke. Wahrscheinlich das richtige Wort. Autisten hatten Schwierigkeiten mit der Kommunikation, hatte Graham gehört. »wir wissen nicht, wie man die programmiert. Wenn wir das wüssten...«
»...dann würden wir es nicht verraten«, schnitt ihm Miranda das Wort ab. »Denn das wäre exakt die Frage, die ein Spion von Stokesham stellen würde. Wirklich Geert, du würdest einem Wildfremden unsere Geschäftsgeheimnisse verraten? Nicht mal ich hätte dich für so naiv gehalten!«
»Tut mir sehr leid«, entschuldigte sich Geert. »Meine Schwester ist noch sehr jung und gesellschaftlich unerfahren.«
»Ich bin siebzehn und ich weiß mehr über Menschen als du.«
»Es reicht, Miranda. Ich werde jetzt Mr. Rodderik von seinen Fesseln befreien. Und ich erwarte keine Widerrede. Dein Misstrauen geht wirklich zu weit!« Miranda warf ihm nur einen Du-Wirst-Schon-Sehen-Was-Du-Davon-Hast-Blick zu und arbeitete verbissen weiter, während sich Geert mit einer Schere an Grahams Stricken zu schaffen machte. Miranda hatte die Reparatur von K1 beendet, bevor er damit fertig war, und machte sich daran, die Verkleidung der Puppe wieder zu befestigen.
»Die Oberarmachse rechts scheint mir angebrochen zu sein«, ließ Graham beiläufig fallen.
»Ja, klar«, antwortete Miranda und ließ sich nicht aufhalten. Geert dagegen drehte sich um und sah auf den Arm der Kochpuppe. Aus Grahams Richtung spiegelte sich das flackernde Licht des Kaminfeuers auf dem hochglanzpolierten Metall der Achse und es war deutlich die Stelle zu sehen, an der das Metall den Belastungen des gebratenen Schweins nicht gewachsen gewesen war. Ein paar Inch weiter links oder rechts wurde das Licht anders reflektiert und das Metall schien makellos zu sein.
»Er hat recht, Miranda«, sagte Geert, der die Puppe ebenfalls aus Grahams Blickwinkel sah. Miranda zögerte, sah sich den Arm noch einmal an, strich mit ihren Fingern über die Oberfläche. Und bemerkte schließlich die Fehlerstelle.
»Verdammter Ox! Er hat mir geschworen, dass er nur beste Qualität verwendet hätte.«
»Du sollst nicht fluchen!«
»Und Ox sollte uns nur erste Qualität verkaufen. Bezahlt haben wir es ja.« Obwohl es beim Feuerschein schwer zu sagen war, hatte Graham den Eindruck, dass Geerts Gesicht die Farbe in Richtung rot wechselte. Miranda schien das auch aufzufallen. »Wir haben ihn doch bezahlt, oder?«
»Ähm. Sozusagen. Wir werden ihn bezahlen. Gleich nach der Präsentation. Mit dem Geld von dem Auftrag.«
»Wir arbeiten auf Pump?«
»Er hat uns Kredit gewährt.«
»Du weißt, was Vater von Krediten hielt.«
»Es war Kredit oder verhungern! Und ich finde es höchst unpassend, solche Dinge vor Fremden zu diskutieren!«
»Ah, jetzt ist er ein Fremder. Ok, machen wir weiter. Ich hole den Schmelzbrenner.« Miranda erschien einige Minuten später wieder mit einem kleinen Rollgestell, auf dem eine Gasflasche installiert und die über zwei Schläuche mit einer Brenndüse verbunden war. Über ihre Augen hatte sie eine Brille gezogen, die so dunkel war, dass sie sich wie eine Blinde durch das Zimmer tasten musste. Aber sie tat das so geschickt, das klar war, dass sie dieses Zimmer im Schlaf kannte.
»Schauen Sie nicht in die Flamme«, sagte Geert. »Das Licht könnte ihren Augen schaden.«
»Ich weiß. Ich sehe nicht zum ersten Mal jemanden was schweißen.« Geert runzelte die Stirn.
»Schweißen? Was ist das? Und den Schmelzbrenner haben wir erst vor ein paar Monaten erfunden. Ich glaube kaum, dass jemand außerhalb dieses Hauses überhaupt von seiner Existenz weiß.« Weitere Erklärungen schnitt Miranda dadurch ab, dass sie das Gas aufdrehte und die Schweißflamme entzündete. Im Gegensatz zu dem, was Graham erwartet hatte, war die Flamme klein, sehr konzentriert und leuchtete in einem grellen Neongrün. Sofort kniff Graham die Augen zu, aber als die Flamme auf das Metall traf, veränderte sich das Licht zu einem Violett, dass mühelos seine geschlossenen Augenlider durchdrang. Graham drehte den Kopf weg, bis die Geräusche verklangen und das Zischen des Gases aufhörte.
Er sah, wie Miranda sich auf die Lippen biss.
»Das war übel. Der ganze Arm hätte seine strukturelle Integrität verlieren können.«
»Was beweisen dürfte, dass unser Gast kein Spion ist. Sonst hätte er uns nicht darauf hingewiesen.« Graham seufzte.
»Es sei denn, ich wollte mir damit Ihr Vertrauen erschleichen.« Manchmal überraschte Grahams Mundwerk sein eigenes Gehirn.
»Genau!« bestätigte Miranda.
»Wenn er ein Spion wäre, würde er genau das nicht sagen.«
»Oh doch. Entschuldigen Sie, Geert, aber ich kenne genug Verschwörungstheoretiker, um zu wissen, dass man denen nicht mit Logik beikommen kann. Es gibt nichts auf der Welt, was Ihre Schwester überzeugen könnte, dass ich ein ganz harmloser, netter Tourist aus der Zukunft bin.«
»Mich kann man mit Logik überzeugen«, fauchte Miranda. »Das ist das Einzige, was mich überzeugt!«
»Ich wäre ihnen Beiden nur sehr verbunden, wenn Sie mich irgendwie in die richtige Richtung drehen, damit ich meinen Weg nach Hause finde.«
»Wir müssen das noch fertig machen. Danach bringen wir Sie zum Bibliothekar. Der kennt sich am besten mit solchen Aetheranomalien aus. Er wird wissen, wie Sie den Weg zurück finden.«
»Aber bis wir Sie dahin bringen«, sagte Miranda, »können Sie uns auf exakt eine Art helfen: Fassen Sie nichts an!«
Notiz 1 Wobei sich Graham sicher war, auf wessen Seite die Dienerschaft stehen würde. So gesehen, konnte er über den Mangel an Hilfe ganz froh sein.
Kapitel 4 - Der Bibliothekar
Selbst wenn Graham auf eine andere Art hätte helfen wollen: er glaubte kaum, dass er dazu in der Lage war. Die Geschwister arbeiteten mit einer Geschwindigkeit, der schon seine Augen kaum folgen konnten. Ihnen gegenüber kam sich Graham langsam und unbeholfen vor – und Miranda bestätigte ihm das bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
Konversationsversuche hatte Graham aufgegeben, nachdem seine Anfänge mit kaum mehr als einem Grunzen beantwortet wurden. Stattdessen konzentrierte er sich nach einer Weile ganz auf Miranda. Sie war die Frau, die er auf der Straße gesehen hatte, daran bestand kein Zweifel. Ebensowenig wie daran, dass Miranda keine Ahnung von dem Vorfall hatte, denn anders ließ sich ihre Ignoranz gegenüber dem, was Graham aus seiner Welt erzählt hatte, nicht erklären.
Was nichts daran änderte, dass Miranda Graham faszinierte. Im Normalfall wäre sie ihm nie aufgefallen, aber jetzt, vertieft in eine Arbeit, die sie liebte, glühte sie von innen. Sie war erfüllt von einer Lebensenergie, die Graham bei den Neun-bis-Fünf-Sklaven, die die Innenstadt von London besiedelten, schon lange nicht mehr gesehen hatte. Mit einem kleinen Hauch von Neid stellte er fest, dass er diese Begeisterung auch bei sich selbst schon lange nicht mehr gespürt hatte.
Miranda und Geert arbeiteten besessen an ihren Mechanoiden, aber die Zeit verging viel zu schnell. Der Nachmittag war schon fortgeschritten, als sie die letzte Magd – die, die Graham Magda getauft hatte – zusammenschraubten und in das Zimmer zu den anderen Mechanoiden schickten.
»Ich hoffe, Lord Hastings hat es geschafft, ein Mahl aufzutreiben«, seufzte Miranda. Geert grinste.
»Das wird er. Er wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dir einen Gefallen zu tun.« Miranda sah ihn stirnrunzelnd an.
»Warum sollte er das tun?«
»Ihr seid verlobt. Er tut alles für seine zukünftige Frau. Und du solltest ihn Alexander nennen.«
»Ach ja, das hatte ich vergessen. Es schickt sich trotzdem nicht.« Graham achtete sorgfältig darauf, dass sein Gesicht nichts von dem preisgab, was er über das gerade Gehörte dachte. Mag sein, dass vor hundertfünfzig Jahren Liebeshochzeiten die Ausnahme und die meisten Hochzeiten arrangiert waren, aber etwas mehr Begeisterung für den zukünftigen Ehepartner war schon angebracht. Er fragte sich, wie Miranda und Lord Hastings sich kennengelernt hatten und ob es impertinent war, dieses Thema anzusprechen, als ein lautes Klopfen seine Gedanken unterbrach.
Geert öffnete die Hintertür, durch die Lord Hastings den Raum betrat. Der strahlte übers ganze Gesicht.
»Ein Festmahl wie für eine Königin. Es wartet draußen in der Kutsche.«
»Es ist für eine Königin«, stellte Miranda trocken fest.
»Ich weiß.« Hastings Lächeln verlor etwas an Lebendigkeit. Vielleicht hatte er sich eine etwas enthusiastischere Art des Dankes vorgestellt. Dann wandte er sich an Geert. »Sind die Mechanoiden programmiert?«
»Wir sind gerade mit dem letzten fertig geworden.«
»Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ich habe die zweite Kutsche mit. Setzt sie dort rein und wir fahren zum Palast.« Dann kniff er den Mund zu einem schmalen Strich zusammen und dachte nach. »Es ist nur noch ein Platz frei. Einer muss hier bleiben.« Geert drehte sich zu Miranda. Die nickte.
»Geh nur. Mein junges Herz bricht zwar, aber es wird heilen.«
»Miranda, es tut mir...«
»Geh schon, Geert. Es sind deine Mechanoiden.«
»Ja, aber du...«
»Geh jetzt! Sonst kommst du zu spät und ich muss wieder ein halbes Jahr putzen und Süßholz raspeln.«
»Du könntest Mr. Rodderik zum Bibliothekar bringen.«
»Großartig. Mein gebrochenes Herz liegt auf dem Boden und du trampelst darauf rum.«
»Bitte, Schwesterchen.« Miranda verdrehte die Augen.
»In Ordnung. Aber geht jetzt endlich.« Geert rief nach den Mechanoiden, die auf sein Kommando in perfekter Marschordnung das Zimmer betraten. Nachdem Graham jeden einzelnen von ihnen bis aufs Grundgerüst auseinandergenommen gesehen hatte, musste er die Ähnlichkeit bewundern, die diese Schöpfungen mit echten Menschen hatten. Aus der Nähe konnten sie niemanden täuschen: Ihre Gesichter waren hervorragend gearbeitet, aber die Mimik blieb starr und bewegungslos. Ihre Augen fixierten zu lange den Punkt, auf den sie schauten, und verunsicherten jeden Gegenüber. Jemandem Befehle zu geben, der konstant auf einen Punkt zwei Inches hinter der eigenen Stirn starrte, erforderte ein gerütteltes Maß an Ignoranz. Die Bewegungen der Mechanoiden wirkten eine Spur zu kantig. So als hätte man Menschen aus der Realität genommen und um zwei Zentimeter nach links gerückt. Aber für einen Bediensteten im viktorianischen Zeitalter schien das normal zu sein. Und aus zehn Metern Entfernung war zwischen den Mechanoiden und ihren Gegenstücken aus Fleisch und Blut kaum noch ein Unterschied festzustellen.
Geert vornweg, die Mechanoiden in der Mitte und Lord Hastings als Nachhut verließ die Kompanie das Haus. Erst als die Tür hinter ihnen geschlossen und sie außer Hörweite waren, zischte Miranda:
»Merde!« Graham wusste instinktiv, dass sich die Frau seiner Anwesenheit nicht bewusst war.
»Ungehalten?« fragte er. Miranda zuckte zusammen.
»Nein, überhaupt nicht«, schnappte sie zurück.
»Mein Französisch ist nicht so gut. Was Sie gerade gesagt?«
»Viel Glück«, erwiderte Miranda ohne zu zögern.
»Ich sollte mir das merken, falls ich einem französischen Freund einmal viel Glück wünschen will.«
»Machen Sie, was Sie wollen.« Graham trat so nah er sich wagte an Miranda heran und beugte sich leicht vor.
»Es tut weh, wenn man die Anerkennung nicht bekommt, die man sich hart erarbeitet hat. Mein Rat ist: Bewahren Sie diese Wut tief in Ihrem Inneren auf, sie wird eine unglaubliche Kraftquelle werden. Und bei der nächsten Gelegenheit zahlen Sie es ihnen heim.«
»Wo haben Sie diesen Rat her?«
»Zehn Jahre Arbeit im Finanzdistrikt. Da heißt es fressen oder gefressen werden.«
»Geert ist eigentlich nicht so. Er ist ein brillanter Kopf, aber seine Finger sind zu dick.«
»Ist mir aufgefallen.« Miranda sah Graham erstaunt an.
»Wirklich?«
»Ja. Bei der Reparatur. Ich meine, Geert war gut, aber Sie waren um Klassen besser.« Widerwillig nistete sich ein Lächeln auf Mirandas Gesicht ein.
»Wenn es nach Geert ginge, dann wäre ich vor der Königin aufgetreten. Aber Lord Hastings glaubt, es wäre besser, wenn die Mechanoiden von zwei respektablen Männern vorgestellt würden.«
»Lord Hastings?«
»Mein Verlobter. Sie haben ihn eben noch gesehen.«
»Ja, ich weiß. Aber Lord Hastings? Das klingt nicht nach großer Liebe.«
»Was hat eine Ehe mit Liebe zu tun? Lord Hastings verfügt über ein respektables Vermögen und wir sind pleite.« Miranda zuckte mit den Schultern. »Eine Ehe ist die ideale Lösung. Außerdem benötigt er einen Erfinder für seine Fabriken und ich bin die Beste, die es in der Stadt gibt. Er hat mir sogar versprochen, dass ich dort offiziell arbeiten darf.«
»Das müssen ganz große Gefühle sein.« Miranda runzelte die Stirn.
»Ich wäre die erste Frau Londons, die in einer Firma als leitende Erfinderin angestellt wäre.«
»Hoffentlich ist es das, was Sie sich wirklich wünschen. Aber ich würde gern wieder zurück. Wie hieß dieser Typ, der mich zurückbringen kann?«
»Der Bibliothekar. Ich glaube kaum, dass er Sie zurückbringen kann. Er weiß nur so viel über Zeitanomalien, dass er möglicherweise erklären kann, warum Sie hier sind. Aber als Erstes müssen Sie vernünftige Sachen anziehen. Ich kann mich nicht so mit Ihnen blicken lassen, ohne meinen Ruf zu gefährden. Und damit den Ruf meines zukünftigen Ehemannes.«
»Und das wollen wir beide nicht.« Graham stellte schnell fest, dass ausgereifter Sarkasmus in dieser Zeit weder geschätzt, noch erkannt wurde.
»Natürlich nicht«, sagte Miranda. »Obwohl ich keine Ahnung habe, was Sie das angehen sollte. D1 hat ungefähr Ihre Größe. Seine Sachen sollten Ihnen passen.« Miranda stürmte, ohne auf Graham zu warten, in die Werkstatt. Es war die erste, die Graham gefunden hatte, nicht die mit dem Himmelbett, von der er annahm, dass es eigentlich Mirandas Schlafzimmer sein musste. Aus einem alten Holzschrank, der zur Aufbewahrung von Dingen diente, die man schnell aus dem Weg haben musste und dann für Jahre vergisst, nahm Miranda einen Stapel Kleidung: Hose, Hemd, Socken, eine Weste, eine Jacke und ein Paar Schuhe. Alles machte einen gebrauchten, aber noch guten Eindruck. Graham wies auf ein paar Flecken.
»Was ist das?«
»Öl. Wir hatten zu Beginn Schwierigkeiten mit der Abdichtung der hydraulischen Elemente.« Miranda sah Graham herausfordernd an. »Ich habe es gründlich gewaschen.«
»Die Flecken sind aber noch drin.«
»Weil ich Erfinderin bin und keine Waschfrau. Gibt es damit Probleme?«
»Nicht die geringsten«, murmelte Harold. Streit war das Letzte, was er wollte. Vor allem, wenn die Möglichkeit bestand, dass er verlor.
»Dann ziehen Sie sich um.« Graham war sich nicht sicher, ob die Sachen, die er am Leib trug, nicht besser aussahen als das, was er jetzt anziehen sollte, aber er fügte sich. Vor allem, da Gegenstände in Reichweite lagen, die sich als Hieb- und Stichwaffen eigneten.
»Würden Sie bitte rausgehen?«
»Und Sie in unserem Labor allein lassen? Ha!«
»Wie wirkt es sich wohl auf Ihren Ruf aus, wenn Sie sich allein in einem Haus mit einem nackten Mann aufhalten?« Miranda dachte nach, dann wies sie auf die Tür.
»Los! In die Abstellkammer. Dort können Sie sich umziehen.« Graham gehorchte und sah zehn Minuten später aus wie ein Komparse in einer klassischen Sherlock-Holmes-Verfilmung. Der Typ Komparse, der in einem Armenviertel auf der Straße herumlungert. Miranda hatte die ganze Zeit ungeduldig vor der Tür gestanden und mit dem Fuß auf den Holzboden getippt. Graham versuchte, die Stimmung etwas aufzuhellen, riss die Tür auf, trat in den Flur und rief:
»Achtung, schöner Mann betritt den Raum!« Miranda sah ihn an und fragte:
»Wo?«
»Jetzt warten Sie hier. Ich bin für einen Spaziergang durch die Stadt nicht angemessen gekleidet«, hatte Miranda anschließend gesagt. »Und lassen Sie sich nicht einfallen zu fliehen. Ich habe die Türen verschlossen und gesichert.« Mit diesen Worten hatte sie sich umgedreht und war in ihr Schlafzimmer gegangen. Das war vor gefühlten drei Stunden gewesen, auch wenn die Uhr über dem Kamin behauptete, es wären erst dreißig Minuten vergangen. Graham hörte Ächzen, Stöhnen, mechanisches Quietschen, dass Knallen und Knarren von Schranktüren, das Geräusch mehrerer Kubikmeter Stoff, die in die Ecke geworfen wurden. Er probierte die Türen, die wirklich verschlossen waren, machte sich auf die Suche nach etwas Essbarem – sein letztes Mahl war großartig und reichlich, aber bereits einige Stunden her – und etwas zu trinken. Ohne Erfolg. Der Versuch, nach draußen zu schauen, scheiterte daran, dass die Fensterläden noch geschlossen waren. So wie sie es wahrscheinlich die ganze Zeit waren, wenn Graham an Mirandas Paranoia bezüglich feindlicher Spione dachte. Er überlegte sich, mit Gewalt einen Weg in die Freiheit zu schaffen, als ihm eine Kiste ins Auge fiel. Sie stand auf dem obersten Regalbrett gegenüber dem Kamin. Es konnte ein Spiel des Feuerscheins sein, aber er glaubte, dass die Kiste sich bewegte.
Vorsichtig stieg Graham auf einen Stuhl, der hoch genug war, um mit ausgestreckten Fingern das Regal zu erreichen. Er nahm den Kasten und trug ihn zum Tisch. Kein Zweifel, da drin bewegte sich was. Den Deckel sicherte ein Überwurf und eine Öse, aber kein Schloss. Nur ein Holzkeil. Graham drückte den Keil zur Seite. Das Ding klemmte. Jemand hatte offensichtlich viel Kraft aufgewendet, um das Öffnen dieser Kiste zu verhindern – aber davon ließ sich Graham nicht aufhalten. Ohne nachzudenken griff Graham nach einem kleinen Hammer, der von Geerts und Mirandas Reparaturarbeiten noch da lag. Nach zwei gezielten Schlägen flog der Keil in die nächste Ecke. Dann klappte Graham den Überwurf nach oben und den Deckel auf. Und knallte ihn sofort wieder zu.
Nein, er hatte keine Angst vor Kakerlaken. Auch wenn Kakerlaken so ziemlich alles überleben konnten, was auf diesem Planeten an Unheil auftreten konnte – Menschen und Atomkriege eingeschlossen – waren sie doch nicht gefährlich. Einzeln gesehen waren es kleine, harmlose Tierchen, die einem entschlossenen Auftreten nichts entgegenzusetzen hatten; besonders, wenn man Sicherheitsschuhe trug.
Die Tiere, die Graham angesehen hatten, sahen aus wie Kakerlaken. Aber Graham war sich sicher, dass, würde er eine zertreten, hunderte Artgenossen kommen und Rache nehmen würden. Die Insekten hatten sich exakt synchron bewegt. Und kaum hatte Graham den Deckel der Kiste geöffnet, hatten sich alle Antennen sofort auf ihn ausgerichtet. Graham wusste, dass er gescannt wurde, um in die Kategorie Feind oder Futter eingeordnet zu werden und er wollte in keiner von beiden landen. Nicht in der Futterkategorie und nicht in der Feindkategorie – für den Fall, dass diese Kakerlaken bei Feinden nicht die Fluchtoption wählten.
In dem Moment wurde Graham klar, dass sich jemand etwas dabei gedacht haben könnte, als er die Kiste verkeilte. Der Keil! Wo war er hingeflogen? Graham sah sich suchend um. Das Holzstück lag neben dem Tisch, knapp außerhalb seiner Reichweite. Und etwas begann, von innen gegen den Deckel zu drücken. Für die kleinen Tiere, die Graham in der Box gesehen hatte, entwickelte dieses Etwas erstaunlich viel Kraft. Konnten sich Kakerlaken nicht einfach durch das Holz fressen? Oder konnten sie das nur, wenn sie Termiten waren? Den Keil konnte Graham erreichen. Kein Problem. Aber er brauchte mittlerweile beide Hände, um die Kiste zuzuhalten. Um den Keil zu bekommen, musste er eine Hand für einen Sekundenbruchteil von der Kiste nehmen. Und instinktiv spürte er, dass das gar nicht gut bei Miranda ankäme. Graham schätzte das Risiko ab. Das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass ein oder zwei Tiere entwischten. Wäre kein Weltuntergang und leicht mit einem schweren Schuh zu korrigieren. Es sei denn, man wartete zu lange und die Tiere pflanzten sich fort. Aber bis dahin wäre er längst wieder weg. Auf der anderen Seite: Die Kakerlaken konnten den Deckel nur öffnen, wenn sie einen Turm bildeten und dazu benötigten sie zwei Dinge: die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, und Zeit. Das erste hatten Kakerlaken bestimmt nicht und ein kräftiges Rütteln sollte die Tiere so benommen machen, dass die sich erstmal wieder sammeln mussten. Graham gab der Kiste einen kräftigen Stoß, der ihre Insassen ordentlich aus dem Gleichgewicht bringen sollte, tauchte unter den Tisch und schnappte sich den Keil. Etwas über ihm klappte. Als er auftauchte, schob er den Keil sofort in die Öse und stellte die Kiste wieder auf das obere Brett. Er stand gerade wieder beim Tisch, als die Tür aufging und Miranda den Raum betrat.
Graham hatte kaum Zeit, die prachtvolle Garderobe zu bewundern, die sie trug. Ein blaues Satinkleid, geschnürt und gerafft und gerüscht wo es nur ging, alles bedeckend aber dabei eine Figur verratend, die Graham zu einem bewundernden Pfiff veranlasst hätte – hätte er da nicht Mirandas Gesicht gesehen. Sie trug einen kleinen Sonnenschirm so, wie andere einen Baseballschläger.
»Haben Sie etwas angefasst?« Graham zögerte. Sie sprach im Ton eines Staatsanwalts, der einen überführten Serienmörder fragte: Bekennen Sie sich schuldig? Sie hatte etwas erwähnt, von wegen nichts anfassen oder so, da war sich Graham sicher. Aber nichts über eventuelle Strafen. Was die Konsequenzen aber nicht abschwächen würde. Graham tat, was er tun musste. Er nahm all seinen Mut zusammen, richtete sich gerade auf, atmete tief ein und sagte:
»Nein.« Miranda sah ihn herausfordernd an. Dann zog sie ein kleines Gerät aus einer Tasche in den Tiefen ihres Gewandes und drückte einen Knopf. Sofort kamen aus den verschiedensten Ecken des Zimmers die Kakerlaken hervorgekrochen, krabbelten die Tischbeine empor und sammelten sich in der Mitte der Tischplatte. In Formation. Graham seufzte, nahm die Kiste vom Regal und öffnete sie. Die Tiere krabbelten hinein, dann verschloss er sie wieder, schob den Keil in die Öse und stellte die Kiste zurück. Miranda hatte kein Wort gesagt.
Kaum hatte Graham die Kiste zurückgestellt, hatte sie sich umgedreht und war zur Tür gegangen. Nicht die Tür, die zur Hintergasse führte, sondern die Tür nach vorn heraus, zur Hauptstraße. Und falls Graham bisher noch nicht ganz glauben konnte, dass er wirklich in der Vergangenheit gelandet war, wurden jetzt die letzten Zweifel beseitigt.
Schwerer Nebel hing über der Stadt. Kein Nebel, korrigierte sich Graham, Smog. Aber das war auch nicht die richtige Bezeichnung. Es war Dampf. Wasserdampf. Ausgestoßen aus unzähligen Schornsteinen, Dampfpfeifen, Ventilen, undichten Rohren, Fahrzeugen, die wirklich aussahen wie Kutschen ohne Pferde, Fahrzeugen, die aussahen wie Oldtimer, Fahrzeuge, die sich wahrscheinlich fortbewegen konnten, auch wenn Graham keine Vorstellung davon hatte, wie sie das taten. Über allem lag ein warmer, brauner Glanz.
Die Vergangenheit war nicht grau, sie war sephia.
Als sie die Tür öffneten, war es früher Abend. Ein paar Sonnenstrahlen schafften es noch durch den Dampfschleier, aber erleuchtet wurde die Straße durch blaue, stotternd brennende, Funken spuckende Gaslampen. Graham blieb mit offenem Mund stehen. Zum ersten Mal in den letzten vierundzwanzig Stunden brach sich ein Gedanke mit voller Wucht den Weg in sein Bewusstsein: Du bist wirklich in der Vergangenheit.
Mist!
Selbst Miranda musste das aufgefallen sein. Sie sah Graham merkwürdig an und ließ ihm einige Minuten mit offenem Mund auf die Szenerie starren. Nach einer Weile drückte sie mit zwei Fingern Grahams Kinnlade nach oben.
»Sie glauben das wirklich, oder? Dass Sie aus der Zukunft kommen?«
»Ja.« sagte Graham. »Und dass ich in der Vergangenheit gelandet bin.« Dann fügte er hinzu: »Aber in welcher?« Miranda zog eine Augenbraue hoch. Graham ignorierte sie und trat hinaus auf die Straße.
Die Gasse, in der das Haus der van Storms lag, war recht schmal und das hatte Graham davor geschützt, zu viel auf einmal zu sehen. Was sich im Nachhinein als lebensrettend erwies; es schützte sein Hirn vor Überlastung. Graham wies auf die Lampe.
»Was stimmt mit dem Gas nicht? Ich glaube nicht, dass es so brennen sollte.« Miranda zuckte mit den Schultern.
»Das ist kein Gas, das ist Aether. Die instabile Energiestruktur macht es nahezu unmöglich, dass es gleichmäßig brennt. Das ist aber nicht gefährlich.«
»Aether ist ein Mythos. Jedes Kind weiß, dass es das nicht gibt.« Miranda seufzte.
»Das nächste Mal sollte ich den Brenner etwas länger an Ihre Finger halten.« Graham zog seine Hand schützend an seinen Körper.
»Das würde nur beweisen, dass es heiß ist, nicht dass da Aether verbrennt.«
»Sie verfügen über eine bemerkenswerte Beobachtungs- und Argumentationsgabe. Würden Sie sich bitte auf das erstere konzentrieren, bis wir an unserem Ziel sind?« Graham brauchte eine Weile, bis er begriff, dass er gerade höflich aufgefordert wurde, die Klappe zu halten. Er zuckte mit den Schultern.
»Ok, kein Problem. Gehen wir.« Er schob die Hände in die Taschen und lief los. Nach zwei Schritten spürte er, dass ihm ein spitzer Stock in die Rippen gerammt wurde. Es war Mirandas Sonnenschirm.
»Diener laufen nicht vor ihren Herrschaften«, stellte Miranda kühl fest.
»Ich bin nicht Ihr Diener.«
»Sie sind angezogen wie mein Diener. Und ich möchte keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Ich möchte meine Verlobung nicht gefährden.«
»Mit dem formidablen Lord Hastings.«
»Ihre Meinung ist nicht von Belang. Zwei Schritte hinter mir. Und wagen Sie es nicht, mich unaufgefordert anzusprechen.«
Das war eine Anweisung, an die sich Graham in den folgenden Minuten hielt. Nicht weil er wollte, sondern weil das, was er sah, ihm den Atem verschlug. Das war London. Das alte London. Das London ohne Bürotürme, Hochhäuser, Hipsterläden und Hipster. Das war das London, wie es vor hundert, hundertfünfzig Jahren ausgesehen hatte. Aber dieses alte London war neu. Die meisten Häuser konnten nicht länger als zwanzig Jahre stehen, die Sandsteinfassaden hatten noch keine Patina aus schwarzem Ruß. Das Kopfsteinpflaster auf den Straßen war frisch verlegt, nicht rundgeschliffen von jahrzehntelangem Verkehr, die Ränder noch eben, auch dort, wo sich der Untergrund später absenken würde.
Auf den Straßen waren Kutschen unterwegs. Die meisten wurden von Pferden gezogen, aber bei manchen hatten die Fahrer vor die Wagen eine Art Dampfmaschine gespannt, die genau so gesteuert wurde wie ein Pferd. Bei anderen Modellen war der Motor in das Chassis eingebaut, sodass sie aussahen wie richtige Autos. Oder besser: wie Autos aus einem Museum.
Über all diesem dröhnte der Lärm einer geschäftigen Stadt. Graham hörte aus den offenen Fenstern und Türen der Häuser Hämmern, Klopfen, Klicken, Rattern. London erinnerte ihn an einen riesigen Ameisenhaufen, an dem immer noch gebaut wurde, und der von Minute zu Minute sein Angesicht veränderte. Graham sah ein riesiges Bürohaus, doch durch die offenen Fenster sah er, dass in den Räumen kein Mensch arbeitete. Stattdessen spuckten dort gewaltige Schreibmaschinen-Batterien Seiten um Seiten bedrucktes Papier aus, während auf dem Gerüst davor Bauarbeiter mit Trägern, Bohlen, Ziegeln und Mörteleimern in der Hand auf und abstiegen und damit beschäftigt waren, die oberen Stockwerke zu vollenden und weitere hinzuzufügen.
»Ich brauche eine Pause«, murmelte er. Miranda, die vorausgegangen war, ohne sich weiter umzusehen, drehte sich zu Graham. Statt einer Abfuhr, die er fast schon erwartet hatte, sah er, wie ihr Gesicht blass wurde.
»Was ist los mit Ihnen?« Mit einem Schritt war sie bei Graham und legte einen stützenden Arm um seine Hüfte. »Brauchen Sie einen Arzt?« Graham schüttelte den Kopf.
»Nur eine Bank. Ich muss mich setzen.« Er wedelte mit der Hand vage über die gesamte Szenerie. »Das hier ist etwas viel auf einmal.« Miranda sah sich um. Zwischen den Häusern war ein kleiner Park, ein oder zwei Bäume und ein paar Büsche. Dort stand eine kleine Marmor-Bank in einer Nische, zu der sie Graham führte.
»Sicher, dass Sie keinen Arzt brauchen? Ihr Gesicht ist ganz grün. Ehrlich, man hört das immer, aber so echt Grün sehe ich das zum ersten Mal.« Graham lächelte schwach.
»Schön, dass ich Sie überraschen konnte.« Der Stein, gegen den er seine Handgelenke presste, kühlte ihn etwas ab. Langsam verschwand die Übelkeit und der Nebel in seinem Kopf lichtete sich.
»Sie sehen bemitleidenswert aus.« Trotz seiner Übelkeit konnte Graham die echte Sorge in Mirandas Stimme hören. Er musste wirklich erbärmlich aussehen. Nicht die ideale Erscheinung, wenn man ein Mädchen beeindrucken wollte. »Rutschen Sie ein Stück zur Seite.« Graham machte etwas Platz, sodass Miranda sich setzen konnte. Es blieb ein paar Augenblicke still, bevor Miranda etwas sagte.
»Sie glauben das wirklich.« Es war eine Feststellung. Und Miranda klang wirklich überrascht.
»Was?«
»Das Sie aus der Zukunft kommen und so.«
»Ist für mich nicht leicht. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das hier die Vergangenheit oder die Nebenwirkung einer Tablette ist. Aber das alles ... fühlt sich so real an!«
»Das ist real!«
»Wie kommen Sie darauf?« Miranda überlegte.
»Weil es schon immer so war.«
»Und wenn ...«, begann Graham, dann winkte er ab. »Das würde auch nichts helfen. Aber warum bringen Sie mich zum Bibliothekar? Wenn der sich mit sowas auskennt, dann muss das doch schon früher passiert sein?« Miranda schüttelte den Kopf.
»Es ist theoretisch möglich. Aber praktisch ist es noch nie vorgekommen.«
»Und Sie selbst? Sie müssen mich doch gesehen haben?« Miranda runzelte die Stirn.
»Ich habe Sie erst heute gesehen. In unserem Haus.«
»Nein, vor ein paar Tagen. Sie standen mitten auf der Straße und ich hab Sie gesehen und Sie haben mich gesehen ...« Graham konnte sehen, dass Miranda sich erinnerte. Und dass es keine angenehme Erinnerung war.
»Das Gesicht im Fenster!«
»Da war kein Fenster.«
»Doch. Ich war in meinem Schlafzimmer und habe...« Sie stockte.
»...den Spiegel geputzt und dann die Werkbank in ihrem Schrank geöffnet?« ergänzte Graham. Miranda wurde blass.
»Sie sind doch ein Spion!«
»Sie haben mich gesehen!«
»Ja«, fauchte Miranda. »Wie Sie von draußen durch die Scheibe geglotzt haben! Ich wusste, ich hatte Ihr Gesicht schonmal gesehen!« Graham wusste, dass Miranda hier schnell falsche Schlüsse ziehen konnte. Durch das Fenster ins Schlafzimmer einer fremden Frau zu schauen, war schon in seiner Zeit niveaulos – falls das hier wirklich die Vergangenheit war, dann war es ein Verbrechen. Und ein kurzer Ruf nach einem Constable konnte Graham mit Fragen konfrontieren, auf die er der Staatsmacht so schnell keine befriedigende Antwort geben konnte. Was für die Staatsmacht kein Problem darstellte; sie würde ihm gern zehn bis fünfzehn Jahre Zeit zum ungestörten Nachdenken verschaffen. Graham musste schnell schalten.
»Als Sie mich im Fenster gesehen haben, was war im Hintergrund?«
»Harringtons Square.«
»Nicht was da sonst ist! Was haben Sie gesehen?« Miranda zögerte kurz. Jetzt würde sich entscheiden, ob sie ihre Version glaubte. Oder ob es da einen winzigen Zweifel gab und sie Grahams Geschichte in Betracht ziehen würde. »Geben Sie mir diese Chance! Was haben Sie gesehen?«
»Es war sehr schnell.« Graham schloss die Augen. Was war hinter ihm gewesen? Er stand an der Bushaltestelle. Hinter ihm war eine Kreuzung. Hinter ihm war Straßenverkehr.
»Autos. Sie haben Autos gesehen.«
»Es war groß und rot.«
»Ein Doppeldeckerbus?«
»Was ist ein Doppeldeckerbus?« Graham überlegte fieberhaft, wie er ihr einen Doppeldeckerbus beschreiben sollte. Wie alles, dem man täglich begegnet, nahm er die Busse nicht mehr bewusst wahr. Und hatte Schwierigkeiten, einen zu beschreiben. Wenn er wenigstens etwas zum Zeichnen hätte! Beim Umziehen hatte er alles aus seiner Jeans genommen und in die Westentasche gesteckt. Einen Kugelschreiber hatte er und ein alter Kassenzettel war bestimmt auch dabei. Stattdessen stießen seine Finger gegen einen glatten, kastenförmigen Gegenstand: sein Smartphone. Er zog es aus der Tasche.
»Vielleicht habe ich ein Foto«, erklärte er dabei. »Das hier ist ein Smartphone. Damit kann man Fotos machen. Ich glaube zu Ihrer Zeit hieß das noch Daguerreoptypien oder so. Ich würde ja Wikipedia aufmachen, aber mit Internet ist es hier nicht so. Eigentlich telefoniert man damit. Wissen Sie, was telefonieren ist?« Graham hatte nicht auf Mirandas Gesicht geachtet. Das war ein Fehler. Sonst hätte er gesehen, dass beim Anblick dieses Geräts ihre Augen groß wurden und zur Abwechslung ihr das Kinn nach unten klappte. Sie nahm ihm das Telefon aus der Hand und betrachtete das Gerät staunend. »Vorsicht, das ist ein sensibles Gerät...« begann Graham.
»Sensible Geräte sind meine Spezialität«, sagte Miranda. »Und wozu braucht man sowas?«
»Damit bin ich immer erreichbar.« Miranda runzelte die Stirn.
»Ein Peilsender also?«
»Überhaupt nicht.« Graham schnappte sich das Telefon. Zumindest wollte er das.
»Ich habe Pläne für Minipeilsender gesehen, aber ich wusste nicht, dass jemand es schon gebaut hat. Und solange Sie dieses Ding haben, kann man Sie immer aufspüren? Warum sollte ein vernünftiger Mensch das wollen?« Miranda drehte und wendete das Telefon hin und her. Ohne dass Graham erkennen konnte, wie sie das gemacht hatte, lag plötzlich die Abdeckung neben ihr auf der Bank – für den Trick, sein Telefon zu öffnen, benötigte Graham selbst mehrere Minuten – und sie hielt den Akku in den Händen. »Diese Aetherzelle ist winzig! Die kleinsten, die ich gesehen habe, sind etwas größer als Tornister! Wie kann das sein?« Graham klaubte Telefon und Akku aus ihren Händen und setzte es wieder zusammen.
»Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber das ist keine Aetherzelle. Und es wäre mir ganz lieb, wenn Sie mein Telefon in einem Stück lassen würden. Ich weiß zwar nicht, wie und wann ich zurück komme, aber ich hoffe, dass ich dann wieder damit arbeiten kann.« Miranda beschäftigte sich in der Zwischenzeit mit naheliegenderen Problemen.
»Das muss eine Aetherzelle sein. Wie sonst sollte dieses Gerät Energie bekommen?«
»Über den Akku. Der liefert Strom, der schaltet die Transistoren.« Graham hörte mit seinen Erklärungen an dieser Stelle auf. Nicht, weil er Miranda nicht überlasten wollte, sondern weil auch das zugehörige Wissen an dieser Stelle endete.
»Strom? Was für Strom? Eine kleine Themse? Das ist Unsinn!«
»Ich meine auch keinen Fluss. Ich meine elektrischen Strom.« Miranda lachte kurz.
»Ich habe von dieser Elektrizität gehört. Das ist eine Randtechnologie, die sich nie durchsetzen wird. Viel zu gefährlich.«
»Gefährlicher als ein explodierender Dampfkessel?«
»Guter Punkt. Darf ich das Gerät haben?«
»Nein.«
»Ich möchte es untersuchen.«
»Nein.« Als Graham auf seine Hände sah, war das Smartphone nicht mehr da. Dafür hatte Miranda den Knopf zum Einschalten gefunden. Für vier oder fünf Sekunden sah er den Startbildschirm, dann wurde das Display dunkel. Dafür leuchtete eine kleine Lampe an einem Gerät auf, das Miranda in der anderen Hand hielt und jetzt genauso schnell wieder verschwand, wie vorher das Telefon aus Grahams Händen.
»Was war das?« fragte Miranda. »Ist es kaputt?« Graham griff nach dem Gerät und sah nach.
»Na toll. Der Akku ist leer. Wenn ich nach Hause zurück komme, kann ich mir nicht mal ein Taxi rufen. Ich hoffe, ich lande in einer zivilisierten Gegend und nicht in Wales. Oder Schottland.«
»Kann man das reparieren?« Graham gewann immer mehr den Eindruck, dass Miranda ihm nicht zuhörte. Er verlor den Attraktivitätswettbewerb gegen ein Telefon. Es konnte nur noch besser werden.
»Wie weit ist es noch zur Bibliothek?« fragte er.
»Wir sind fast da. Die National Library ist dort vorn.« Graham, dem es einfach dadurch, dass er sich einredete, nur in einem Traum zu sein, schon etwas besser ging, stand auf und sah in die Richtung, in die Miranda wies. Das riesige Gebäude strahlte golden im Licht der untergehenden Sonne. Die Kuppel war riesig und ruhte auf Säulen, die einem Tempel gleichkamen. Ein Tempel des Wissens. Offensichtlich mit dem Eingang auf der anderen Seite.
»Sieht aus, als haben wir noch einen langen Weg vor uns.«
»Nein. Wir nehmen nicht den Vordereingang. Und wir, ähem, warten, bis wir nicht mehr so leicht zu sehen sind.« Graham sah erstaunt zu Miranda. In diesem Licht war nicht zu erkennen, ob die Röte vom Sonnenuntergang oder von ihrem Gesicht kam.
»Wir schleichen uns im Dunkeln rein?«
»Tun wir nicht. Wir warten, bis das Aufsichtspersonal gegangen ist, dann klopfen wir am Hintereingang.«
»Ist es verboten, die Bibliothek zu benutzen?«
»Ist es nicht.« Graham wartete auf eine Erklärung, aber es kam keine.
»Sondern?«
»Es ist offensichtlich verboten, Bücher zu korrigieren. Und solche, in denen reiner Unsinn steht, zu vernichten. Bringt einem lebenslanges Besuchsverbot ein.« Graham pfiff durch die Zähne.
»Klingt nach richtiger Verbrecherin.«
»Die Welt von Dummheit zu befreien, ist kein Verbrechen!« Graham hob die Hände.
»Keine Einwände.« Graham blieb stehen und beobachtete, wie die Sonne langsam über der Stadt unterging. Bald würde es dunkel werden und spätestens dann würden die Bibliothekare nach Hause zu ihren Familien gehen. Graham bemerkte, wie rechts von ihm ein Licht aufflammte. Die Laternen hatten den ganzen Tag gebrannt, aber jetzt wurden sie voll aufgedreht. Was Graham sah, war eindeutig viktorianisches England. Die Mode passte, die Fahrzeuge passten1, die Menschen passten – es war unmöglich, dass das hier ein Streich war. Fred war viel zuzutrauen und er hatte manchmal seltsame Sachen organisiert, aber nie etwas derart Ausgefallenes. Nur was sollte es sonst sein? Zeitreisen? Aether? Das ganze klang nach Science Fiction, nicht nach etwas, was wirklich passieren könnte. Es klang nach einem Traum, nach Halluzinationen, nach ... Nebenwirkungen einer Tablette. Verdammt!
Details
- Seiten
- ISBN (ePUB)
- 9783739470658
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2019 (Oktober)
- Schlagworte
- Adventure Zeitreisen Abenteuer Doctor Who Steampunk viktorianisches England Time Travel Humor Roman