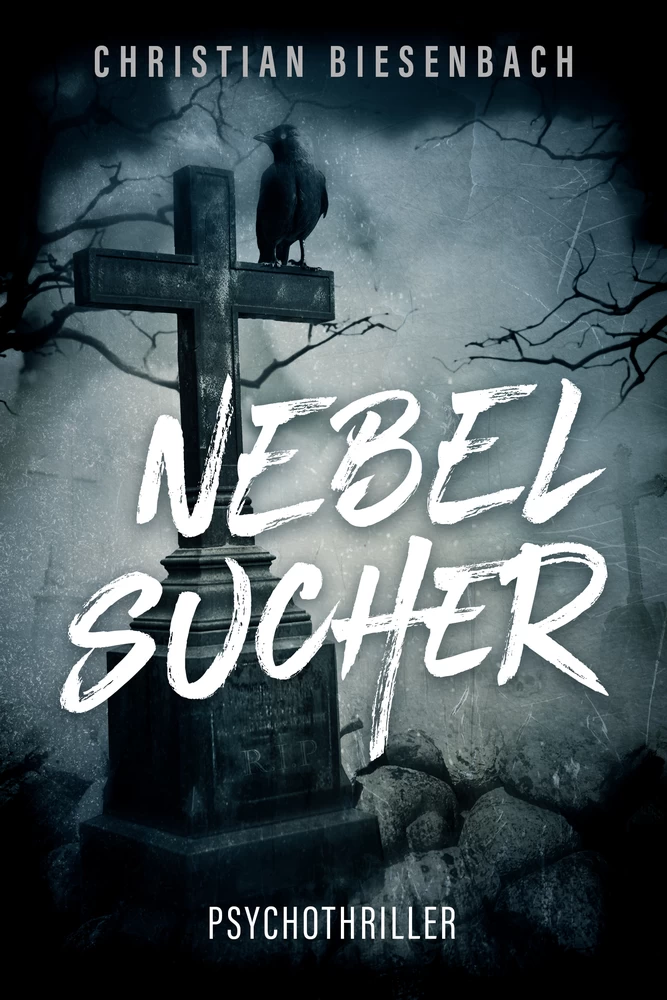Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Tagebuch
Letzter Eintrag
Ich bleibe keine Sekunde länger hier. Das kann nicht so bleiben. Bin ich wahnsinnig? Ich muss raus hier. Raus! Habe ich nicht alles versucht? Ich habe dieses Schicksal nicht verdient.
Etwas in meinem Inneren sagt: „Das kann nicht das Ende sein.“ Ich will nicht, dass es das Ende ist. Deshalb kehre ich nicht zurück. Ich werde einen Weg finden. Fort von hier. Einfach weg. Alles ist ein Albtraum. Das ist nicht der Tod. Die Frau im Nebel hat es mir erzählt ... Die Frau. Sie ist die einzige, der ich trauen kann. Die anderen, die Schatten und Monster, die Schemen in der Dunkelheit, die immer näher gekrochen kommen, die haben nur ein Ziel. Sie kommen jede Nacht näher heran. Wenn man genau aufpasst, kann man sie zähnefletschend und mit den Kiefern mahlend in der Dunkelheit hören, knurrend und geifernd. Ich bin längst sicher: Bald werden sie da sein, um mich zu fressen. Sie kommen, um mich zu verschlingen! Jeden Hinweis auf mich und mein Dasein vom Antlitz dieser menschenleeren Erde tilgen, das ist der einfache Plan.
Aber so einfach werde ich es ihnen nicht machen! Ich werde nicht bleiben, um auf das böse Ende zu warten...
Ich … ich werde es finden …
I
Begrüßung
Hallo. Mein Name ist Robert Bauer. Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Sie säßen auf einem Stuhl in einem ansonsten leeren Raum. Die Wände sind karg und weiß - oder grau, ganz wie Sie wollen. Es gibt nichts. Nichts, das ihr Interesse wecken könnte. Und so sitzen Sie dort und beschäftigen Sie sich mit einer einzigen Frage.
Wie sieht meine persönliche Hölle aus?
Wie wäre ihre Antwort? Was kommt Ihnen beim Grübeln über das ewigwährende Fegefeuer in den Sinn? Oder wissen Sie es vielleicht sogar?
Hätten Sie mich vor einiger Zeit danach gefragt, ich hätte mir mit dem Zeigefinger an den Kopf getippt und Sie für unzurechnungsfähig erklärt. Ganz einfach, weil ich es mir kaum hätte vorstellen können. Und wenn es Ihnen ähnlich geht, ist das gar nicht schlimm. Auch ich habe mir diese Frage zuvor nie gestellt. Weshalb auch? Wenn man es rational betrachtet, ist es eine dumme Frage. Eine Frage, die impliziert, dass man an Gott, den Teufel, Himmel und Hölle und den ganzen übernatürlichen Quatsch mit dem Leben nach dem Tod glaubt. Als überzeugter Ungläubiger habe ich in meinem Leben nie eine Sekunde damit verschwendet. Für mich war immer klar: Wenn man stirbt, ist es vorbei. Das war meine Überzeugung. Es ist ein ewiges Mantra, das immer wieder klar macht, dass ein Leben nach dem Leben rein logisch ausgeschlossen ist. Ich finde, man kann gut damit leben. Man kann diese schwerwiegende Frage sodann zu den Akten heften und sich einfach auf anderes konzentrieren. Und wenn es dann an der Zeit ist, den Löffel abzugeben, dann tut man es halt, um für immer vom Antlitz der Welt zu verschwinden. Ein Name auf einem Grabstein und ein paar Erinnerungen werden bleiben, ein wenig die Zeit überdauern und das war’s.
Wenn ich in dieser Sekunde daran denke, wünschte ich, ich würde Ihnen nachfolgend nicht erzählen, was mich davon abgebracht hat, diese herrlich einfache Denke beizubehalten. Denn ich mag sie, weil sie keinen Spielraum für Fantastereien und dergleichen lässt. Leider ist sie schlichtweg falsch. Das Ende ist nicht das Ende. Es ist nur das Vorspiel für Schlimmeres. Schlimmer, als sie es sich jemals ausmalen könnten…
»Der Mann ist verrückt«, höre ich schon einige rufen und auch das mag in gewisser Weise stimmen. Nach allem, was mir widerfahren ist, bin ich nicht sicher, ob in meinem Oberstübchen tatsächlich noch jede Tasse richtig im Schrank steht. Darum jedoch geht es nicht … Es geht um … Es … Ich merke, ich schweife ab. Also zurück zum eigentlichen Thema.
Ich bat Sie gerade eben darum, sich vorzustellen, wie Ihre eigene Hölle aussieht. Haben Sie mittlerweile ein Bild davon? Ja? Gut. Und wenn nicht, ist das nicht schlimm. Denn ich werde Ihnen jetzt erzählen, wie meine persönliche Hölle aussieht. Nicht etwa, weil ich mir das so vorstelle, sondern, weil ich weiß, dass sie so ist, wie ich sie schildern werde. Woher ich das weiß? Woher ich … Woher?! Verzeihen Sie mir, dass ich lachen muss. Bitter und mit zusammengepressten Lippen, aber doch lache ich. Hören Sie gut hin. »Hahaha!«
Die Antwort auf diese Frage ist so simpel, dass ich sie Ihnen entgegenspucken möchte.
»Ich war dort!«, lautet sie. Ich war tot … und vielleicht bin ich das teilweise noch immer. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Weshalb ich hoffe, dass die folgende Erzählung auch mir dabei helfen wird, festzustellen, ob ich vollends den Verstand verloren habe. Wollen Sie also so freundlich sein, mich zu begleiten? Ja? Ich würde mich freuen, wenn wir es gemeinsam herausfinden.
Robert Bauer
II
Ein Leben vor dem Tod
»Vergiss nicht, Sandra nach der Arbeit an der Schule abzuholen. Sie hat heute Nachmittagsunterricht«, warf sie ihm zwischen Tür und Angel an den Kopf, ehe sie schon verschwunden war, um in ihren Mantel zu schlüpfen. Das bedeutete stets, dass sie in spätestens zwei Minuten das Haus würde verlassen haben.
»Aber ich wollte heute mit dem Motorrad zur Arbeit«, antwortete Robert, während er sich den Rest des Kaffees in die Tasse goss und sich vom Küchentisch erhob. Obwohl ihm nach rund siebzehn Ehejahren klar war, dass es vollkommen zwecklos war, etwas gegen die „Anweisungen“ der Hausherrin, seiner geliebten Frau Theresa, zu sagen, war es wohl ein törichter Instinkt, es doch immer wieder zu tun. Meistens bereute er es gleich, denn die zwangläufig folgenden Diskussionen führte seine bessere Hälfte prinzipiell mit unfairen Mitteln. Vielleicht war es Roberts Glück an diesem Morgen, einem sonnigen Montag im April, dass sie spät dran war und keine Zeit für einen Streit erübrigen konnte. Daher fiel ihre Reaktion knapp aus. In ihren schwarzen Mantel gehüllt und die schwarzen Business-Heels an den Füßen schob sie sich in die Küche, machte ein schmollendes Gesicht, was entzückend von ihren blonden Haaren eingerahmt wurde, und sagte in einer gehetzten, imitierten Kinderstimme: »Oooh. Kann der arme kleine Robby heute halt nicht mit seinem Dreirädchen fahren. Oooh. Dann muss er das wohl an einem anderen Tag machen.« Danach verschwand das Schmollen und wurde durch einen ernsten Blick ersetzt, dem eine klare Ansage folgte. »Sandra hat nach der Schule einen Zahnarzttermin. Ich fahre heute Nachmittag mit Danny in diese Theateraufführung, die von der Grundschule für die Zweitklässler organisiert wurde. Also musst du sie abholen, sonst kommt sie nicht rechtzeitig dorthin. Und du weißt ja, wie der Doktor ist. Und du weißt auch, dass ich es nicht erlaube, dass du sie auf dieser teuflischen Höllenmaschine kutschierst.«
Ehe er etwas darauf erwidern oder protestieren konnte, kam sie herangerauscht, drückte ihm einen flüchtigen Schmatzer auf die Lippen. »Und vergiss nicht, du hast heute diesen Termin, wegen dieser Sache mit der Arbeit. Was war es noch? Irgend so ein Medikamentendingens. Egal, du weißt, was ich meine.« Sie flötete ein: »Tschüss. Ich liebe dich« hinterher und war aus der Haustür, ehe er seine Lippen auseinanderbekommen hatte, um irgendwas zu sagen.
»Aber es ist doch der erste richtige Frühlingstag. Das erste Mal, dass ich die Maschine wieder fahren kann, ohne mir Frostbeulen zu holen. Und dieses Medikamentendingens ist eine ernste Sache. In den letzten Wochen wurde wohl einiges an Mist mit den Medikamenten im Heim getrieben. Größere Mengen Pentobarbitol sind scheinbar verschwunden«, sagte Robert kurz darauf zu niemandem, denn er war alleine in der Küche zurückgeblieben. Zunächst jedenfalls. Denn ein paar Sekunden später, Theresas BMW X1 rollte bereits mit ihr am Steuer und Sohn Daniel an Bord rückwärts die Kiesauffahrt hinunter, kam Sandra hereingeeilt. Sie umrundete den Tisch mit der Anmut einer Klassetänzerin im Alter von gerade sechzehn Jahren, öffnete den Kühlschrank und fischte einen Joghurt heraus. In ihren Gesichtszügen erkannte man deutlich Theresas Schönheit. Eigentlich hatte sie beinahe alle guten Gene ihrer Mutter, nur die braunen Haare sprachen eindeutig für Robert. Und die Tatsache, dass sie nie um einen flotten Spruch verlegen war, so deplatziert er auch sein mochte. Ob das eine gute oder schlechte Eigenschaft war, darüber ließ sich trefflich streiten.
»Du brauchst mich nach der Schule nicht abholen, Papa«, sagte sie beispielsweise jetzt ganz keck und löffelte dabei den Joghurtbecher in rekordverdächtigem Tempo aus. »Ich weiß, Mama macht Stress wegen des Zahnarzttermins, aber ich komme echt von da genauso schnell mit dem Bus hin. Ehrlich. Also hol das Motorrad ruhig aus der Garage und genieß den Tag. Musst halt nur vor ihr wieder hier sein. Dann kannst du ihr auch direkt erklären, dass ich nach dem Zahnarzt noch zu Lucie bin. Wir wollen für die Matheprüfung übermorgen büffeln.« Während sie das sagte, schaute sie ihn nicht einmal an und wäre bereits wieder aus dem Raum verschwunden, hätte Robert ihr nicht dezent den Weg versperrt, sodass sie nicht darum herum kam. Er warf ihr einen väterlich kritischen Blick zu, nippte anschließend abwartend an seiner Kaffeetasse und schien mit der Vorahnung, die ihn überkommen hatte, Recht zu behalten.
»Papa! Ich muss los. Sonst komme ich zu spät zur ersten Stunde«, protestierte sie und konnte nicht verhindern, im Gesicht rot anzulaufen.
»Hast du heute nicht erst zur zweiten Stunde Unterricht?«, fragte er und nahm einen weiteren Schluck. »Andernfalls wärest du doch sicher gerade mit deiner Mutter gefahren. So, wie du es dienstags, mittwochs und freitags machst?«
»Ja … Nein … Ist doch egal. Kann ich jetzt mal durch?«
»Um was geht es wirklich, Sandra? Du magst das Schauspielern deutlich besser draufhaben als deine Mutter, aber das ist noch immer nicht annähernd genug, um mir was vorzumachen. Also?«
Robert machte einen Schritt zur Seite, um ihr die Möglichkeit zur sofortigen Flucht zu geben. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn vor dem inneren Auge seiner Tochter in großen roten Buchstaben „ACHTUNG! ACHTUNG! VATER-TOCHTER-GESPRÄCH IM ANFLUG! ALARM!“ gestanden hätte. Noch weniger hätte ihn gewundert, wenn sie diese Warnung beherzigt hätte. Jedoch blieb sie stehen und seufzte endlich kapitulierend.
»Da ist so ein Typ … aus der Parallelklasse … «
So ein Typ? Die Worte ließen gleich alle väterlichen Alarmglocken läuten. Was für ein Typ denn? Rob spürte, wie der Wunsch nach dem Motorrad rasend schnell kleiner wurde. Natürlich würde er sie nach der Schule mit dem Auto abholen und höchstpersönlich zum Zahnarzt fahren. Und von dort aus zu Lucie oder wo auch immer sie noch hin wollte.
»Er ist echt cool«, versicherte sie schnell, »und wir wollten uns heute nach der Schule treffen ... Bitte, Papa ... Er ist in Ordnung. Ich brauche keinen Babysitter mehr, echt nicht.«
Er sah sie unverwandt an und sie schien seine Gedanken teilweise zu erraten.
»Ich verspreche dir, ich gehe zum Zahnarzt. Mama wird nichts davon mitbekommen. Und … ich stelle ihn euch vielleicht bald vor. Weiß ja nicht, wie es so laufen wird, aber ich habe ein gutes Gefühl. Okay?« Sie zog das „Okay“ länger als notwendig gewesen wäre und schaute ihn dabei mit diesem Blick an, den sie schon als Dreijährige draufgehabt hatte, wenn sie etwas unbedingt hatte haben wollen. Er hielt einen undurchsichtig bis strengen Blick noch einige Sekunden aufrecht, bevor er seufzte und sich eingestand, dass diesem speziellen Blick wohl kein Vater lange widerstehen konnte. Also senkte er den Kopf und nickte dann.
»Okay«, antwortete er und zog das Wort dabei ebenso lang, wie sie es getan hatte.
»Danke!« Ihre Umarmung kam unerwartet und sorgte beinahe dafür, dass Robert die Tasse fallen ließ. »Aber bitte sag es nicht Mama. Ich glaube, sie würde ausrasten oder so.«
»Ich sage nichts«, bestätigte er, schließlich war er kein Einfaltspinsel, der sich damit selbst verraten würde, dass er gegen ihre Anordnungen das Motorrad genommen hatte. Erst danach löste Sandra die Umarmung mit einem abermaligen »Danke!« und flitzte anschließend aus dem Raum, um ihre Schulsachen zusammenzusuchen. Fünf Minuten später, Rob hatte gerade den verwaisten Frühstückstisch abgeräumt, hörte er sie im Flur »Tschüss« rufen und das Haus verlassen.
»Tschüss«, antwortete er, aber das hatte sie sicher nicht mehr gehört.
Er beendete das Abräumen des Tisches mit dem Verstauen des Brotes im Brotschrank und schüttelte dabei einen Gedanken ab, der sich im Wesentlichen darum drehte, dass dieser Typ ein rowdyhafter Schläger nahe an der Volljährigkeit oder bereits darüber hinaus sein mochte. Seine Fantasie zeigte einen verwegenen Jungen, der lässig zwei Zigaretten auf einmal qualmte und dabei eines dieser fürchterlichen Tattoos am Hals offenbarte.
»Das ist doch albern«, wehrte er sich gegen die Hirngespinste. »Sandra ist kein kleines Kind mehr.« Und so war es ja auch. Die Zeiten, in denen er seine schützende Hand über sie hatte halten können, waren vorüber. Natürlich hätte er es trotzdem versuchen können, aber es war normal, dass derartiges Verhalten nur zu Problemen geführt hätte. Irgendwann war die Zeit des Beschützens vorbei, damit sich die eigenen Kinder selbst in der Welt ausprobieren und diese richtig entdecken konnten. Das war der Lauf der Dinge. Und bei Sandra war diese Zeit eben gekommen.
Theresa hatte Sandra auf die Welt gebracht, da waren Sie und Robert beide gerade 25 geworden. Erst drei Jahre danach waren sie offiziell vor den Traualtar getreten und hatten bis dahin (zum großen Argwohn ihrer Eltern) in wilder Ehe gelebt, wie man so schön sagte. Inoffiziell war der Augenblick, an dem sie erfahren hatten, dass Sandra unterwegs war jedoch ihr persönlicher geheimer Hochzeitstermin gewesen. Doch davon wussten nur sie beide.
Es waren turbulente Zeiten mit einigen Hindernissen und Widerständen gewesen. Aber sie schafften das. Theresa und Robert waren immer ein gutes Gespann gewesen und Sandra hatte sie noch mehr zusammengeschweißt. Irgendwie schafften es beide, beruflich voranzukommen, ohne dabei ihre Tochter zu vernachlässigen. Sie waren gar so erfolgreich darin, dass bald schon ein Haus gekauft werden konnte, das sie nach den eigenen Vorstellungen umbauten. Außerdem kamen mit der Zeit zwei Autos und ein Motorrad hinzu. Wenn man es ehrlich und unvoreingenommen betrachtete, ging es ihnen nie richtig schlecht. Vor allem Theresa hatte trotz Babypause bei der Bank eine ziemlich steile Karriere hingelegt. Und selbst Robert, als beinahe gewöhnlicher Sozialpädagoge, hatte es immerhin zu einem sicheren und durchschnittlich bezahlten Job in einem Alten- und Pflegeheim gebracht. Die zwei teilten sich seit jeher die Verantwortung der Kindererziehung und vergrößerten die kleine Familie neun Jahre nachdem Sandra das Licht der Welt erblickt hatte noch einmal. Daniel war ein ebenso großes Goldstück wie seine Schwester gewesen. Robert liebte sie beide vom ersten Moment an über alle Maßen …
Plötzlich überkam Robert ein seltsamer Gedanke. Ob mein Leben bis zu diesem Moment wohl so glücklich verlaufen wäre, hätte es die zwei nicht gegeben? fragte er sich ernsthaft und fand es dennoch komisch, dass er sich das überhaupt fragte. Klar hatten sie Einschränkungen mit sich gebracht. Wilder Sex in allen Räumen des Hauses war tabu gewesen und spontane Urlaube zu zweit, selbst wenn es nur am Wochenende war, gab es spätestens nach Daniels Geburt lediglich noch sehr spärlich und auch nur, wenn er oder Theresa ihre Eltern dazu überredeten, die Kinder für diese Zeit zu nehmen. Robert war das allerdings nicht so wichtig gewesen. Entscheidend war, dass sie glücklich waren und er glaubte, dass Theresa der gleichen Meinung war. Sie liebten sich wirklich nach über zwanzig Jahren noch und gingen durch dick und dünn miteinander. Zwar war Theresa mit der Zeit etwas einnehmend und beherrschend geworden, aber das nahm Rob ihr nicht übel. Vermutlich lag es an ihrem Beruf. Wenn es ihnen in der Vergangenheit zu viel geworden war, ließen sie beide gelegentlich ordentlich Dampf gegeneinander oder gemeinsam gegen jemand anderen ab, vorzugsweise Theresas Eltern, weil die sich immer noch einzumischen pflegten, als seien die beiden gerade achtzehn geworden. Danach waren sie jedenfalls stets wieder auf einer Wellenlänge. Es war wie ein reinigendes Gewitter, das eine bedrückende Sommerschwüle hinfort spülte und es hatte bislang immer funktioniert.
Ein Lächeln trat unvermittelt in sein Gesicht. Denn er war außerdem davon überzeugt, dass ihre Bettaktivitäten trotz langjähriger Beziehung noch immer beachtlich waren. Und obwohl er keine Vergleichszahlen hatte, war er ziemlich sicher, dass sie sich in einer Statistik dazu ziemlich weit oben wiederfänden.
Der heranschießende Gedanke an die vergangene Nacht machte sein Grinsen noch ein wenig breiter. Leidenschaft war gar kein Ausdruck dafür gewesen, dachte er und wischte die Erinnerung mit einem Kopfschütteln weg. Wieso dachte er ausgerechnet heute Morgen an all diese Dinge?
Er schaute auf die Uhr und war erstaunt, wie die Zeit verflog. Viertel vor acht. Jetzt war es also auch für ihn höchste Zeit, sich für die Arbeit zu kleiden. Und da er mit dem Einverständnis seiner Tochter nun fest ins Auge gefasst hatte, das Motorrad zu nehmen, blieb ihm noch ein bisschen weniger Zeit.
Obwohl Robert sein Motorradzeug nicht auf Anhieb fand, schaffte er es, sich innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten fertig zu machen, das Haus zu verlassen und die wunderbare schwarze Ducati Diavel aus ihrem Winterschlaf in der Garagenecke zu wecken. Schon das fordernde Röhren des Motors im Leerlauf bescherte ihm einige Glücksgefühle. Dieser Sound bedeutete Freiheit, Abenteuerlust, Geschwindigkeit. Er schob das Motorrad die Kiesauffahrt hinunter, über den Gehweg und auf die Straße. Dort wurde er unvermittelt von der neuen Nachbarin aufgehalten. Soviel er wusste, war ihr Name Tanja Kohl. Sie war wohl ende Dreißig, schlank, brünett, groß gewachsen und hatte ein ebenmäßiges Gesicht, das aber ständig den Eindruck bei ihm erweckte, dass sie irgendetwas zu verbergen schien. Sie war neben den Bauers eingezogen, lebte allein und arbeitete in diesem neuen Forschungskomplex, den sie zwischen Neesheiden und Fledhausen mitten im grünen Feld aus dem Boden gestampft hatten. EZ-Experimentals. Ein riesiges Areal.
»Morgen, Herr Bauer«, grüßte ihn Tanja gut gelaunt, die gerade von einer Joggingrunde zurück zu kommen schien. Ihre Proportionen waren sehr weiblich und das versteckte sie in ihrem Sportoutfit auch nicht.
»Ja. Guten Morgen, Frau Kohl. Ein schönes Wetterchen, was?«
»Kann man wohl sagen. Genau richtig für eine Runde Frühsport. Eine schöne Maschine haben Sie da. Eine Diavel?«
»Richtig. Sie interessieren sich für Motorräder?«
Sie lachte: »Nein, nein. Es steht dort an der Seite. Die Wahrheit ist: Ich habe eine Mordsangst vor diesen Feuerstühlen und würde mich nie auf einen setzen. Aber ich finde sie äußerst faszinierend.«
»Oh das sind Motorräder auf jeden Fall. Und das Fahrgefühl ist mit dem Autofahren gar nicht zu vergleichen. Aber … Es tut mir leid, wir reden besser ein anderes Mal weiter. Ich fürchte, ich komme andernfalls zu spät zur Arbeit.«
»Sie arbeiten im Sankt Johannes Altenheim nicht wahr? Entschuldigen Sie, dass ich das frage, aber hatte mein Arbeitgeber Sie und Ihre Einrichtung nicht um die Teilnahme an einer Studie zu Demenzerkrankungen gebeten?«
Irgendwie hatte Robert geahnt, dass das Gespräch auf dieses Thema kommen würde. Das gefiel ihm gar nicht und so reagierte er schmallippig. »So ist es. Und wir haben uns dagegen entschieden. Mit geltenden Menschenrechten ist das nicht vereinbar, was ihr Chef da plant.«
»Aber, aber, so schlimm ist es ja nun auch nicht. Wir wollen ja keine Versuche mit Ihren Demenzkranken anstellen. Es geht vorwiegend um die Analyse gewisser Hirnareale.«
»Dazu hat wohl jeder seine eigene Meinung. Insgesamt habe ich in dieser Sache aber keine Entscheidungsbefugnisse … Ich muss jetzt leider wirklich los. Bis die Tage.«
»Ja, machen Sie es gut, Herr Bauer. Und winken Sie mal kräftig für mich, wenn sie an EZ-E vorbeifahren. Ich habe heute meinen freien Tag und werde die Kollegen nicht sehen.«
Er stutzte kurz, weil er sich nicht erklären konnte, woher sie wusste, wie er zur Arbeit zu fahren pflegte, aber da es nur eine größere Straße nach Sankt Johannes gab, war es wohl klar, dass er an ihrem Arbeitsplatz vorbeimusste.
»Na dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaubstag.« Damit setzte er sich in Bewegung und (ohne sich noch einmal nach ihr umzuschauen) schob das Motorrad bis zur nahen Abbiegung in die Hauptstraße. Erst dort setzte er den Helm auf, klappte das Visier herunter, aber erst nach einem ausgiebigen Blick in Richtung der noch tiefstehenden Sonne, die durch einige morgendliche Nebelschwaden funkelte, und sattelte auf.
Er ließ die Maschine im Leerlauf zweimal hochdrehen und bemerkte, dass ihr der Winter keinen Abbruch getan hatte. Sie war so zuverlässig und wild, wie im vergangenen Herbst. Dann ging es los. Auf dem leicht nassen Untergrund drehte das Hinterrad den Wimpernschlag eines Augenblicks durch, fand dann den nötigen Gripp und beschleunigte das Motorrad und Robert in Windeseile über die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.
III
Wer nicht selbst einmal auf einem motorisierten Zweirad gesessen und süchtig nach dem Gefühl geworden ist, kann wohl kaum nachvollziehen, wie genial es ist, nach vier langen Monaten wieder den Widerstand des Fahrwindes zu spüren und die Kräfte, die auf einen wirken, wenn man schwungvoll in eine Kurve fährt. Oder das Kribbeln im Bauch, bei der rasanten Fahrt einen Hügel hinauf oder hinunter. Es ist wie ein Rauschzustand. Als sei man ein Vogel, der zum ersten Mal die Flügel ausbreitet, um zu fliegen. Wie der Ritt auf einer rasanten neuen Achterbahn. Wie Schmetterlinge im Bauch, die einen Wirbelsturm verursachen. Man wird ganz und gar hineingezogen in dieses Gefühl und möchte vor Glück und Aufregung am liebsten laut Lachen oder die Freude herausschreien.
Robert tat das an diesem Morgen erstmals, als er mit über einhundert Sachen den Hügel außerhalb seines netten kleinen Heimatortes herunter heizte. Sein Arbeitsplatz lag in einem noch kleineren Ort, der sich zehn Kilometer entfernt befand. Um dorthin zu gelangen, musste man auf dem kürzesten Weg zwei weitere Dörfer passieren. Dazwischen lagen jeweils einige Kilometer kurvig auf und ab führende Landstraße. Es war das optimale Terrain für einen passionierten Motorradfreak wie Rob. In einem Anflug von Übermut überholte er einen zu langsamen PKW kurz vor dem ersten Ortseinangsschild. Hiernach drosselte er das Tempo leidlich und fuhr mit sechzig Sachen über die einigermaßen gerade Hauptstraße, um am Ortsausgang gleich wieder auf einhundert Kilometer pro Stunde zu beschleunigen. Es war leichtsinnig und er wusste das, aber das Gefühl der Befreiung war größer als jede Vernunft an diesem Morgen. Es wäre ihm lieb und recht gewesen, wenn der Weg zu Arbeit ewig gedauert hätte. Wenn er nur an die außerordentliche Heimversammlung bezüglich der Medikamentensache dachte, wurde ihm übel. Vor seiner Frau hätte er das nie zugegeben, aber er hatte ein schlechtes Gefühl, was diese Sache betraf.
Zu den plötzlichen Negativgedanken kam, dass auf dem geraden Straßenabschnitt, den er gerade befuhr, eine Tempo-70-Zone eingerichtet worden war, da in einigen hundert Metern die neu errichtete Abzweigung zum Gelände von EZ-Experimentals wartete. Robert sah den riesigen Klotz aus Glas, Stahl und schwarzem Marmor schon aus weiter Ferne. Es sah aus, als hätte ein Riese einen Legostein in die Landschaft fallen lassen. Das Gebäude zog sich bis zum waldbedeckten Hügel hinter den Feldern hinauf, wo es anscheinend endete oder unterirdisch verschwand. Robert wusste es nicht. Das gesamte Areal war durch hohe Zäune mit Stacheldrahtkronen gesichert. Außerdem hatte er Überwachungskameras gesehen. Kurz hinter der Abzweigung warteten ein Schlagbaum, ein Kartenlesegerät, ein Kontrollhäuschen und noch mehr Umzäunung, die niemand ohne Erlaubnis passieren durfte.
Sie mussten in dem in der Morgensonne blitzenden und glitzernden Neubau also ganz besonders schützenswerte und diskret zu behandelnde Forschung betreiben. Robert konnte sich kaum vorstellen, dass man andernfalls eine Sicherung brauchte, die an militärische oder geheimdienstliche Einrichtungen erinnerte. Andererseits hatte er vor einiger Zeit kurz das zweifelhafte Vergnügen gehabt, den Gründer und Leiter von EZ-E kennenzulernen. Eugen Zander war gebürtiger Hansestädter, ein Geschäftsmann und Forschungswahnsinniger durch und durch. Sein Vater Albert, der erst kurz nach dem Weltkrieg mit der Familie aus dem Hunsrück in den Norden gezogen war, war zum Ende seines Lebens in die Nähe seiner Heimat zurückgekehrt. Er hatte fünf Jahre ein Zimmer im Sankt Johannes Altenheim bewohnt. Etwa ein Jahr, nachdem er zu ihnen gekommen war, hatte man Demenz diagnostiziert. Sein Zustand hatte sich nur langsam verschlechtert, aber erst, als es rapide bergab ging, war seine Familie aufgekreuzt. Darunter Eugen, der mit einem Forschungsstartup, das er verkauft hatte, zum Multimillionär geworden war. Für Eugen Zander war der Zustand seines Vaters nicht hinnehmbar gewesen. Er wollte einfach nicht verstehen, dass es keine Heilung gab und wollte ebenso nicht wahrhaben, dass ihn sein eigener Vater nicht mehr erkannte. Eine Verlangsamung der Krankheit durch Medikamenteneinsatz reichte ihm nicht. Unter keinen Umständen wollte er zulassen, dass von Albert am Ende nur noch eine erinnerungslose Hülle blieb. Also hatte Zander alle Hebel in Bewegung gesetzt, ein Team von Forschern aus Medizin, Physik, Chemie und Digitalentwicklung zusammengestellt und mit der Hilfe von Geschäftspartnern EZ-Experimentals aus der Taufe gehoben. Das Gebäude war vor einem halben Jahr fertig und betriebsbereit gewesen. Es war erstaunlich, wie schnell alles gegangen war. Robert hätte es nicht geglaubt, wenn er es nicht selbst jeden Morgen mit hätte ansehen können. Eugen Zanders Vater Albert starb drei Monate später und hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung mehr, wer Eugen und die anderen Familienmitglieder überhaupt waren. In Schüben beschimpfte er sie als Nazi-Brut, Zigeuner und Scharlatane, die es auf seine wertvollsten Erbstücke abgesehen hatten. Welche das waren und wieso er das glaubte, verriet er nie. Vermutlich wusste er es selbst nicht mehr. Es war ein Segen, dass der alte Mann eines Abends einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht war.
Eugen Zander war da anderer Meinung. Er hatte getobt und in Wut und Tränen herausposaunt, dass sie bereits großartige Fortschritte in der Entwicklung des EZ-E Lösungsansatzes zur Bekämpfung der Demenz gemacht hätten. Er schob die Schuld des Ablebens seines Vaters auf die Heimleitung, die miese Pflege und Sozialbetreuung. Es war ein langer, ermüdender Streit, an dessen Ende Zanders Anfrage stand, ihm zumindest einige lebende Demenzkranke zur Verfügung zu stellen, um die Krankheit bei erfolgreicher Untersuchung und Weiterentwicklung der Forschungsgrundlagen endlich besiegen zu können. Auf Nachfrage verweigerte Eugen Zander allerdings jegliche Details zu dem, was und in welcher Weise an den Probanden untersucht werden sollte. So konnte sich die Heimleitung im Falle derjenigen, deren Vormundschaft sie übernommen hatten, aus rein gesetzlichen Gesichtspunkten nur dagegen aussprechen. Zander ließ natürlich nicht locker, fand einige Nachkommen von Altenheimbewohnern, die ebenfalls die Vormundschaft für ihre demenzkranken Eltern übernommen hatten und köderte sie mit Geld und mit der Aussicht darauf, dass sie womöglich ihre geheilten Erzeuger wiederbekommen würden. So fand sich schließlich eine gute Handvoll. Doch wie es das Schicksal so wollte, waren die gesundheitlichen Belastungen bei einigen zu groß, um das Heim zu verlassen und andere starben in den folgenden Monaten, ehe Eugen Zander sie hatte in seinen Forschungskomplex bringen können.
Wie der Mann weiter verfahren war, davon hatte Robert keine Ahnung. Es war ihm gewissermaßen egal. Manche Dinge durfte man einfach nicht tun, das war sein Standpunkt dazu. Was Eugen Zander versuchte, war falsch und Rob war froh, dass keiner seiner Schützlinge diesen grässlichen Komplex je hatte betreten müssen. Aus seiner plötzlich verdüsterten Laune heraus, ließ er die Maschine hochdrehen. Der Auspuff knatterte so laut, dass sie es unter Garantie hinter ihren schicken Fenstern hören mussten, als er vorbeirauschte. Tanja Kohl hatte ihm gesagt, er solle winken, wenn er vorbeifuhr. Stattdessen ließ er ihnen einen viel eindringlicheren Gruß da und empfand dabei diebische Schadenfreude.
Die verflüchtigte sich freilich, als er viel zu spät merkte, dass man kurz hinter der Abzweigung auf beiden Fahrbahnseiten einen mobilen schwarzen Kasten mit einer großen Linse installiert hatte. Robert versuchte noch vom Gas zu gehen, aber zu spät. Das Blitzlicht, das aus dem Kasten aufleuchtete, war so brennend hell, dass Robert für Sekunden völlig blind wurde. Er kniff die Augen zusammen und sah blitzende Sterne. Unter ihm spürte er, wie das Motorrad langsamer wurde. Eine solche Radarfalle hatte er noch nie erlebt. Das ist ja brandgefährlich, dachte er, immer noch darum kämpfend das Augenlicht zurückzugewinnen. Denn nach den Sternen war kurz noch graue Dunkelheit vor seinem inneren Auge und dann nur noch leere Finsternis…
Er fluchte auf den Starenkasten, seine eigene Dummheit und auf EZ-E, die sicher etwas damit zu tun hatten. Erst, als die Diavel unter seinem Hintern beinahe zum Stehen kam, kehrte seine Wahrnehmung langsam zurück. Er schüttelte heftig den Kopf und stieß ein paar deftige Schimpfwörter in Richtung des noblen Forschungsareals aus, dann drehte er die Maschine hoch und ließ diesen verfluchten Ort schnell hinter sich. Das Knöllchen würde er irgendwie heimlich bezahlen. Theresa würde es schon nicht merken…
So schnell wie selten zuvor erreichte er Fledhausen. Er hatte sich gerade von dem Blitzer erholt, da geschah beinahe das nächste Unglück. Die Straße vollführte kurz hinter der Ortseinfahrt eine lange Rechtskurve, die leicht bergab geneigt war. Die Häuser dort standen so dicht an der Straße, dass man kein freies Blickfeld auf das Ende der Kurve erhaschen konnte bis man in sie hineingefahren war. Dieser Umstand war beinahe fatal. Denn in der Sekunde, in der er zur Seite geneigt durch diese Kurve sauste, verließ an deren Ende ein pechschwarzer Pickup, ein Dodge Ram, eine schmale Einfahrt zwischen zwei Fachwerkhäusern. Er hatte vorwärts eingeparkt und Robert daher beim Zurücksetzen nicht sehen können. Dieser wiederum war zu schnell und sah das bereits halb auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug erst, als es beinahe zu spät war. Wie eine Wand baute sich das schwarzglänzende Heck vor Rob auf und kam rasend schnell näher. Das erste, das passierte, war das Verschwinden des Glücksgefühls, das von einem wahren Schock überrollt wurde. Dann setzten die Instinkte ein und taten, was nötig war. Als Robert den Schrei: »Scheiße!« über die Lippen brachte, hatte sein innerstes bereits heftig gegengelenkt, war auf die Bremse gestiegen und hatte den Oberkörper aufgerichtet, um das Motorrad danach in die andere Richtung zu lenken. Er wusste selbst nicht, wie er es schaffte, denn seiner Wahrnehmung nach war der Ram vielleicht noch einen Meter entfernt und er war sicher, dass er heftig dagegen knallen würde. Doch obwohl Robert spürte, wie das Heck seiner Ducati auf dem nassen Straßenbelag ausbrach und ins Rutschen geriet, behielt er die Kontrolle, gab intuitiv einen Stoß Gas und rauschte an dem Fahrzeug vorbei. Danach gab es nur noch eins. Er trat in die Eisen, wie er es selten zuvor getan hatte, schlingerte von einer Straßenseite auf die andere und hatte Glück, dass kein Gegenverkehr unterwegs war. Endlich kam er zum Stehen, quer auf der richtigen Straßenseite.
»Scheiße!«, rief er erneut in seinen Helm, fassungslos darüber, was gerade geschehen war. Danach atmete er tief durch oder versuchte es zumindest, bemerkte, dass er am ganzen Körper zitterte und warf endlich einen Blick zurück auf den Wagen, der dreißig Meter entfernt noch immer regungslos halb auf der Straße stand. Die Seitenfenster waren verdunkelt, sodass Rob dahinter nur schemenhaft eine Gestalt erkennen konnte. Ihm war, auch wenn man das als Zweiradfan gerne anders sieht, gleich klar, dass die Schuld eines möglichen Unfalls vollkommen bei ihm gelegen hätte. Mit einer großen Portion Glück, Intuition und fahrerischem Können war es nicht dazu gekommen. Schlecht fühlte er sich dennoch. Hundeelend, wenn man es genau wissen wollte. Ihm war flau im Magen und gleichzeitig ereilte ihn ein Gefühl, als sei er in eine Tonne mit Eiswasser geworfen worden. Deshalb hob er erst, nachdem das Zittern endlich weniger wurde, entschuldigend die Hand in Richtung des Dodge-Fahrers. Der Kerl, wenn es denn einer war, schien leicht den Kopf zu bewegen und Robert vermochte nicht zu sagen, ob der Typ verstand, was er mit seiner Geste sagen wollte.
»Sorry, ich war zu schnell. Aber es ist alles noch mal gut gegangen.«
Roberts Hand verharrte einige Sekunden auf diese Weise. Es gab auf der Gegenseite keine erkennbare Reaktion. Als er den Arm endlich wieder herunternahm, ließ er den Kopf sinken und es gelang ihm endlich, einmal tief durchzuatmen. Es hatte in seinem Leben davor nicht viele Momente gegeben, in denen es so gut getan hatte, frischen Sauerstoff in seinen Lungen zu spüren.
Da von der Person hinter der verdunkelten Scheibe beständig keine Reaktion kam und Robert außerdem weiterhin zur Arbeit musste, wendete er endlich die Ducati zurück in die Spur und fuhr mit einem letzten entschuldigenden Winken davon. Einige Kurven später fragte er sich bereits, ob er in diesem Augenblick etwas anders hätte machen können oder sollen? Er war sich nicht sicher. Vermutlich wäre es einfach angebracht gewesen die dreißig Meter zurückzufahren, um die Sache in einem kurzen Gespräch zu klären. Vielleicht …
Im Nachhinein ändert es überhaupt nichts. Und jedes Philosophieren und Schwadronieren über das Für und Wider der alternativen Möglichkeiten führt nur dazu, dass man seine Zeit verschwendet.
Robert fuhr winkend davon. Das war’s. So ist es passiert.
Noch immer mit reichlich weichen Knien bedacht, hielt er sich an das Tempolimit und selbst auf dem letzten Landstraßenabschnitt, der kreuz und quer durch ein paar karge Felder führte, überschritt er die 80 Km/h-Grenze nicht mehr. Er hielt das bis zu jenem Moment durch, mit dem sein eigener Untergang begann.
Er war vielleicht noch zwei Kilometer von seiner Arbeitsstelle entfernt, da zuckte er plötzlich zusammen, weil hinter ihm jemand ohne Vorwarnung intensiv von der Hupe gebraucht machte. Robert fuhr zwar jetzt langsamer, jedoch noch immer so, dass sich eigentlich niemand beschweren konnte. Der Blick durch den Rückspiegel in einen hoch aufragenden, verchromten Kühlergrill versetzte ihm einen Schock und verriet ihm gleichzeitig, dass es der Pickup von vorhin sein musste. Obwohl der Motor der Bestie röhrend laut war, wenn der Fahrer das Pedal nur antippte, hatte Robert ihn nicht herankommen gehört. Irgendwie schien er nach den Minuten seines Beinaheunfalles zu beschäftigt und in Gedanken gewesen zu sein. Anders konnte er sich nicht erklären, weshalb er erst nach einem Hupen auf das Monstrum aufmerksam wurde. Denn da befand sich das Fahrzeug bereits in unmittelbarer Nähe zu Robs Hinterrad.
Es folgte eine Linkskurve, in der Robert leicht ein paar Meter Abstand gewinnen konnte. Die schmolzen auf dem folgenden, geraden Abschnitt jedoch aufs Neue rapide zusammen und schließlich fehlte nicht mehr viel und er hätte den Wagen mit der Hand berühren können. Das versuchte er selbstverständlich nicht, stattdessen wendete er sich für eine Sekunde leicht um, ohne die Kontrolle über sein Motorrad zu verlieren, und gab dem Kerl hinter ihm mit Kopf- und Handbewegungen klar zu verstehen, er solle gefälligst überholen, wenn ihm das zu langsam wäre. Als prompte Antwort hatte der Mistkerl nichts Besseres zu tun, als ein weiteres Mal auf die Hupe zu drücken und zusätzlich aufzublinken.
»Wo soll ich denn hin, du Vollpfosten?«, zischte Robert in seinen Helm, drehte den Kopf immer wieder und wusste nicht, was er tun sollte. Schließlich, es fehlten vielleicht noch zehn Zentimeter bis der Pickup das Hinterrad der Ducati touchiert hätte, gab Robert Gas. Er wusste es einfach nicht besser und vermutlich hatte er - neben dem flauen Gefühl, welches ein drohender, ein Meter fünfzig hoher Kühlergrill im Rücken auslöst - schlichtweg Angst. Angst um seine Gesundheit und sogar Angst um sein Leben. Die Maschine unter ihm freute sich indes, von der Leine gelassen zu werden und katapultierte binnen eines Augenblicks spielend über die magische 100-Kilometer-pro-Stunde-Marke. Er gewann schnell ein paar Meter und bald war er sicher, dass ihn der Kerl, sein Gesicht oder sonstige Details hatte Robert trotz mehrmaligem Zurückschauen nicht erkennen können, vor dem Ortseingang kaum noch würde einholen können.
Da kurz hinter dem Ortschild auf der linken Seite ein größerer Gartenmarkt war mit umzäunten Außenverkaufsgelände und Parkplätzen davor, der zu allen Tageszeiten Kunden hatte, beschloss er, seine Maschine die restlichen tausend Meter ohne weitere Gaszufuhr rollen zu lassen. Ein letztes Mal trieb er den Motor hoch, dann ging er in den Leerlauf und schoss dem Stadtgebiet entgegen. Vollkommen hatte er sich natürlich nicht beruhigt und weiterhin brannte hinter seinem inneren Auge das Bild des hinter mir aufragenden Monsterpickups.
Was für ein nachtragender Idiot. Ich habe mich doch entschuldigt, dachte Rob, aber das reichte eigentlich gar nicht aus. Denn mit welchem Recht brachte dieser Spinner sein Leben in Gefahr? Was wäre denn gewesen, wenn ich unvorhergesehen hätte bremsen müssen? Er wäre doch glatt über mich hinweggedonnert? Das Bild des Fahrzeugs in seinem Rücken wurde von der kurzen Horrorvorstellung verdrängt, in der sein schleudernder und rutschender Körper auf dem Asphalt aufschürfte, ehe ein verchromtes dreckiges Grinsen tonnenschwer über ihn walzte und ihm alle die Knochen brach, die der Sturz und das unkontrolliert durch die Gegend fliegende Motorrad noch unversehrt gelassen hatten.
Allein der Gedanken an das Rutschen über den Asphalt, wenn binnen Sekunden die schützende Motorradkleidung vom rauen Untergrund weggeschabt wird und darunter nur noch nackte Haut wartete, trieb Rob eine Gänsehaut auf die Arme. Er hatte zweimal in seinem Leben leichtere und einigermaßen glimpflich endende Unfälle auf dem Motorrad gehabt und konnte sich gut an das fürchterliche Gefühl und die Schmerzen erinnern.
Verdammt! Das ist mein erster Motorradausflug, seit dem letzten Herbst und statt es zu genießen, selbst wenn es nur die Tour bis zu Arbeit ist, mache ich mir einen Kopf über solche Sachen. All die positiven Gefühle, die das Biken normalerweise in ihm auslöste, waren vollkommen nebensächlich geworden. Das war alles nur die Schuld dieses Typen mit seinem riesigen Auto. Verdammter Idiot!
Tock-tock!
Eine durchfahrene Bodenwelle riss Robs abschweifende Aufmerksamkeit zurück auf die Straße. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass es auf der Strecke je eine solche gegeben hatte, aber sie war zweifelsohne da und entsprechend schockiert reagierte er auf den Schlag, den es gab, als die Ducati hindurchraste. Andere hätten vielleicht die Kontrolle verloren, er jedoch hielt den Lenker fest im Griff und geriet nicht ins Schlingern. Eines ließ ihn dieses unschöne Ereignis zumindest sofort bemerken: Er war noch immer verflixt schnell. Zu schnell für die nahende 50er-Zone.
Sonst funktioniert das mit dem Ausrollenlassen hier doch eigentlich immer prima, wunderte er sich und kratzte sich innerlich den Kopf. Bin ich nach dem Winter wohl einfach außer Übung, was das betrifft. Vielleicht aber bin ich auf dem vorangegangenen Abschnitt schlicht viel schneller als normal unterwegs gewesen, wegen dieses Vollgasidioten. Die beiden Erklärungsversuche kämpften eine Sekunde um die Deutungshoheit dieses banalen Rätsels, ehe er sie aus seinem Bewusstsein verbannen konnte. Bremsen war jedenfalls bald angesagt … Es kam nicht mehr dazu.
Wie ein schwarzer Blitz schoss der Dodge Ram, den er glaubte, abgehängt zu haben, aus dem Nichts heran. Rob sah ihn für den Bruchteil einer Sekunde im Rückspiegel, dann war er auf der anderen Straßenseite, neben dem Motorrad und an ihm vorbei. Er hupte und schnitt seinen Weg, als er vor Robert wieder einscherte. Was genau danach passierte, geriet aus Roberts Sicht vollkommen durcheinander. Natürlich erschreckte ihn das neuerliche Erscheinen des Fahrzeugs. Obwohl er damit hätte rechnen müssen, dass es erneut herankommt sobald er langsamer wurde, war es doch in der Art und Weise, wie es das schwarze Monstrum tat, derart überwältigend, dass Rob auf seinem Zweirad wie festgefroren war. Unfähig einen einzigen Muskel zu Rühren. Er wusste, dass seine Finger auf der Bremse ruhten. Vernünftigerweise hätte er bremsen sollen, sobald der Pickup ihn überholt hatte, aber er tat es nicht. Er konnte es einfach nicht. Als der Ram an ihm vorbeiraste, schien ihn gleichzeitig etwas mit eiskaltem Griff zu umschlingen und ihn hiernach nicht mehr loszulassen. Er hatte derartiges zuvor nie erlebt oder gespürt. Es war, als fiele man in ein Becken mit eiskaltem Wasser. Jeder Muskel verkrampfte, nicht einmal das Atmen gelang ihm mehr. Etwa so erging es Robert, als der Pickup vor ihm auf die Fahrbahn zog und keine fünf Sekunden später eine Vollbremsung hinlegte und ihn endgültig erstarren ließ. Er sah die Bremslichter aufflammen, bemerkte, dass die Räder des Rams blockierten und rutschten. Auch das Ausbrechen des Hecks und das Herumschleudern beobachtete er, als geschähe es viel langsamer, als es in Wahrheit der Fall war. Das Fahrzeug drehte sich quietschend um die eigene Achse und war im Begriff eine weitere Drehung hinzulegen. In diesem Bruchteil eines Augenblicks konnte er erstmals ins Gesicht des Fahrers blicken. Rote Augen, kantiges Kinn, wirre dunkle Haare bis tief hinunter in die Stirn und grausam spitze Zähne. Es war eine teuflische Fratze, voll mit boshafter Genugtuung. Die Augen starrten Robert an und er hätte schwören können, dass sie mit jedem Zentimeter, den er ihnen auf seinem Motorrad entgegenschoss, weiter aus den Höhlen traten, herausquollen und zu bluten begannen. Rote Tränenbäche flossen über weiße zerfurchte Wangen. Es war vielleicht dieser fürchterliche Anblick, der ihn schließlich aus der eisigen Umklammerung befreite - das inzwischen weit zu einem Schreien oder Lachen aufgerissenen Maul, das Blut und die glühend roten Augen. Robs Hirn gab einen reflexhaften Befehl, der peitschenknallend in seinen Händen landete. Die Finger krallten sich um die Bremsgriffe und drückten heftig zu. Das bockige Blockieren des Vorderrades im Zusammenspiel mit dem ächzend bis kreischenden Geräusch der Bremsscheiben, denen nach dem langen Winter ein wenig Wartung und Pflege gut getan hätte, läutete unheilverkündend und schrecklich seinen unweigerlichen Untergang ein. Er spürte kurz, dass die Ducati merklich Geschwindigkeit verlor, doch dann war die Bremswirkung fort. Sie war schlichtweg verschwunden. Egal, wie feste er die Griffe danach drückte, es passierte nichts. Der übriggebliebene Abstand zu dem (wie ein unüberwindbares Hindernis vor ihm über die Fahrbahn rutschenden) Pickup löste sich binnen eines Wimpernschlages auf. Gerade bremste er noch, da rauschte sein Vorderrad bereits knapp unterhalb des verchromten Kühlergrills in den Dodge Ram hinein. Der Schlag und der folgende Ruck, der ihn aus dem Sattel hob, waren überwältigend. Robert hörte das Krachen des Aufpralls erst, als er bereits halb in der Luft hing. Kurz konnte er sich noch ans Lenkrad klammern, wurde aber durch die bloße Wucht davon losgerissen. Mit deutlich spürbarem Knacken brachen Elle und Speiche in beiden Unterarmen. Der gleißende Schmerz blieb gleichwohl ein Nebengeräusch, katapultieren ihn die Kräfte der Geschwindigkeit doch kopfüber auf die Motorhaube, ließen ihn einen Überschlag vollführen, worauf er mit dem Helm voran in die Frontscheibe krachte. Das Glas barst unter der Gewalt des Aufpralls. Robs Helm erging es nicht besser. Es gab ein dröhnendes Krachen und das Visier zerplatzte einfach vor seinen Augen. Er fand sich plötzlich nur wenige Zentimeter von der teuflischen Fratze entfernt. Sie war weiterhin lauthals am Lachen und ihre Augen waren nun vollends aus den Höhlen herausgetreten.
»Wir sehen uns, Robert!«, glaubte er das Monster röchelnd schreien zu hören. Dann riss ihn die noch immer vorhandene überschüssige Energie fort. Er war in dieser Sekunde wie eine Fliege, die auf die Scheibe geklatscht war und vom energischen Wischer entfernt wurde. Über das Dach schleudernd und einen weiteren Überschlag vollführend, flog er über die Ladefläche, die - er konnte schwören, dass es so war – vollgestapelt mit nach Moder und Zerfall riechenden Leichenteilen war. Das war unmöglich, doch um näher darüber nachzudenken oder genauer hinzuschauen blieb keine Zeit. Denn von dort ging es widerstandslos mit einem harten Aufschlag direkt auf die nasse Fahrbahn hinter dem Pickup. Vielleicht hatte es ihn zu diesem Zeitpunkt bereits das Genick gebrochen und zwangsläufig sein Ableben eingeläutet. Denn er spürte zwar noch, dass er nach dem heftigen Aufprall mit Schulter und Hüfte über den Asphalt schlitterte und sich der raue Untergrund, nachdem der grobe Untergrund sich durch die Schutzkleidung gefressen hatte, an seiner Haut labte, aber Robert spürte die Schmerzen kaum. Noch bevor er wahrnahm, dass der Zaun des Gartenmarktes dem Ganzen mit letzter Gewissheit ein furioses Ende bereiten würde, schwanden seine Sinne bereits. Sein Blick, der ohnehin vom Überschlagen und Herumschleudern ziemlich desorientiert war, wurde dunkel. Er schmeckte eine bittere und heiße Flüssigkeit im Mund, aber das schien plötzlich egal zu werden.
Jetzt hast du es wirklich endgültig geschafft, Robert, war der sowohl banale, als auch einzige Gedanke, den sein sterbendes Hirn vollbrachte, ehe es abschaltete. Es war seltsam. Er wusste, dass dies sein Ende war. Er wusste es ganz einfach, obwohl er nur einen Bruchteil dessen mitbekam, was mit ihm und seinem Körper in diesen wenigen unseligen Sekunden tatsächlich geschah. Es gab keinen Lebensfilm, der vor seinem inneren Auge vorbeiraste, kein Licht, auf das er zu flog, keine Trauer darüber, dass er seine geliebte Familie nie wieder sähe. Nichts. Nur dieser eine banale Gedanke, es endgültig geschafft zu haben. Und das war es.
Den Einschlag in den Zaun, der ihm endgültig alles brach, was zu diesem Zeitpunkt noch ganz geblieben war, nahm Robert vielleicht noch irgendwo unterbewusst wahr. Insgesamt floss das Leben jedoch schneller aus seinen Adern, als Wasser aus einem vollkommen durchlöcherten Eimer. Und dann war er tot.
Gestorben.
Das Leben konnte so verflucht grausam sein.
IV
Mal angenommen …
Keine Angst, ich erzähle gleich weiter. Aber stellen Sie sich vorher doch bitte noch einmal vor, in diesem leeren Raum mit den weißen Wänden zu sitzen. Und stellen Sie sich weiter vor, sie würden dort sitzend darüber nachdenken, einen schrecklichen Unfall zu erleiden, der sie, trotz möglicherweise erfolgender medizinischer Hilfe, das Leben kostete. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist. Vielleicht sträuben sich Ihnen die Nackenhaare und die Bilder, die Ihr Kopf beim Erörtern dieses Themas produziert, mögen solcher Natur sein, dass sie lieber die Augen aufreißen wollen, um an nichts denkend die weißen Wände anzustarren.
Meine Frage dazu lautet: Wie viel von diesem schrecklichen Ereignis würde ihr Bewusstsein sie wohl mitbekommen lassen, ehe es gnädiger Weise den Notschalter betätigte und sie „offline nähme“, wie man heutzutage so schön modern sagt? Nun, was glauben Sie?
Wie auch immer Ihre Gedanken dazu aussehen, ich für meinen Teil halte das menschliche Gehirn und seine Selbstschutzmechanismen für eine ausgesprochen faszinierende Angelegenheit. Aber genauso halte ich es für ein törichtes Ding, das einen in einem sehr entscheidenden Moment heimtückisch von hinten packt und einen in tiefste Schwärze zieht. Das wiederum macht es einem unmöglich, die exakte Antwort auf die Frage: „Und was passierte dann?“, geben zu können. Denn man war zwar dabei, aber mitbekommen hat man dennoch nichts. Und wenn man dann später irgendwann wieder etwas mitbekommt, dann ist unter Umständen alles anders. Alles und für immer … Und das ist der erste Schritt, der einen in den Wahnsinn treibt.
V
Es gab keine Erklärung, die er hätte abgeben können, um zu schildern, was mit ihm geschah, nachdem er über die Straße schlitternd sein Leben ausgehaucht hatte. Es klaffte schlicht ein unergründbares, schwarzes Loch in seine Erinnerung, in das er niemals mehr würde Licht bringen können. Das nächste, an das Robert sich erinnerte, war eine ungeheure Hitze und gleichzeitig eine eisige Kälte, die bis tief in seine Knochen gekrochen war. Er zitterte am ganzen Körper und fühlte sich doch, als steckte er in einem aufgeheizten Backofen.
Und dann, einhergehend mit einer heranwogenden Welle aus purem Schmerz, riss er die Augen auf. Er schrie laut auf und krümmte sich. Bilder vor seinem inneren Auge ließen ihn den Unfall erneut in allen Phasen durchleben, klarer und grausamer, als die Realität gewesen war. Tränen hinderten derweil seine Augen an einem klaren Blick. Er wischte sie fort, obwohl er nicht annähernd in der Lage war, seine Gliedmaßen unter Kontrolle zu bringen. Und kaum hatte er sie doch fortgewischt, traten gleich unendlich viele weitere an die Stelle der vorigen. So ging es schier ewig weiter und die Pein wollte nicht weichen. Bald bekam er keinen Ton mehr über die spröden Lippen, während seine Kehle brannte wie Feuer. Es war, als habe jemand sich mit einer rostigen Säge bis hinunter in seine Lungen daran zu schaffen gemacht. Zu nichts anderem in der Lage, sank er zusammen und wimmerte vor sich hin. Die Tränen flossen, während die Schmerzenswogen langsam abebbten, um ihn Sekunden später aufs Neue zu ertränken. Robs einziger Gedanke war bald das Flehen darum, dass es endlich aufhören möge, egal was dazu nötig wäre.
»Erlöse mich. Mach, dass es aufhört … Bitte … Bitte mach, dass es aufhört, weh zu tun.«
Zu wem er das sagte, wusste er selbst nicht. Robert glaubte nicht an Gott oder ein anderes höheres Wesen. Er hatte das ganze übernatürliche Glaubenszeug immer verachtet, da es wenig logisch und noch weniger beweisbar erschien. Und doch flehte er auf dem Boden kauernd jemanden oder etwas an, den Schmerz von ihm zu nehmen. Er hörte lange Zeit nicht damit auf, so hoffnungslos es war.
Natürlich geschah auch nichts dergleichen. Es erschien keine göttliche Hand, die sich über ihn legte und das Leiden von ihm nahm. Nichts. Er durchlitt vielmehr weiter die Qualen eines zerbrochenen Körpers in jeder einzelnen Faser und sank irgendwann zurück in einen Zustand dämmriger Bewusstlosigkeit.
Viel später – das glaubte Robert zumindest mittlerweile – kam er wieder zu sich und fand sich auf dem Küchenboden seines Hauses liegend wieder. Es war exakt der Punkt, an dem er gestanden hatte, als er am Morgen mit Sandra geredet hatte. Die Schmerzen waren noch da, aber sie waren jetzt weit weniger schlimm. So, wie die See nach einem heftigen Sturm manchmal sehr ruhig und gleichmäßig ist. Die Wellen brechen sich noch immer am Strand, doch haben sie jegliche Heftigkeit und Kraft verloren. Die Tränen waren getrocknet und nur noch wenige Rückstände auf seinen Wangen erinnerten an sie. Er rieb sich die verklebten Augen, was noch immer nicht leicht war, aber besser funktionierte, als bei den vorigen Versuchen. Schließlich richtete er sich vorsichtig auf und schaute umher. Es war unzweifelhaft die Küche seines Hauses, der Heimat seiner Familie. Er erkannte die verchromte Front des Kühlschranks in der Ecke und die Landhausstilgriffe an den Schubladen, außerdem die in geschwungenes helles Holz gefasste Schiefertafel, auf der sie kleine Notizen oder nette Worte aufzuschreiben pflegten. Heute Morgen hatte in Theresas säuberlicher Schrift „Sandra nach der Schule zum Zahnarzt fahren“ darauf gestanden und klein darunter „Kein Motorrad, Rob!“. Bei dem Gedanken daran quälte er sich zu so etwas wie einem Lächeln. Doch es blieb nicht lange. Denn als er den Blick schärfte, war die Nachricht verschwunden. Stattdessen hatte jemand in einer Handschrift, die Robert nicht kannte, ein einziges Wort in leuchtend weißen Lettern darauf geschrieben.
„STERBEN“.